BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst
Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…
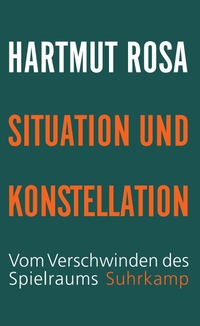
Hartmut Rosa: Situation und Konstellation
Die Lehrerin, die Noten nicht zur Ermutigung vergeben kann, die Ärztin, die Bildschirme statt Patienten behandelt, der Schiri, dessen Augenmaß vom VAR verdrängt wird: Unmerklich…

Lisa Ridzen: Wenn die Kraniche nach Süden ziehen
Aus dem Schwedischen von Ulla Ackermann. Bo ist 89, und ihm läuft die Zeit davon. Andererseits ist Zeit wenigstens etwas, das er noch zur Genüge hat. Denn seit seine Frau…

Sighard Neckel: Katastrophenzeit
In seinem neuen Buch analysiert der Soziologe Sighard Neckel das große Dilemma unserer Zeit: Während der Klimawandel auf eine ökologische Katastrophenzeit zuläuft, stellen…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier