BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
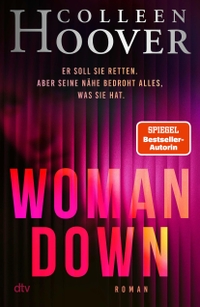
Colleen Hoover: Woman Down
Aus dem Amerikanischen von Anja Galic und Katarina Ganslandt. Der Shitstorm um die Verfilmung ihres Romans stürzte Bestsellerautorin Petra Rose in eine Schreibkrise. Sie…
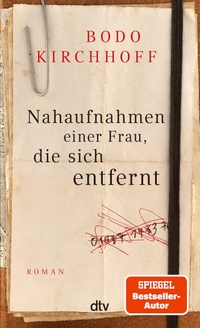
Bodo Kirchhoff: Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt
Seit fünfzig Jahren sind sie verheiratet. Dann geht er weg, nach Indien. Sie reist ihm nach, besorgt und wütend. Er: Viktor Goll, genannt Vigo, Leiter einer Denkfabrik für…
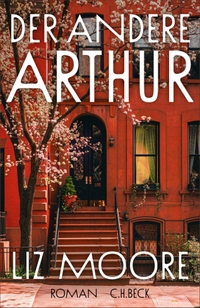
Liz Moore: Der andere Arthur
Aus dem Amerikanischen von Cornelius Hartz. Wie in der Fürsorge für andere die eigene Rettung liegen kann Arthur Opp, ehemaliger Literaturprofessor, wiegt 250 Kilo und hat…

Anatoli Kusnezow: Babyn Jar
Aus dem Russischen neu übersetzt von Christiane Körner. Mit einem Nachwort des Historikers Bert Hoppe, das die geschichtlichen Ereignisse nachzeichnet. Und einem Nachwort…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 20.04.2022 […] Was für eine schönere Aufgabe kann es für das Kino geben?
Thomas Groh
Köy - Deutschland 2021 - Regie: Serpil Turhan - Laufzeit: 90 Minuten. […] Von Nicolai Bühnemann, Thomas Groh
Im Kino 20.04.2022 […] Was für eine schönere Aufgabe kann es für das Kino geben?
Thomas Groh
Köy - Deutschland 2021 - Regie: Serpil Turhan - Laufzeit: 90 Minuten. […] Von Nicolai Bühnemann, Thomas Groh