BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
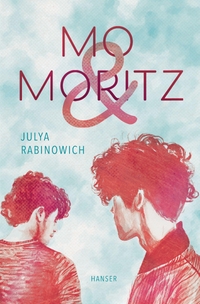
Julya Rabinowich: Mo & Moritz
Mo stammt aus einer Familie mit muslimischen Wurzeln. Als er eine Friseurlehre in einem Wiener Nobelsalon beginnt, taucht er ein in eine glamouröse Welt. Eines Abends wird…
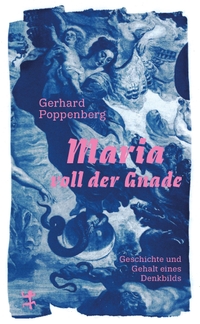
Gerhard Poppenberg: Maria voll der Gnade
Ein paar Berichte in den apokryphen Evangelien und, alles in allem, keine fünf Seiten im Neuen Testament - mehr umfasst die Geschichte von Maria nicht. Und doch ist daraus…
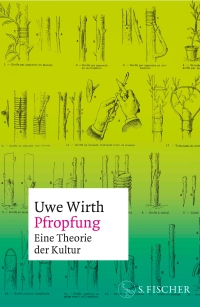
Uwe Wirth: Pfropfung - Eine Theorie der Kultur
Die Pfropfung ist eine seit der Antike gängige Technik des Land- und Gartenbaus: Verschiedenartige Pflanzen werden miteinander verbunden, um Qualität und Ertrag zu steigern.…

Charlotte Mew: Alle belebten Dinge halten den Atem an
Aus dem Englischen von Wiebke Meier. Mit einem Nachwort von Norbert Hummelt. Charlotte Mew war eine der herausragenden lyrischen Stimmen ihrer Zeit. In ihren mit den Geschlechterrollen…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier