BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Susanne Heim: Die Abschottung der Welt
Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung. Mit 19 Abbildungen und 2 Karten. In Deutschland drangsaliert und verfolgt, versuchten viele Juden verzweifelt, sich ins…

Gerhard Poppenberg: Maria voll der Gnade
Ein paar Berichte in den apokryphen Evangelien und, alles in allem, keine fünf Seiten im Neuen Testament - mehr umfasst die Geschichte von Maria nicht. Und doch ist daraus…

Jannis Brühl: Disruption
Man muss die Tech-Oligarchen des Silicon Valley als Avantgarde verstehen. Eine Handvoll Männer mit Milliardenvermögen, futuristischer Technologie und einer Vorliebe für Science-Fiction…
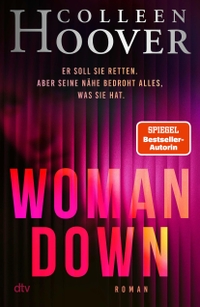
Colleen Hoover: Woman Down
Aus dem Amerikanischen von Anja Galic und Katarina Ganslandt. Der Shitstorm um die Verfilmung ihres Romans stürzte Bestsellerautorin Petra Rose in eine Schreibkrise. Sie…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier