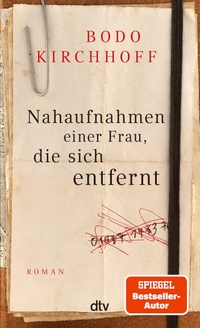BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Saki: Nie eine langweilige Zeile
Aus dem Englischen von Werner Schmitzund Claus Sprick. Eine Frau, die mit einer Hauslehrerin verwechselt wird und den Irrtum erst nach mehreren Tagen Unterricht aufklärt,…
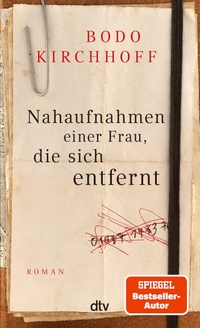
Bodo Kirchhoff: Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt
Seit fünfzig Jahren sind sie verheiratet. Dann geht er weg, nach Indien. Sie reist ihm nach, besorgt und wütend. Er: Viktor Goll, genannt Vigo, Leiter einer Denkfabrik für…

Ben Shattuck: Eine Geschichte der Sehnsucht
Nantucket im Jahre 1796. Die verwitwete Laurel bekommt überraschend Besuch von ihrer Jugendliebe Will in Begleitung seiner jungen Braut. Sie sind auf dem Weg nach Barbados…

Katja Diehl, Mario Sixtus: Picknick auf der Autobahn
Mit zehn Schwarzweiß-Abbildungen. Wie werden die Menschen in Deutschland in Zukunft autofrei und klimafreundlich unterwegs sein? Dieses Buch bietet Antworten und ist somit…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 05.05.2010 […] Dem eisernen Amerika-Mann steht ein elektropeitschenschwingender Russland-Mann gegenüber (Mickey Rourke - harter Körper, harter Akzent - als Gordon Matta Clark des Formel-1-Betriebs). Und der bringt, in prekärer Kooperation mit dem gegnerischen Vertreter des Waffenproduktionsduopols (Sam Rockwell: duracellhaseneifrig), gegen das Eisenmannindividuum Stark geklonte Dronen ins Spiel. […] Von Lukas Foerster, Thomas Groh, Ekkehard Knörer
Im Kino 05.05.2010 […] Dem eisernen Amerika-Mann steht ein elektropeitschenschwingender Russland-Mann gegenüber (Mickey Rourke - harter Körper, harter Akzent - als Gordon Matta Clark des Formel-1-Betriebs). Und der bringt, in prekärer Kooperation mit dem gegnerischen Vertreter des Waffenproduktionsduopols (Sam Rockwell: duracellhaseneifrig), gegen das Eisenmannindividuum Stark geklonte Dronen ins Spiel. […] Von Lukas Foerster, Thomas Groh, Ekkehard Knörer