BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
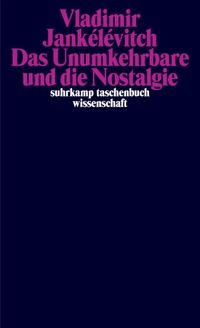
Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Tomer Gardi: Liefern
Aus dem Hebräischen von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer. Sie sind überall, wir sehen sie jeden Tag. Egal ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Berlin,…

Sighard Neckel: Katastrophenzeit
In seinem neuen Buch analysiert der Soziologe Sighard Neckel das große Dilemma unserer Zeit: Während der Klimawandel auf eine ökologische Katastrophenzeit zuläuft, stellen…
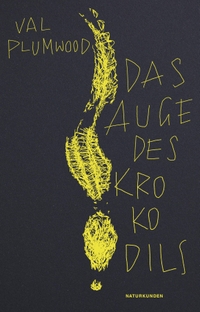
Val Plumwood: Das Auge des Krokodils
Herausgegeben von Judith Schalansky. Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier. Als die Philosophin Val Plumwood mit dem Kajak durch den nordaustralischen Kakadu-Nationalpark…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 30.12.2021 […] Mag sein, aber "Moleküle der Erinnerung" ist dennoch kein überflüssiger Film. […] Von Olga Baruk, Nicolai Bühnemann
Im Kino 30.12.2021 […] Mag sein, aber "Moleküle der Erinnerung" ist dennoch kein überflüssiger Film. […] Von Olga Baruk, Nicolai Bühnemann