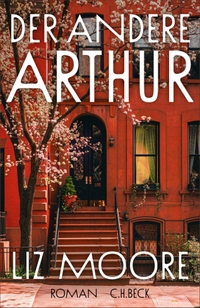BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Christoph Bartmann: Attacke von rechts
Anhand internationaler Beispiele zeigt Christoph Bartmann wie Rechtspopulisten die Kulturpolitik als Kampfplatz für ihre Ideologie nutzen. Museen, Theater und Bibliotheken…

Magdalena Schrefel: Das Blaue vom Himmel
Was, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Erde abzukühlen, der Himmel dadurch aber nie wieder blau wäre? Hannah arbeitet an einer Ausstellung mit, die dieses Blau bewahren soll,…
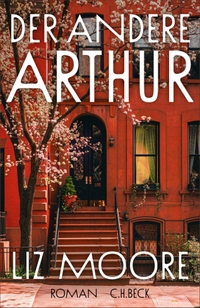
Liz Moore: Der andere Arthur
Aus dem Amerikanischen von Cornelius Hartz. Wie in der Fürsorge für andere die eigene Rettung liegen kann Arthur Opp, ehemaliger Literaturprofessor, wiegt 250 Kilo und hat…

Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Mia, erfolgreiche Schriftstellerin in Paris, kämpft mit "brain fog", einem Gehirnnebel, der ihre Erinnerungen und ihre Arbeit beeinträchtigt.…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 04.02.2026 […] Michael Kienzl
No Other Choice - Südkorea 2025 - OT: Eojjeolsugaeopda - Regie: Park Chan-wook - Darsteller: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min - Laufzeit: 139 Minuten. […] Von Michael Kienzl
Im Kino 04.02.2026 […] Michael Kienzl
No Other Choice - Südkorea 2025 - OT: Eojjeolsugaeopda - Regie: Park Chan-wook - Darsteller: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min - Laufzeit: 139 Minuten. […] Von Michael Kienzl