BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst
Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…
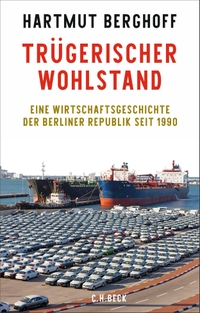
Hartmut Berghoff: Trügerischer Wohlstand
Vom Musterknaben zum Patienten? Die deutsche Wirtschaft seit der Wiedervereinigung Die Bundesrepublik befindet sich mitten in einer "Zeitenwende" und steht vor tiefgreifenden…

Maximilian Oehl: Brand New Bundestag
Die politischen Systeme in unserem Land wirken festgefahren und verstaubt. Sie scheinen kaum in der Lage, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Es ist höchste…
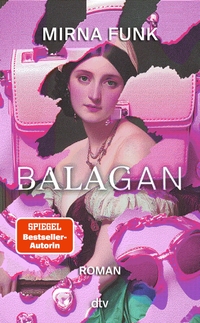
Mirna Funk: Balagan
Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier