BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
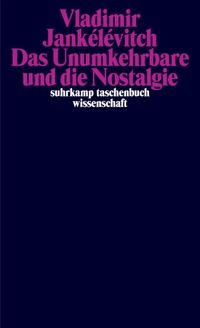
Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Julya Rabinowich: Mo & Moritz
Mo stammt aus einer Familie mit muslimischen Wurzeln. Als er eine Friseurlehre in einem Wiener Nobelsalon beginnt, taucht er ein in eine glamouröse Welt. Eines Abends wird…

Katja Diehl, Mario Sixtus: Picknick auf der Autobahn
Mit zehn Schwarzweiß-Abbildungen. Wie werden die Menschen in Deutschland in Zukunft autofrei und klimafreundlich unterwegs sein? Dieses Buch bietet Antworten und ist somit…
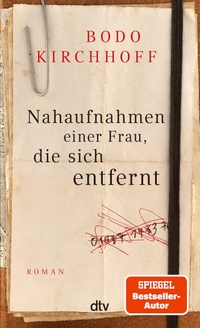
Bodo Kirchhoff: Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt
Seit fünfzig Jahren sind sie verheiratet. Dann geht er weg, nach Indien. Sie reist ihm nach, besorgt und wütend. Er: Viktor Goll, genannt Vigo, Leiter einer Denkfabrik für…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 22.06.2017 […] Ansonsten kreist "Space is the Place" um seinen unangefochtenen Protagonisten: den Jazztausendsassa Sun Ra. […] Von Lukas Foerster, Fabian Tietke
Im Kino 22.06.2017 […] Ansonsten kreist "Space is the Place" um seinen unangefochtenen Protagonisten: den Jazztausendsassa Sun Ra. […] Von Lukas Foerster, Fabian Tietke