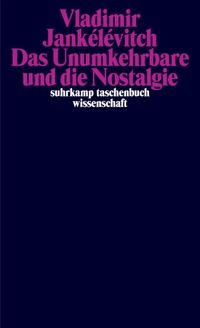BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Joachim Scholtyseck: Henkel
Das 1876 von Fritz Henkel gegründete Unternehmen Henkel ist ein Kind des frühen Deutschen Kaiserreichs. Der steigende Lebensstandard der Bevölkerung erhöhte die Nachfrage…

Sighard Neckel: Katastrophenzeit
In seinem neuen Buch analysiert der Soziologe Sighard Neckel das große Dilemma unserer Zeit: Während der Klimawandel auf eine ökologische Katastrophenzeit zuläuft, stellen…

Tomer Gardi: Liefern
Aus dem Hebräischen von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer. Sie sind überall, wir sehen sie jeden Tag. Egal ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Berlin,…
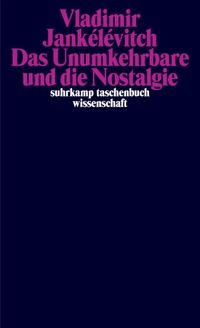
Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 18.05.2016 […] Was das George Lucas-Universum anbelangt, halte ich persönlich zwar "Return of the Jedi" für den besten der gesamten Serie; zu "X-Men: Apocalypse" aber passt die Beobachtung wie die Faust aufs Auge. […] Von Nicolai Bühnemann, Thomas Groh
Im Kino 18.05.2016 […] Was das George Lucas-Universum anbelangt, halte ich persönlich zwar "Return of the Jedi" für den besten der gesamten Serie; zu "X-Men: Apocalypse" aber passt die Beobachtung wie die Faust aufs Auge. […] Von Nicolai Bühnemann, Thomas Groh