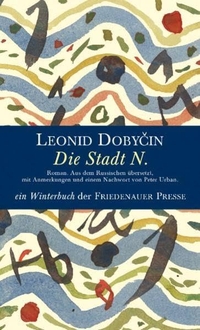Die Stadt N.
Roman
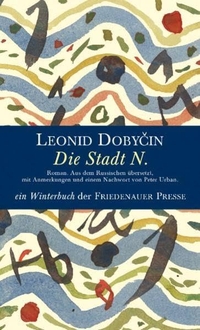
Friedenauer Presse, Berlin 2009
ISBN
9783932109614
Gebunden, 230 Seiten, 22,50
EUR
Klappentext
Aus dem Russischen und mit Anmerkung von Peter Urban. Leonid Dobycin geriet 1935 ins Zentrum der berüchtigten Formalismus-Debatte, er wurde als Volksfeind bezeichnet. Der Roman "Die Stadt N." erschien 1935, ein Jahr danach starb der Autor. Man hat lange geglaubt, er hätte sich das Leben genommen. Seit die Berichte der NKVD-Spitzel bekannt sind, die ihn in seinen Leningrader Jahren beschattet haben, sind Zweifel an dieser Version aufgekommen. In dem Roman, an dem Dobycin seit 1928 arbeitete, schildert er eine kleinbürgerliche Kindheit in der russischen Provinz - schon dies war ein Affront für die damaligen Literaturbeamten, weil er weder den heldenhaften Aufbau noch einen neuen Menschen zum Thema macht. In der Kleinstadt scheint die Zeit stillzustehen, die Entwicklung des einsamen Jungen bleibt völlig unberührt von politischem Geschehen. Schon das war zur Zeit des sozialistischen Aufbruchs ein Tabubruch.
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 25.06.2010
Neu ist zwar nur Peter Urbans sehr gelungene Übersetzung von Leonid Dobycins 1936 erschienenem Roman "Die Stadt N.", diese verdient aber ebenso viel Beachtung wie der Roman selbst, so Rezensent Christoph Bartmann. Denn Urban deutsche den Text nicht nur ein, sondern lege viel Wert darauf, Dobycins radikale Abweichungen von der russischen Standardsprache zu erhalten. Dies erleichtert zwar nicht immer unbedingt den Lesefluss -wie es noch Gabriele Leupolds freiere Übersetzung von 1989 tut-, hat aber durchaus seine Berechtigung: Neben Dobycins Prinzip des nicht vorhandenen Autors waren es vor allem seine Verstöße gegen die russische Standardsyntax, die ihm den "Formalismus"-Verdacht somit rüde Kritik der stalinistischen Literaturfunktionäre einbrachte. Diese warfen seinem in knappen, meist nur registrierenden Erzähleinheiten gehaltenen Porträt seiner Geburtstadt "spätbürgerliche Dekadenz" vor. Dobycins Konsequenz: Er verschwand und gilt bis heute als verschollen. Urban hingegen verschwindet nicht in seiner Übersetzung, bei der Lektüre lese man ihn immer mit, wie der Rezensent milde kritisiert. Dennoch fordert er eindringlich, das nach allen editorischen und literarischen Standards übersetzte Werk zu lesen.
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 12.01.2010
Dass das lange in der Versenkung verschwundene Werk des russischen Autors Leonid Dobycin, der sich 1936 nach der vernichtenden Kritik seines Romans "Die Stadt N" das Leben nahm, nun auch in deutscher Übersetzung wieder zugänglich ist, begrüßt Ralph Dutli nachdrücklich. Der autobiografisch geprägte Roman erzählt aus Kinderperspektive vom Leben in einer multikulturellen Provinzstadt und wurde deshalb so angefeindet, weil er stilistisch und inhaltlich so gar nicht in die stalinistischen Vorstellungen von der Literatur des "Neuen Menschen" passte und zudem moralische Tabus brach, erklärt der Rezensent. Auch ihn stößt die extrem verknappte Sprache, die den kindlichen Blickwinkel mit einem "geschäftsmäßigen Telegrammstil" verknüpft und alle Wahrnehmungen gleichwertig nebeneinander stellt, durchaus vor den Kopf. Doch beeindruckt ihn der furchtlos jeder Illusion oder Beschönigung entgegenstehende Blick nachdrücklich, wie er deutlich macht. Dutli hat allerdings etwas Mühe mit der Übersetzung von Peter Urban, die sich sehr eng an der russischen Syntax orientiert, weshalb es zu manch seltsamer Wendung kommt, wie der Rezensent feststellt. Auch die vielen unübersetzten russischen Wörter, die man umständlich im Anhang nachschlagen muss, stören ihn in ihrer "fragwürdigen Exotik".
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.11.2009
Rezensent Tilman Spreckelsen stellt Leonid Dobycins 1936 publizierten Roman "Die Stadt N." vor, der dem Autor in der stalinistischen Sowjetunion scharfe Kritik eingetragen hatte. Nach einer Diskussionsveranstaltung, bei der sein Roman als "zutiefst feindlich" verurteilt und Dobycin persönlich heftig attackiert wurde, verschwand er spurlos und noch heute weiß man nicht, ob er sich umbrachte oder vom Geheimdienst ermordet wurde, erzählt der Rezensent. Ihm hat sich sofort erschlossen, warum das schmale Buch die Gemüter damals so erregt hat, denn erzählt wird aus der Perspektive eines äußerst sensiblen Jungen aus einer lettisch-russischen Garnisonstadt, die unschwer als das heutige Daugavpils, damals Dünaburg erkennbar ist. Die ruhigen Betrachtungen des Jungen, der politische Ereignisse nur am Rande wahrnimmt und überall Beobachtungen von existentieller Bedeutung macht, entsprach so gar nicht dem "neuen Menschen" des Stalinismus und auch die Vorboten der Revolution werden in dem Roman nicht thematisiert, erklärt Spreckelsen. Es ist die "sanfte Verweigerung" eines Heranwachsenden, die aus jeder Zeile faszinierend "leicht" spricht, so der Rezensent beeindruckt.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 26.11.2009
Vor einem "ungewöhnlichen Entwicklungsroman" verneigt sich Rezensentin Olga Martynova, und stellt Leonid Dobycin mit Kafka und Bruno Schulz in die Reihe der "seltsamsten und melancholischsten Genies" des 20. Jahrhunderts, wobei Dobycin ihrer Ansicht nach selbst dort noch besonders einsam und unglücklich wirkt. Die Prosa dieses Romans, den sie "sein kleines Opus Magnum nennt", sei so dicht, dass sein Material für 1000 Seiten "konventionellen Erzählens" ausreichen würde. Allerdings müsse man diese Geschichte eines 17jährigen in einer lettischen Stadt im russischen Revolutionsjahr 1905 und seinen rasanten Veränderungen langsam lesen und vor allem genau, um wahrnehmen zu können, was sich in dieser äußerst verdichteten Prosa alles ereignet. Der Protagonist hat für die Kritikerin Oskar-Matzerath-Format, während die geschilderte Stadt es an Farbigkeit für sie mit Marcel Prousts Combray aufnehmen kann.
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)