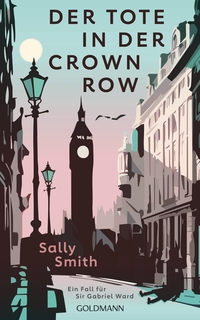BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Gabriel Zucman: Reichensteuer
Aus dem Französischen von Ulrike Bischoff. Gabriel Zucman gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Ökonomen weltweit. Seit Jahren forscht er zu Steuergerechtigkeit…
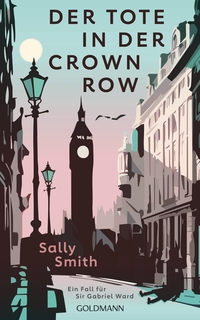
Sally Smith: Der Tote in der Crown Row
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt. London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der…

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst
Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…

Julya Rabinowich: Mo & Moritz
Mo stammt aus einer Familie mit muslimischen Wurzeln. Als er eine Friseurlehre in einem Wiener Nobelsalon beginnt, taucht er ein in eine glamouröse Welt. Eines Abends wird…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 04.01.2018 […] .
---
Wenn "Bright" auch nur ein klein wenig besser wäre, hätte ich Lust, die von der Kritik mehrheitlich und zum Teil recht hysterisch gescholtene netflix-Produktion zu verteidigen. […] Von Nicolai Bühnemann, Lukas Foerster
Im Kino 04.01.2018 […] .
---
Wenn "Bright" auch nur ein klein wenig besser wäre, hätte ich Lust, die von der Kritik mehrheitlich und zum Teil recht hysterisch gescholtene netflix-Produktion zu verteidigen. […] Von Nicolai Bühnemann, Lukas Foerster