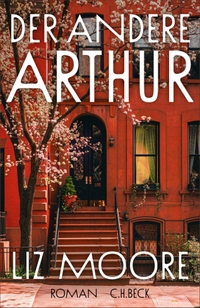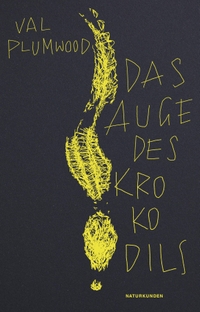BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Evan Osnos: Yacht oder nicht Yacht
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Evan Osnos nimmt uns mit in die Welt der Superreichen: Sehr lange Yachten, extravagante Partys, katastrophensichere Luxusbunker,…

Christien Brinkgreve: Ein Versuch, meine Liebe zu ordnen
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing. Nach dem Tod ihres Mannes räumt Christien Brinkgreve das gemeinsame Haus um. Was wie eine äußere Routine erscheint, stößt bei ihr…
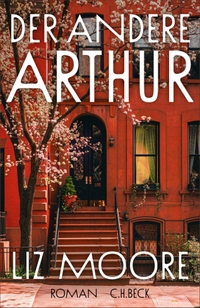
Liz Moore: Der andere Arthur
Aus dem Amerikanischen von Cornelius Hartz. Wie in der Fürsorge für andere die eigene Rettung liegen kann Arthur Opp, ehemaliger Literaturprofessor, wiegt 250 Kilo und hat…
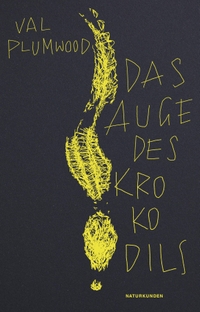
Val Plumwood: Das Auge des Krokodils
Herausgegeben von Judith Schalansky. Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier. Als die Philosophin Val Plumwood mit dem Kajak durch den nordaustralischen Kakadu-Nationalpark…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Außer Atem: Das Berlinale Blog 13.02.2013 […] Am Ende dieses vielleicht schönsten Films, der dieses Jahr auf der Berlinale zu sehen ist, steht eine Kamerafahrt, zwischen zwei eng beieinander stehende Häuser hindurch und dann hinaus ins Freie, eine Fahrt, in die sich ein ganzes Leben, mit all seinen Wünschen, Hoffnungen, Freuden, Enttäuschungen einschreibt.
Lukas Foerster
"Yuyake gumo" (Farewell to Dream). Regie: Keisuke Kinoshita. […] Von Lukas Foerster
Außer Atem: Das Berlinale Blog 13.02.2013 […] Am Ende dieses vielleicht schönsten Films, der dieses Jahr auf der Berlinale zu sehen ist, steht eine Kamerafahrt, zwischen zwei eng beieinander stehende Häuser hindurch und dann hinaus ins Freie, eine Fahrt, in die sich ein ganzes Leben, mit all seinen Wünschen, Hoffnungen, Freuden, Enttäuschungen einschreibt.
Lukas Foerster
"Yuyake gumo" (Farewell to Dream). Regie: Keisuke Kinoshita. […] Von Lukas Foerster