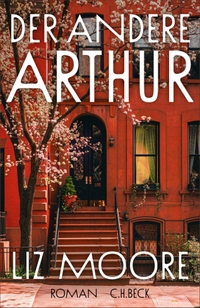9punkt - Die Debattenrundschau
Höchster Champagner-Konsum je Kopf
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Europa
In der taz erinnert Heike Kleffner, Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e. V., an die Hetzjagd auf Migranten in Chemnitz vor fünf Jahren. Was hat sich seitdem getan? Nichts, stellt sie fest. "Zum fünften Jahrestag des Angriffs warten die Verletzten noch immer auf einen erstinstanzlichen Prozessbeginn. Die Angegriffenen fühlen sich vom Rechtsstaat im Stich gelassen und zeigen sich überzeugt davon, dass eine konsequente Verfolgung der Neonazis von Chemnitz den Mord an Walter Lübcke möglicherweise hätte verhindern können. Nur die angeklagten Neonazis profitieren von der langen Verfahrensdauer. So wie auch im Fall des antisemitisch motivierten Angriffs eines Dutzends Neonazis auf das koschere Restaurant 'Schalom' am 27. August 2018 in Chemnitz. Die vermummten Angreifer hatten unter anderem 'Hau ab aus Deutschland, du Judensau' gerufen, den Besitzer des Restaurants verletzt und eine Fensterscheibe zertrümmert. Ein einziger von ihnen ist inzwischen rechtskräftig verurteilt worden: zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe. Vier weitere Ermittlungsverfahren gegen organisierte Neonazis schleppen sich seit fünf Jahren hin."
Koran-Verbrennungen stellen Länder wie Dänemark, denen an freier Meinungsäußerung liegt, vor heikle Fragen, schreibt Kenan Malik im Observer. "Nichtsdestotrotz ist die Verbrennung von symbolischen Objekten, seien es Bücher oder Fahnen, seit langem Teil der Protesttradition, und in einer Zeit, in der das Recht auf Protest ständig beschnitten wird - selbst in liberalen Demokratien - sollten wir nicht leichtfertig darauf verzichten. Das vorgeschlagene dänische Gesetz zielt jedenfalls darauf ab, nicht nur Bücherverbrennungen zu kriminalisieren, sondern jede 'unsachgemäße Behandlung von Gegenständen mit erheblicher religiöser Bedeutung' - ein weitgehendes Verbot der Blasphemie." Von diesem Recht haben bisher vor allem Gruppen Gebrauch gemacht, denen nichts anderes blieb, als gegen die religiösen Eliten zu demonstrieren. Statt solche Gesetze auf den Weg zu bringen, sollte Dänemark zuerst die eigenen illiberalen Migrationspraktiken hinterfragen, schlägt Malik vor.
Im NZZ-Gespräch unterhalten sich der Übersetzer Mark Belorusez und der Historiker Anatoli Holowko über die schwindende Bilingualität in der Ukraine - Ukrainisch wurde nach der Unabhängigkeit zur Staatssprache - Russisch nicht. Anatoli Holowko: "Bis zur Besetzung der Krim und von Teilen des Donbass durch Russland 2014 hatte diese gesetzliche Regelung keine besondere Bedeutung. Das Land war de facto zweisprachig. Die Hälfte der Abgeordneten im Parlament sprach kein Ukrainisch und hielt ihre Reden auf Russisch. In den Städten kommunizierten die meisten Bewohner weiterhin auf Russisch. Dies ist die unvermeidliche, jahrzehntelange Trägheit bei der Umwandlung der halbkolonialen Ukraine in ein unabhängiges Land. Den Machthabern der Russischen Föderation ist entgangen, dass sich nach und nach eine neue ukrainische Gesellschaft herausgebildet hat und eine Zivilgesellschaft entstanden ist. Sie haben nicht erwartet, dass sich die Gesellschaft im Kampf gegen die Invasion solidarisieren und die 'Befreier' nicht mit Blumen empfangen würde."
Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland hat einen Film über Frauen gedreht, die in Polen Flüchtlingen an der grünen Grenze - solchen aus Syrien, nicht aus der Ukraine - helfen. Sie spricht im Interview mit Viktoria Großmann von der SZ kritisch über das politische Klima in Polen, in dem sich auch viele Künstler duckten. Dass es vor allem Frauen sind, die Flüchtlingen helfen, wundert sie nicht: "Sie sind sensibler, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Gerade hier in Polen, wo die Frauen in der Mehrheit sind, aber wie eine Minderheit behandelt werden. Es gibt schon auch Männer, die sich an der Grenze engagieren. Trotzdem: Wenn in Polen nur Frauen wählen würden, hätten die rechten Parteien keine Chance."
Nun hat der bayerische Ministerpräsident entschieden: Aiwanger darf bleiben. Die SZ konnte nicht nachweisen, dass das berüchtigte antisemitische Flugblatt von Hubert Aiwanger war, und Aiwanger hatte sich entschuldigt, wenn auch ohne zu benennen, wofür, und ohne die Gerüchte über eine rechtsextreme Vergangenheit entkräften zu können. Die 25 Fragen, die ihm Söder gestellt hatte, beantwortete Aiwanger mit impertinenter ständiger Berufung auf seine Gedächtnislücken.
Ein kleines bisschen wankelmütig klingt der Kommentar von Detlef Esslinger in der SZ: "Eine Entscheidung, die bei der Jury gut ankommt, hätte verheerende Folgen haben können, für die CSU, aber mutmaßlich auch für das Land - gesellschaftliche Polarisierung, neue Systemskepsis, vielleicht das Ende der Freien Wähler als Partei der Mitte. Aber: Können nicht auch die Folgen der Entscheidung, die Söder letztlich getroffen hat, verheerend sein?" Auf der Seite 3, der berühmten Reportageseite der SZ, die heute aber wieder eher kommentierend ist, schreiben die Autoren dagegen: "Die Flugblattaffäre wäre Söders Chance gewesen, sich aus Aiwangers Ketten zu lösen. Nun hat er die Kette noch fester gezurrt. Die zahlreichen Aiwanger-Fans in der eigenen Partei hat er damit beruhigt. Wie groß für die CSU der Schaden ist, den er jetzt begrenzen will, wird Söder am Wahlabend sehen."
"Für Hubert Aiwanger beginnt jetzt die Phase der tätigen Reue, da hat er erheblichen Nachholbedarf", meint Hannes Hintermeier im FAZ-Feuilleton. "Sein Umgang mit den Vorhaltungen war kleinmütig. Sich als geerdeten und von den Medien gehetzten Menschenfreund hinzustellen, ist, mit oder ohne Kommunikationsberater, keine überzeugende Idee gewesen."
Geschichte
Ideen
Politik
Die westliche Welt wurde vom Putsch im Niger überrumpelt und verlor einen wichtigen Partner in der Sahel-Zone. "Da war viel Wunschdenken im Spiel. Etwa in dem Sinn: 'Diese Regierung handelt in unserem Interesse, also muss sie gut sein.'", sagt der Politikwissenschaftler Abdourahmane Idrissa im NZZ-Interview mit Samuel Misteli. Man habe vor allem nicht wissen wollen, was die nigrischen Eliten zum Westen stehen. "Gewöhnliche Leute in Niger wussten nichts über Russland, (...). Aber die intellektuelle Elite ist geprägt von der Idee, dass Afrika während der Zeit des Unabhängigkeitskampfs von der Sowjetunion gegen den Westen unterstützt wurde. Viele sehen Russland noch immer als Befreiungsmacht - was schon immer Unsinn war, weil die Sowjetunion ein Imperium war. Aber diese Idee ist eine ideologische Goldmine, die Moskau ausbeutet."
Gesellschaft

Säkular denkende Menschen in Berlin haben sich gegen diesen Post vehement gewehrt, schreibt Gisa Bodenstein bei hpd.de und zitiert unter anderem Naïla Chikhi von den "Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung". "Das Kopftuch sei kein muslimisches Gebot, sondern die Materialisierung einer sexistischen ideologischen Interpretation des Islam durch streng konservative bis fundamentalistische religiöse Kräfte. 'Es segregiert Frauen von Männern (Mädchen von Jungen) sowie Frauen und Mädchen untereinander (muslimisch und sittsam versus nichtmuslimisch und sündig gelesene Frauen/Mädchen)', erläutert Chikhi gegenüber dem hpd." Es gehe an den Schulen vor allem darum die Mädchen aufzuklären, dass sie die gleichen Rechte haben wie Jungen: "Eine Lehrerin mit Kopftuch könne diese Grundhaltung beim besten Willen nicht transportieren. 'Als Vorbilder setzen sie alle Mädchen aus muslimischen Communitys unter Druck, die kein Kopftuch tragen.'"