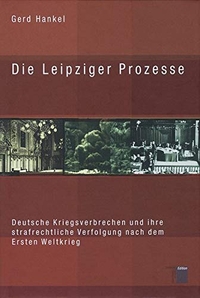Die Leipziger Prozesse
Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg
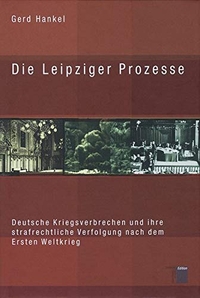
Hamburger Edition, Hamburg 2003
ISBN
9783930908851
Gebunden, 400 Seiten, 30,00
EUR
Klappentext
Ein Strafverfahren der Siegermächte gegen deutsche Kriegsverbrecher - wie 1945/46 in Nürnberg - sollte schon nach dem Ersten Weltkrieg stattfinden. Die Erbitterung über die deutsche Kriegführung, die sich an der Bekämpfung des angeblichen belgischen Volkskriegs und der Behandlung der Kriegsgefangenen, an dem uneingeschränkten U-Bootkrieg und der Politik der verbrannten Erde festmachte, war zu groß, als daß in einem Friedensvertrag wie üblich eine Amnestie hätte vereinbart werden können. Gerd Hankel analysiert warum es zu den damals geplanten Verfahren nicht kam und welch weitreichende Konsequenzen diese Entscheidung mit sich brachte. Die Alliierten verzichteten auf ihre Durchführung vor allem, weil sich Deutschland bereit erklärte, die Beschuldigten selbst vor das höchste deutsche Gericht, das Reichsgericht in Leipzig, zu stellen.
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 24.07.2003
Wie deutsche Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg (nicht) geahndet wurden, hat Uwe Wesel in der "sehr sorgfältigen und eindrucksvollen Beschreibung" der Leipziger Prozesse von Gerd Hankel gelesen. Wesel berichtet, dass der Jurist Hankel sich unter anderem auf neues Material aus Archiven der DDR stützt. Hanke beschreibe sowohl die Vorgeschichte dieser Prozesse, den Versailler Vertrag, als auch die Prozesse selbst. Bei den Verhandlungen hat Wesel einen "schwarzweißroten Faden" entdeckt: die Überzeugung der Angeklagten und der Richter, dass deutsche Soldaten keine Kriegsverbrechen begehen - "schon gar nicht deutsche Offiziere". So fallen dann auch die Urteile "nicht überzeugend" oder sogar falsch aus, da sind Autor und Rezensent gleicher Meinung: Von 45 Verfahren wurden 35 eingestellt, sechs von den zehn Urteilen waren Freisprüche. Der Rezensent verrät uns auch Hankels Resümee: Dass Kriegsverbrecher vom eigenen Staat unzureichend verfolgt werden, sei keine deutsche Besonderheit. In Bezug auf den Internationalen Gerichtshof sei Hankel skeptisch, fügt Wesel hinzu. Obwohl der Autor dabei nicht genauer auf die Rolle der USA eingehe, hat er ein wichtiges Buch geschrieben, findet Rezensent Wesel: "lesenswert auch für uns alte Europäer, die immer noch glauben, das Recht werde sich durchsetzen".
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.05.2003
Eberhard Kolb hat eine vollständige und "minuziöse" Aufarbeitung der "Leipziger Prozesse" gelesen, die anders als die "Nürnberger Prozesse" nie Eingang in ein völkerübergreifendes kollektives Gedächtnis gefunden haben. Sie sollten der Bestrafung deutscher Kriegsverbrechen nach dem Ersten Weltkrieg dienen, waren aber schon ihrem Zustandekommen nach ein fauler Kompromiss zwischen Deutschland und den Alliierten: Deutschland, erklärt Kolb, weigerte sich, Verdächtige auszuliefern und durfte schließlich die Verfahren in Leipzig selber durchführen - die "großen Namen" waren da schon außer Gefahr, belangt zu werden. 45 Personen wurden schließlich angeklagt, nur gegen zehn von ihnen ergingen Urteile, die zum Teil später sogar wieder aufgehoben wurden. Der Hauptgrund dafür, das mache diese Studie deutlich, sei der Unwillen auf deutscher Seite gewesen, tatsächlich Recht zu sprechen. Die Schlussfolgerung des Autors gehe jedoch über den nationalen Kontext hinaus: "Verbrechen, die in Form eines staatlichen Handelns gekleidet sind, werden nicht oder nur sehr unzureichend von demselben Staat geahndet."
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 16.05.2003
Nach dem Ersten Weltkrieg sollte Deutschland für seine Kriegsverbrechen vor einem internationalen Tribunal zur Verantwortung gezogen werden. Aus politischen Gründen folgten die Alliierten allerdings dem Vorschlag Deutschlands, diese Prozesse in Eigenregie zu führen. Das Ergebnis war eine Farce: sieben geringe Freiheitsstrafen, zehn Freisprüche sowie Hunderte von eingestellten Verfahren. Die Forschung hat sich bisher kaum mit diesem Kapitel deutscher Geschichte beschäftigt, berichtet Rezensent Michael Stolleis. Um so wichtiger erscheint ihm Gerd Hankels Arbeit "Die Leipziger Prozesse", eine auf Grundlage von Akten erarbeitete "vollständige Darstellung" dieser Verfahren vor dem Reichsgericht nebst einer "gut belegten Geschichte" des Völkerrechts in Sachen "Kriegsverbrechen". Für Stolleis eine wahrhaft "aufregende Lektüre". Hankels Buch biete "Juristische Zeitgeschichte", resümiert Stolleis, "sachlich und kühl aufbereitet, mit durchschimmernden, aber unausgesprochenen Bezügen zur Gegenwart."
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 19.03.2003
Beeindruckend findet Wolfgang Kruse die großangelegte Schilderung der Leipziger Kriegsverbrecherprozesse, wenn auch "manchmal etwas langatmig". Henkel gelinge es, die politische Grundhaltung der deutschen Justiz nach dem ersten Weltkrieg deutlich zu machen, der es offensichtlich nicht um Strafverfolgung ging, sondern darum, "deutsche 'Kriegshelden' von jedem Vorwurf reinzuwaschen". Die moralischen Abgründe, die der Autor dabei in seiner Darstellung der deutschen Kriegsverbrechen vor allem in Belgien und Nordfrankreich aufzeigt, "verlangen dem Leser einiges ab", warnt der Rezensent. Insgesamt überzeuge der voluminöse Band aber durch seine "Vielschichtigkeit und Differenziertheit", mit der er die ersten Geburtswehen der internationalen Ahndung von Kriegsverbrechen beschreibt.
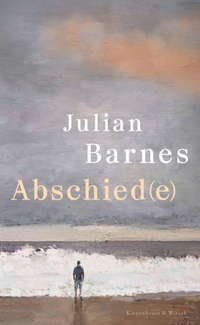 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)