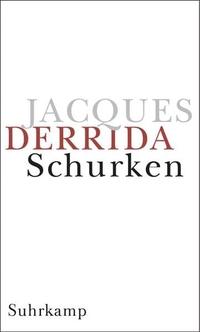Schurken
Zwei Essays über die Vernunft
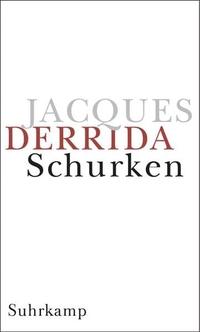
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003
ISBN
9783518583739
Gebunden, 220 Seiten, 24,90
EUR
Klappentext
Aus dem Französischen von Horst Brühmann. Seit den Ereignissen des 11. September haben die "Schurkenstaaten" eine ungeahnte Bedeutung angenommen. Wir leben im Zeitalter der "Schurkenstaaten". Dieser Begriff eröffnet grundlegende politische Fragen wie die nach staatlicher Souveränität, aber auch nach den politischen Möglichkeiten und Grenzen der Vereinten Nationen, ja nach der Demokratie als solcher. "Was geschieht", so fragt Derrida, "mit den Begriffen der 'Politik', des 'Kriegs' und des 'Terrorismus', wenn das alte Gespenst der staatlichen Souveränität seine Glaubwürdigkeit verliert?" Zwischen Globalisierung und staatlicher Souveränität, dem Recht der Macht und der Macht des Rechts, "Schurkenstaaten" und nationalen wie internationalen demokratischen Organisationen steht die Demokratie als solche auf dem Spiel.
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 28.10.2003
Noch nie wurde ein Buch des französischen Philosophen so unmittelbar politisch wahrgenommen, berichtet Sonja Asal und verweist auf den politischen Kontext der Auseinandersetzungen um den Irakkrieg, die den zwei im Sommer 2002 gehaltenen Vorträgen Jacques Derridas ungewohnte Beachtung im politisch-publizistischen Bereich gewährten. Zumal Derridas "Volte", so Asal, die USA als ersten Schurkenstaat zu bezeichnen, natürlich für Aufregung sorgen musste. Doch Aufregung beiseite - Derrida führe im Grunde seine in "Gesetzeskraft" begonnene Reflexion über das Verhältnis von Gewalt und Gerechtigkeit fort und übertrage das ganze in den Antagonismus der Begriffe Demokratie und Souveränität, erklärt Asal. Denn der Demokratie sei immer auch "eine undemokratische Möglichkeit inhärent", d.h. zu ihrer Verteidigung müsse sie sich auch einschränken, oder anders ausgedrückt: der Gebrauch von Macht schließt auch den Missbrauch von Macht ein. Derrida genügt diese Feststellung nicht, stellt Asal fest, er denke mithilfe von Platon und Aristoteles über die Demokratie als Regierungsform der Zukunft nach, bei der Souveränität nicht einem einzelnen, sondern dem Volk zukommt. Noch nie habe man die politischen Implikationen von Derridas Methode der Dekonstruktion deutlicher formuliert lesen können, schreibt die Rezensentin angetan.
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 21.10.2003
Das Wort 'Schurke' kann liebevoll gemeint sein, aber auch einen wirklich miesen Typen bezeichnen, sinniert Uwe Justus Wenzel, ein eher changierender Begriff also. Wer oder was aber ein Schurkenstaat ist, wüssten wir dank der Sicherheitsberater der amerikanischen Regierung genau, führt Wenzel fort: nämlich wer oder was immer von den Vereinigten Staaten als solcher bezeichnet würde. Der französische Philosoph Jacques Derrida geht da - schurkischer Weise, witzelt Wenzel - noch weiter: alle Staaten seien Schurkenstaaten, weil es eigentlich keine souveräne Macht, keine souveräne Demokratie ohne Machtmissbrauch geben könne. Dem Verfasser geht es dabei nicht, hält Wenzel fest, um eindeutigen Machtmissbrauch, sondern um den zweideutigen Gebrauch von Macht - und um die Verteidigung der Vernunft. Werde heute das Ende souveräner Staatlichkeit behauptet, so läge darin doch auch eine Chance, erläutert Wenzel Derridas hintersinnige Überlegungen zur Souveränität, denn vielleicht gebe es ja auch eine Chance für eine nicht mehr souveräne Souveränität? Eine Souveränität, die auch Kompromisse aushandeln und zulassen sollte. Derrida gibt sich bescheiden, sagt Wenzel, doch man solle sich davor hüten, seiner Gedankenspielerei den Ernst abzuerkennen, warnt er.
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 25.09.2003
Derridas Rede von den USA als Schurkenstaat, erklärt Thomas Assheuer, ist natürlich vor allem ein rhetorischer Aufhänger. Worauf er wirklich hinauswolle: Der westliche Liberalismus gefährdet seine eigene Substanz in dem Augenblick, das er sie zu erhalten vorgebe - die Einschränkung von Freiheit im Namen der Freiheit. Demokratie habe sich selber "autoimmunisiert" und fordere für sich unbedingte Souveränität, "denn Demokratie ist auf Macht angewiesen, und diese will ungeteilt herrschen" - so fallen Macht und Recht in eins. Aus diesem geschlossenen Kreis, dem wir seit der Antike verhaftet sind, wolle Derrida ausbrechen, indem er die Geschlossenheit der gedanklichen Figuren, mit denen Dinge aus sich selbst heraus begründet werden, aufbreche - mit dem Werkzeug der Dekonstruktion gegen den alten, selbstverständlich gewordenen "Glauben an Macht und Souveränität" - um den geschlossenen Kreis für den Anderen zu öffnen. "Man ahnt", schreibt Assheuer, "worauf Derrida hinauswill. Er zielt auf das 'Un-Mögliche', auf eine Kernspaltung im abendländischen Denken. Der Anspruch der Souveränität soll von der Idee des Unbedingten abgetrennt, Macht und Recht sollen entkoppelt und der Monotheismus der Moderne von seiner Selbstverhärtung, seiner Autoimmunität befreit werden." Wie aber lasse sich in Handeln übersetzen, was die gegenwärtigen Voraussetzungen politischen Handelns in Frage stellt? Derrida hoffe auf die UN, "in denen staatliche Souveränität nicht länger mit kollektiver Verantwortung kollidiert", und träume von einer immer "kommenden Aufklärung", zu der man gelange, indem man auf alle Voraussetzungen des westlichen Denkens verzichte und sich vom "Anfänglichen" und "Unberechenbaren" leiten lasse. Vage, aber so reiche Formulierungen, findet Assheuer.
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)