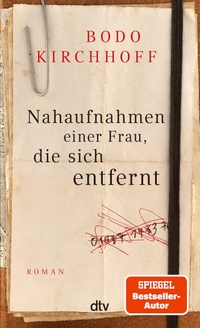Maluma und Takete
Bis das Bild quasi neu erscheint
Die Kunstkolumne. Von Ulf Erdmann Ziegler
17.12.2014. Verborgene Sammlungen, öffentliche Kunstfälscher, heldenhafte Rettungen: Setzt man sich das Ziel, dass erst alles geklärt werden muss, bevor wieder ein Bild mit gutem Gewissen zu betrachten sein wird, zeigt sich die eifernde Kunstpolitik unserer Zeit als ikonoklastisch.
Unter der Aufsicht von Capt. James Rorimer tragen amerikanische GIs Gemälde aus Schloss Schwanstein, wo etwa 21.000, französischen Sammlern gestohlene Gemälde entdeckt wurden. Bild: National Archives and Records Administration
Seit einem Jahr unterhält das deutsche Feuilleton sein Publikum mit dem Kunstbesitz eines Münchner Kauzes namens Gurlitt, der sich seiner gänzlich ungewollten Prominenz vor Kurzem durch den Tod entzogen hat. An diesem "Fall" hängt offenbar das moralische Schicksal der ganzen Nation. Alle Redakteure, die etwas von Gemälden und Zeichnungen verstehen, sind seitdem beschäftigt mit den Fragen von Erbschaft und Restitution.
Im gleichen Zeitraum erschienen zwei dicke Bücher, aber nicht in einem Spinnerverlag, sondern bei Rowohlt: das eine die gemeinsame Autobiografie von Wolfgang und Helene Beltracchi, das andere deren Briefwechsel innerhalb eines Kölner Gefängnisses, mit einem Blurb von Martin Walser, der darin "die Geburt der Literatur aus dem Geist der Einsamkeit" erblickt. Die Beltracchis waren oder sind Kunstfälscher- und hehler von Beruf.
Nun ist das Horten von Originalen und das Handeln mit Fälschungen nicht dasselbe, aber beides ruft Spezialisten auf den Plan, Personalunion nicht ausgeschlossen, also jemand kommentiert abwechselnd Skandale um Fälschungen und den Stand der Debatte um die Notwendigkeit (oder Unmöglichkeit) von Restitution. Ein drittes Feld ist vor kurzem dazugekommen, nämlich der Verkauf von Kunstschätzen durch dahinsiechende Unternehmen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, allen voran dessen Spielbank, die zwei bestens verkäufliche Warhols zu Christie"s getragen hat, anstatt sie bei einem Landesmuseum abzugeben.
Die Rede ist hier von Kunstdebatten, die die Neugier beflügeln, durchaus - die Frage ist nur: auf was? Natürlich ist es verlockend sich vorzustellen, dass die interessantesten Bilder jene seien, die in einem vor sich hin rottenden Haus in Salzburg ohne Alarmanlage in quietschenden Schubladen seit Jahrzehnten ungesehen gehortet werden. Es macht auch ein gewisses Vergnügen, wenn ein Experte für das 20. Jahrhundert, allenthalben hofiert, am Ende seiner illustren Karriere dasteht als ein fahrlässiger und willfähriger Kunst-Opa, der für einen Tausender pro Stück falschen Kunstwerken Echtheit attestierte. Amüsant auch die Vorstellung, dass gänzlich kunstferne Betriebe wie Spielbanken sich mit dem Verkauf von Sammlungen sanieren könnten, die sie quasi aus Versehen erworben hätten.
Man kommt sich vor wie in einem Tom-Wolfe-Roman. Es wird gelogen und betrogen, geschenkt und angekauft, verhökert und vererbt, gefälscht und enttarnt. Zuletzt habe ich gelesen, der olle Bentley des Düsseldorfer Kunstberaters Helge Achenbach habe verkauft werden müssen - kenn" ich, bin ich selbst drin mitgefahren! -, weil der Mann doch im Gefängnis sitzt wegen Betrugs und so weiter. Dieser Fall wird zeigen, dass Reichen schöne falsche Bilder unterzujubeln als halbwegs verzeihlich gilt, während echte Bilder mit überhöhten Rechnungen zu versehen, eine nicht unerhebliche Strafe nach sich zieht. Von wegen die Beltracchis: Helene ist schon wieder frei, und Wolfgang darf als "Freigänger" in seine eigene Fernsehsendung bei 3sat - das betrachtet die Gefängnisleitung als Teil seiner Arbeit.
Aber Spaß beiseite, denn das Fälschen und Betrügen ist ja wohl die eine Sache, und die Ansprüche jener Erben, deren (Ur)Großeltern von den Nazis enteignet und vertrieben, aber auch getötet wurden, etwas ganz anderes. Die einen beklagen noch, das Konglomerat der Gurlittbilder würde viel zu langsam gesichtet und beschrieben, da kommt die ehrenwerte Jutta Limbach und behauptet, das Problem sei noch umfassender: Sie möchte die Uhr auf Anfang 1933 zurückdrehen, so dass alle Bilder der französischen und der deutschen Moderne wieder dort hingelangten, wo sie ursprünglich gewesen waren. Die Antwort Hermann Parzingers, Chef der SMPK, nicht weniger ehrenwert, besagt, dass man bitte nicht vergessen solle, mit welchem Aufwand bestimmte deutsche Museen in den fünfziger Jahren versucht hätten, ihre Nazi-"Sammlungslücken wieder zu schließen", und es sei völlig undenkbar, zum Beispiel aus Hamburger Museen Bilder abzuziehen und sie demnächst in Berlin auszustellen, weil sie dort ursprünglich mal gehangen hätten.
Anders gesagt: Was Limbach erfunden hat, ist eine Kunstrücktauschaktion, die den gesamten Museumsbetrieb, aber auch die Sammler, deren Anwälte und ganz gewiss die nun bereits spezialisierten Feuilletonisten die nächsten zehn Jahre in Atem halten würde. Ob nun praktikabel oder nicht, dahinter steckt die Vorstellung, dass es einen Urzustand von Kunstbesitz gäbe, eine Art Matrix hinter dem Bild, die immer mitläuft, und die, Stück für Stück, auf Weiß gestellt werden könnte, bis das Bild quasi neu erscheint - wie vom gutherzigen Künstler dem wohlmeinenden Sammler soeben mit noch frischer Signatur übereignet. Limbachs Idee impliziert eine Sauberkeit des Schauens. Irgendwie in der Welt, auf undurchschaubaren Kanälen an den Adressaten gekommen, sind Bilder düster und dreckig; wenn man sie aber von ihrer Geschichte befreite, indem man diese zurückdrehte, wären sie strahlend und rein.
Als hätte George Clooney es geahnt, hat er im Laufe eben dieses Jahres, das von Gurlitt dominiert wurde, seinen Film über eine kunsthistorische Abteilung der US-Armee abgeliefert. Mit Beginn der Landung in Europa sollten "The Monuments Men" versuchen, den Nazi-Kunstraub aufzuhalten. Gleich am Anfang des Films wird, ganz militärisch, die Frage gestellt, ob man für abendländische Pinseleien amerikanische Leben opfern dürfe - am Ende holen glückliche Kunstsoldaten wertvolle Bilder aus einem verkohlten bayerischen Bergwerksstollen. Nur für Bruchteile von Sekunden sieht man die berühmten Werke, im Gegenschnitt mit den glücklichen Portraits ihrer Retter. Man weiß jetzt, dass dies Meisterwerke sind, für die zu sterben lohnt; nur warum, das weiß man nicht.
Denn um das zu wissen, müsste man die Bilder betrachten - gar nicht abwegig, dass der Film so geendet hätte: Ein Essen der Amerikaner bei Kerzenschein im Stollen, um sich herum die wertvollen europäische Bilder, und nun würden sie angeschaut, beschrieben und beschworen. Aber genau das findet nicht statt.
Die älteste soziale Form, Kunst von Menschen fernzuhalten, ist der Ikonoklasmus. Bilderstürmer haben immer gute Gründe gehabt, Menschen von Bildern fernzuhalten: Weil sie die Fleischeslust wecken oder nicht den Fortschritt preisen oder die Symbole einer überwundenen Religion konservieren. Aber auch die Aufladung des gesamten Ausstellungsbetriebs mit unlösbaren moralischen Fragen knüpft an ans Bilderverbot - eine demokratisch aufgeladene Variante, deren äußerste Vision meint, dass man besser das Museum räume und vor leeren Wänden stünde, als Bilder zu betrachten, die den Betrachter kompromittieren könnten. Wir sind in eine Situation geraten, in der die Diskurse drumherum alles andere überwuchern, der Geldstrom von der einen Seite und die politisch korrekte Pose, nicht weniger machtvoll, von der anderen. Wofür lohnt sich sterben? Es mangelt wirklich nicht an Bildern; nur das Betrachten ist irgendwie aus der Mode gekommen.
Ulf Erdmann Ziegler
"Maluma" und "Takete" sind Begriffe aus der Gestaltpsychologie. Geprägt hat sie der Psychologe Wolfgang Köhler in der Weimarer Zeit.
Kommentieren