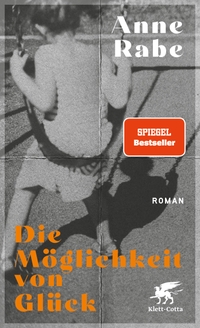Die Möglichkeit von Glück
Roman
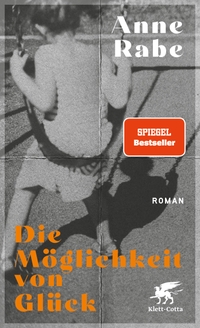
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2023
ISBN
9783608984637
Gebunden, 384 Seiten, 24,00
EUR
Klappentext
Alena Schröder In der DDR geboren, im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Als die Mauer fällt, ist Stine gerade einmal drei Jahre alt. Doch die Familie ist tief verstrickt. In ein System, von dem sie nicht lassen kann, und in den Glauben, das richtige Leben gelebt zu haben. Anne Rabe erzählt in ihrem Roman von einer Generation, deren Herkunft eine Leerstelle ist.
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (
Info)
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 19.10.2023
Die Lektüre von Anne Rabes Debütroman möchte Rezensent Ronald Düker uns "dringend ans Herz legen": Literarisch überzeugt ihn die Geschichte der Protagonistin Stine, 1986 geboren und der Autorin nicht unähnlich, ebenso wie durch ihren aktuellen Bezug. Der "Ost-West-Graben" spielt für den Kritiker bei diesem Buch ebenso eine Rolle wie die Kontinuitäten von Gewalt, die Stine erfährt, wenn sie auf sich und ihre Familie in der Nazizeit, in der DDR oder während der "Baseballschlägerjahre" blickt. Für Düker eine anregende Verbindung von Familiengeschichte mit gesellschaftlichen Fragestellungen, die sie auch formal anregend dargestellt findet: von der Erzählung zur Dokumentation zur sachbuchartigen Schilderung und wieder zurück.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 14.10.2023
Anne Rabes Roman steht auf der Shortlist des diesjährigen Buchpreises, Charlotte Gneuß' Roman löste eine Debatte aus, nachdem der Schriftsteller Ingo Schulze der Autorin historische Fehler vorwarf. Dirk Knipphals liest beide Roman im Vergleich - und mit Gewinn. Vorweg erinnert er Gneuß' Kritiker nochmal daran, dass es sich durchaus um Literatur handelt. Beide Romane arbeiten an dem, was Gneuß in einem FAZ-Gespräch als "ein 1968 für unsere Ostgeschichte" bezeichnet hat, hält er fest. Und beide Romane leisten Wichtiges, meint Knipphals: Sie konzentrieren sich auf das Private, das, was in den Familien vor und kurz nach der Wende los war. Beide Heldinnen werden von ihren Familien vernachlässigt, bei Gneuß ist es ausgerechnet ein Stasi-Mann, der sich Protagonistin Karin annimmt. Rabe greift vor allem die Gewalt in den Familien auf, die ihre Heldin zum Kontaktabbruch bewegt, resümiert Knipphals. Dass die Familien keineswegs Schutzräume waren, die "emotionale Vernachlässigung" gar staatlich unterstützt wurde, machen dem Kritiker die beiden Romane analytisch und überzeugend klar. Auszusetzen hat er an den Büchern nichts.
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 11.10.2023
Rezensentin Judith von Sternburg hat wenig Zweifel daran, dass es Anne Rabes Roman zurecht auf die Shortlist des Buchpreises geschafft hat. Denn wenn Rabe in Romanform, aber mit unverkennbar autobiografischem Hintergrund, vom Aufwachsen in einem gewalttätigen Umfeld im ostdeutschen Mecklenburg kurz vor und nach der Wende erzählt, hebt die Kritikerin zunächst einmal hervor, dass es sich keineswegs um "Betroffenheitsprosa" handelt. Dafür schreibt Rabe viel zu sachlich, exakt und rasant - selbst wenn die Autorin die Prügelstrafen, Qualen in der heißen Badewanne oder andere Demütigungen durch die Mutter der Heldin schildert, staunt die Kritikerin. Mehr noch: Wie Rabe es gelingt, die persönliche Familiengeschichte mit der Geschichte der untergegangenen DDR zu verknüpfen, in dem sie etwa von "Jugendwerkhöfen" erzählt, ringt Sternburg größte Anerkennung ab. Und das wichtigste: Rabe urteilt nicht, sondern lässt "Luft zum Atmen", schließt die Kritikerin.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 23.09.2023
Die (post)pubertäre Langeweile der DDR-Jugendlichen unter autoritär-verbietenden Vätern kennt Rezensentin Simone Schmollack aus eigener Erfahrung, ebenso die Mütter, die sich nicht trauen, sich einzumischen: In Anne Rabes Roman sind die Rollen vertauscht. Das Alter Ego der Autorin, Erzählerin Stine, erfährt wenige Jahre nach dem Mauerfall vor allem Gewalt von ihrer Mutter, die sie und den Bruder am laufenden Band verprügelt und misshandelt, der Vater verbringt seine Zeit damit, der DDR hinterherzutrauern. Viele der geschilderten Erfahrungen hat die Autorin selbst machen müssen, weiß Schmollack, die den Roman auch als Bewältigung von Familien- und Zeitgeschichte liest. Das große Interesse am Buch erklärt sie sich nicht nur mit der Nominierung für den deutschen Buchpreis, sondern auch mit einem fortwährenden Interesse an der Frage, "was mit dem Osten eigentlich los ist."
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.06.2023
Rezensent Andreas Platthaus schätzt diesen Roman von Anne Rabe als Gegenpol zur DDR-Nostalgie, die den gegenwärtigen literarischen Diskurs prägt. Ihre Geschichte beginnt mit Paul Bahrlow, der, erschüttert von den Schrecken der NS-Zeit, all seine Hoffnungen in die neu gegründete DDR setzt, so der Rezensent. Seine erlebten Traumata wirken in der Familie nach, Tochter Monika wird später zu einer tyrannischen Mutter werden, deren Kind Stine erst unter ihr leidet, dann gegen sie aufbegehrt, erläutert Platthaus. Diese Einzelschicksale stehen stellvertretend für eine traumatisierte Generation, die im Totalitarismus aufwuchs, erkennt der Kritiker. So bietet Rabes Roman eine Erklärung für die "Gewaltgeschichte" Ostdeutschlands, die sich von der des Westens unterscheidet. Das ist so "formal berückend" wie soziologisch interessant, schließt Platthaus.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Rezensionsnotiz zu
Deutschlandfunk, 12.05.2023
Rezensentin Katharina Teutsch bewundert Anne Rabes Debütroman über eine Ich-Erzählerin, die auf eine Kindheit in der sich auflösenden DDR zurückblickt. Wie die Dramatikerin Rabe hier DDR- und Nachwendegeschichte aufarbeitet, findet sie nicht zuletzt deshalb überzeugend, weil sich die Autorin mit Kontinuitäten faschistischer Gewalterfahrung befasst. Berührend findet Teutsch die episodischen Rückblicke der Erzählerin auf die lieblose Kindheit und Jugend zwischen Jugendwerkhof und Familie auch, weil sie den verkürzten westdeutschen Blick auf die Verhältnisse erkennen lassen. Eine gelungene Verbindung von Essay, Archivrecherche und Autofiktion, meint Teutsch.
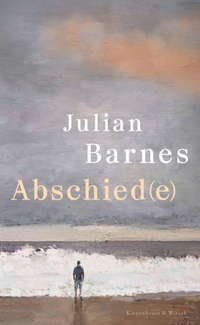 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)