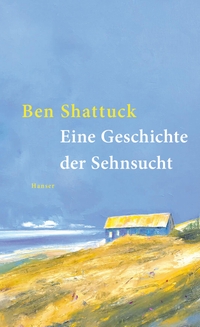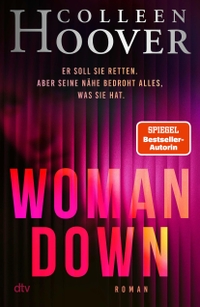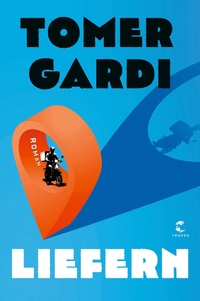Efeu - Die Kulturrundschau
Die Angst der Angstmacher
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
27.05.2024. Die Goldene Palme ging dieses Jahr an Sean Bakers sozialrealistische "Pretty Woman"-Variante "Anora". Die Zeit ärgert sich: der gerade aus dem Iran geflohene Regisseur Mohammad Rasoulof hätte sie eher verdient. Die Welt kann mit den Jury-Entscheidungen hingegen ganz gut leben. War doch nicht alles schlecht? In der Berliner Zeitung übt Literaturprofessor Stefan Müller scharfe Kritik an Anne Rabes DDR-Roman "Die Möglichkeit von Glück". Die taz muss nach einer Ausstellung von Yael Bartana in Bremen erstmal durchatmen. Die nachtkritik verfällt bei Anita Vulesicas Inszenierung von Georges Perecs "Die Gehaltserhöhung" dem Wahnsinn der modernen Arbeitswelt.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
27.05.2024
finden Sie hier
Film

Am Ende hat die Jury in Cannes unter dem Vorsitz von Greta Gerwig doch nicht Mohammad Rasoulofs als Favorit gehandelten Film "The Seed of the Sacred Fig" (hier von Anke Leweke auf Zeit Online besprochen) mit der Goldenen Palme ausgezeichnet, sondern Sean Baker für seine sozialrealistische "Pretty Woman"-Variante "Anora". Der eben unter beschwerlichen Bedingungen aus dem Iran geflohene Regisseur wurde mit einem Spezialpreis der Jury "abgespeist", ärgert sich Katja Nicodemus in der Zeit über diese Entscheidung. Dabei wäre eine Goldene Palme für Rasoulof "keine politische Entscheidung gewesen, sondern die einzig Richtige", denn "diese auch formal konsequenteste Erzählung des Wettbewerbs" hatte "gezeigt, wozu das Kino imstande ist: Widerstand in Bilder zu verwandeln, die Angst der Angstmacher vorzuführen." Marie-Luise Goldmann kann in der Welt mit den Entscheidungen der Jury soweit gut leben: "Mit einem Transmusical, einer Sexarbeiterkomödie, feministischem Body-Horror, einem iranischen Widerstandsdrama und einer indischen Hymne an die Schwesterlichkeit zeichnet die Jury am Samstagabend nach zwei Wochen Filmmarathon an der Croisette nun zwar die politischsten, aber auch die mit Abstand überzeugendsten Filme aus." Der Palmengewinner "ist einer dieser Filme, bei denen man sich in jeder Szene neu hinterfragen muss, ob man das, was man gerade sieht, wirklich richtig einordnet - und ob nicht am Ende doch alles ganz anders ist. 'Anora' hat das geschafft, was in einem der anderen Film des Wettbewerbs, in Paolo Sorrentinos 'Parthenope', als Wissenschaft der Anthropologie definiert wird: uns sehen zu lehren."
"Mit Komödien gewinnt man keine Festivals - diese Faustregel gilt seit diesem Samstag nicht mehr", staunt Maria Wiesner in der FAZ. Und tatsächlich, schreibt Daniel Kothenschulte in der FR: Die Goldene Palme ging an den "bei weitem unterhaltsamste Film des Wettbewerbs". Der Film "ist von jener Sorte Perfektion, die man gerne unterschätzt, gerade weil alles wie am Schnürchen klappt. ... Wie Baker gleichzeitig Rollenklischees bedient und diese subtil infrage stellt, soziale Realitäten stets im Blick, braucht den Vergleich nicht zu scheuen mit amerikanischen Klassikern von John Cassavetes. ... Wenn das Festival von Cannes in diesem Jahr eine Botschaft senden wollte, dann hieß sie: Großes Kino entsteht unabhängig von politischen Krisen und lebt vom Miteinander seiner Extreme." Mit dieser Auszeichnung "erfährt das Filmschaffen von Sean Baker, der seit zwei Jahrzehnten sehr genaue Filme über Abhängigkeits- und Machtverhältnisse innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft dreht, eine Anerkennung, die zumindest 'Anora' aus der Arthouse-Nische befreien könnte", freut sich Josef Lederle im Filmdienst. Jenni Zylka (taz) und Bert Rebhandl (Standard) führen durch die Filmografie von Baker, dem Rebhandl ein "Faible für Außenseiter" bescheinigt: "Man könnte Baker durchaus als einen Sozialrealisten bezeichnen, allerdings schickt er seinen Realismus gern auf wilde Ritte."
Und das allgemeine Fazit? Der Cannes-Wettbewerb war in diesem Jahr "ungewöhnlich offen", findet Patrick Staumann in der NZZ: Große Namen konkurrierten hier mit Newcomern. Tazler Tim Caspar Boehme beobachtet hingegen eine "Auswahl von besonders schwankender Qualität". Jan Küveler (Welt) fiel im Programm "von Anfang an eine Dominanz weiblicher Hauptfiguren in ihrem Ringen um einen fairen Platz in der Welt" auf. Auch Josef Lederle (Filmdienst) sieht in diesem Festivaljahrgang "die Perspektive von Frauen ins Zentrum" gerückt: "Gegen so viel Vitalität, Feinsinn und politischen Weitblick kamen die Werke alter Meister nicht an." Weitere Cannes-Resümees schreiben Valerie Dirk (Standard), Andrey Arnold (Presse) und David Steinitz (SZ).
Außerdem: Für die Zeit hat sich die Tennisspielerin Andrea Petkovic Luca Guadagninos Tennisfilm "Challengers" näher angesehen. Peter von Becker schreibt im Tagesspiegel zum Tod des Filmemachers und Schriftstellers Thomas Voswinckel. Besprochen werden Anja Salomonowitz' Biopic "Mit einem Tiger schlafen" über die Künstlerin Maria Lassnig (Jungle World), die deutsche, auf Netflix gezeigte Mystery-Serie "Pauline" (BLZ) und die Serie "Feud" (vom TA für die SZ online nachgereicht).
Musik
Daniel Kothenschulte schreibt in der FR einen Nachruf auf den Filmmusik-Komponisten Richard Sherman, der die unvergesslichen Melodien zahlreicher Disney-Zeichentrickklassiker geschaffen hat. Wir erinnern uns:
Besprochen werden neue Bücher über Anton Bruckner (Standard) und ein Beethoven-Konzert der Wiener Philharmoniker mit Adam Fischer (Standard),
Besprochen werden neue Bücher über Anton Bruckner (Standard) und ein Beethoven-Konzert der Wiener Philharmoniker mit Adam Fischer (Standard),
Literatur
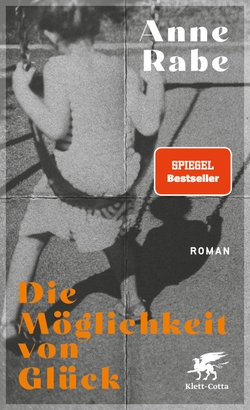

Der Schriftsteller Franzobel ärgert sich im Standard-Essay über die Diskurskultur der Gegenwart, die dazu führe, dass sich Kulturschaffende reihenweise ins Privatleben zurückziehen: "Die sozialen Medien haben bewirkt, dass nicht mehr nur eine Meinung abgelehnt wird, sondern gleich die ganze sie verkündende Person samt ihrem Werk - Sippenhaftung 2.0. Politische Korrektheit und mögliche Shitstorms, gecancelte Auftritte und Rauswürfe bewirken eine Selbstzensur, die jedes öffentlich diskutierte assoziative Herantasten an ein Thema blockiert. Aber genau das machen Literatur und Kunst. Kein rechthaberisches Verkünden von Wahrheiten, sondern versuchsweises Verstehen, indem die komplexe Welt auf das Private heruntergebrochen wird. ... Was kann die Kunst dagegen ausrichten? Wenig bis nichts? Sie kann zumindest die Schönheit des Lebens feiern, der materiellen Welt eine sinnliche gegenüberstellen und dem Denken in Legislaturperioden große Zukunftsvisionen."
Weitere Artikel: Patrick Bahners (FAZ), Gerrit Bartels (Tsp) und Paul Jandl (NZZ) schreiben Nachrufe auf den Schriftsteller Walter Kappacher, der 2009 den Büchnerpreis gewonnen hat. Der Schriftsteller Viktor Jerofejew erinnert sich in der NZZ an eine Begegnung mit dem sowjetischen Außenminister Molotow. Der Schriftsteller Michail Schischkin beklagt einen zu sehr auf Russland verengten Blick auf Literatur russischer Sprache, schreibt Stephanie Caminada in der NZZ. Der Schriftsteller Moritz Rinke denkt in der FAZ über Kafka nach. Die Schriftstellerin Sabine Scholl erinnert im Standard an die Geschichte des Literaturmuseums in Altaussee. Der Schrifsteller Renatus Deckert erzählt im Standard von seiner Familiengeschichte. Ronald Pohl resümiert im Standard die erste Karl-Kraus-Lecture der Wiener Festwochen.
Besprochen werden unter anderem Jenny Erpenbecks Roman "Kairos", der eben den Booker-Preis gewonnen hat (BLZ), Jhumpa Lahiris "Das Wiedersehen" (online nachgereicht von der FAS), Theresia Enzensbergers Essay "Schlafen" (SZ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter Tobias Elsäßers "Mute - Wer bist du ohne Erinnerung?" (FAZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.
In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Olga Martynova über Abraham Sutzkevers "Die Fiedelrose":
"Aus Tote erweckendem, wärmendem Regen
beginnt sie allmählich, zu blühen und sich zu bewegen ..."
Bühne

"Gott ist ein DJ, und er heißt Fräulein Jolande" - so könnte für nachtkritikerin Sophie Diesselhorst das Motto von Anita Vulesicas Inszenierung von Georges Perecs absurder Komödie "Die Gehaltserhöhung" lauten, die sie am Deutschen Theater Berlin gesehen hat. Es geht um den Wahnsinn in einer entfremdeten Arbeitswelt, den ein Angestellter zu spüren bekommt, als er versucht bei seinem Chef um die titelgebende Erhöhung seines Lohns zu bitten - immer und immer wieder vergeblich. Zwar findet die Kritikerin den Abend ein bisschen "harmlos" geraten, sie freut sich allerdings trotzdem sehr über die Performance des Theatermusikers Ingo Günther, der als Sekretärin Fräulein Jolande brilliert: Die "stellt sicher, dass es immer weitergeht und niemand aussteigt und hebt sogar einmal gezielt die Moral, wenn sie hinter ihrem Tisch hervorkommt, (per Playback) ein bisschen mit hoher Frauenstimme scattet und dazu dezent tänzelt. ... Hinter dem Empfangstresen, um den zu den Szenen-Umbrüchen eine zylindrische Wand niedergeht, als säße Frau Jolande in einer Zentrifuge, steht eine Wand aus orangenem Plexiglas. Aus zwei Türen an den beiden Seiten quellen die sechs Schauspieler heraus, die zusammen den Angestellten spielen." Tagesspiegel-Kritiker Patrick Wildermann attestiert Vulesica "ein tolles Gespür für den Wahnwitz und die niederschmetternde Komik der Vorlage."
Weitere Artikel: Für die taz unterhält sich Astrid Kaminski mit den KuratorInnen des "Tanzpol-Festivals", das Kunstschaffenden mit Repressions- und Migrationserfahrungen eine Bühne bietet. Tagesspiegel-Kritiker Rüdiger Schaper hat Samuel Finzis Auftritt in "Der Kaufmann von Venedig" am Nationaltheater Sofia besucht. Die Berliner Zeitung meldet mit dpa, dass Sivan Ben Yishai den Mülheimer Dramatikpreis gewonnen hat.
Besprochen werden Dominique Schnizers Inszenierung von Nis-Momme Stockmanns Komödie "Singularis. Von unserem unbedingten Streben nach Einsamkeit" am Deutschen Theater Göttingen (nachtkritik), die konzertante Aufführung von Peter Cornelius' Oper "Gunlöd" am Staatstheater Mainz unter musikalischer Leitung von Hermann Bäumer (FR), Mattia Russos und Antonio de Rosas Tanzstück "Kafka" am Staatstheater Wiesbaden (FR), Charlie Hübners Solo "Late Night Hamlet" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg (SZ), Philipp Westerbarkeis Inszenierung des Musiktheaterstück "Michael Kohlhaas" nach Heinrich von Kleist am Theater Regensburg (nmz), David Böschs Inszenierung von Simon Stephens' Stück "Maria" am Staatstheater Nürnberg (SZ) und Jan Bosses Inszenierung von Choderlos de Laclos' Briefroman "Gefährliche Liebschaften" am St. Pauli Theater in Hamburg (taz).
Kunst

Nach dem Besuch von Yael Bartanas Ausstellung "Utopia Now" im Weserburg Museum Bremen muss taz-Kritiker Benno Schirrmeister erstmal durchatmen, denn die Videoinstallationen der Künstlerin sind nichts für schwache Nerven. Besonders eindrücklich ist für ihn die Musikvideoinstallation "Mir Zaynen Do!", für die Bartana einen von jüdischen Immigranten aus Europa in São Paolo gegründeten Chor mit einem dort ansässigen Straßenmusikensemble zusammengebracht hat. Dessen Mitglieder sind Nachfahren der Maroons, erklärt Schirrmeister, die der Versklavung durch die Kolonialmächte durch aktiven Widerstand entkamen: "Vorsichtig wird, Schritt für Schritt, die Begegnung von Überlebenden der Schoah und der Kolonialverbrechen im Bild der mehr und mehr sich füllenden Bühne des Teatro de Arte Israelita Brasileiro in Szene gesetzt. Tastend, neugierig und ohne Preisgabe des je Eigenen, ein optisches und akustisches Crescendo über elfeinhalb Minuten, entsteht Gemeinschaft. Den Anfang dieser Erzählung im dunklen Raum markiert aber der einsame Auftritt der Chorleiterin Hugueta Sendacz. Die 97-Jährige, in Polen geboren, steht da, drahtig, ganz allein am Dirigierpult, und gibt nachsichtig lächelnd mit außerordentlich bestimmten Gesten Einsätze. Erst später wird klar werden: Sie dirigiert keinen Geisterchor. Die Melodien erklingen."
Außerdem: SZ und Tagesspiegel melden, dass der Komponist Manos Tsangaris zum neuen Präsidenten der Akademie der Künste gewählt wurde. Im FAZ-Gespräch mit Ursula Scheer erklärt die Chefin des Aktionshauses Grisebach Diandra Donecker, was es bedeutet, dass das "Karlsruher Skizzenbuch" von Caspar David Friedrich unter "Kulturgutschutz" gestellt wurde. Besprochen werden die Ausstellung "Ewa Partum. My touch is a touch of a woman" im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg (FAZ), die Ausstellung "Orhan Pamuk - Der Trost der Dinge" im Lenbachhaus in München (tsp), die Ausstellung "Dance with Daemons" in der Fondation Beyeler bei Basel (NZZ) und die Ausstellung "Läuft" zum Thema Menstruation im Museum Europäischer Kulturen in Berlin (taz).
Kommentieren