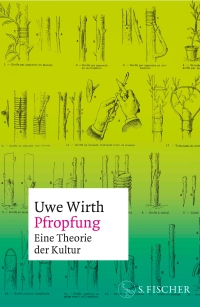Intervention
Künstlerkäfighaltung
Von Christian Kortmann
04.04.2025. Mit sogenannten Literaturstipendien, die meist äußerst karg dotiert sind, wollen sich Provinznester ins Gespräch bringen. Von den kargen Lebensbedingungen abgesehen, wird von den Empfängern solcher Aufenthaltsstipendien allerhand gefordert, oder wie es im Euphemismus der Unmenschen heißt: "erwartet". Nämlich öffentliche Lesungen und das Verfassen von lokalpatriotischen Beiträgen, was von der künstlerischen Arbeit abhält und die Lösung zum Problem macht. Protest eines Schriftstellers.Wie viele Schriftsteller träume auch ich vom Arno-Schmidt-Moment, in dem Jan Philipp Reemtsma an meine Haustür klopft und mich mit großer Gönnergeste vom weltlichen Frondienst befreit. Doch sollte dieser Traum eines Tages wahr werden, dann, so zeigt ein Streifzug durch die deutsche Stipendienlandschaft, wird wohl kein Grandseigneur mit tiefem Verständnis für künstlerische Bedürfnisse auf der Matte stehen, sondern die budgetsensible Kulturbürokratie mit kleinkarierten Eigeninteressen.
Die Idee, Konzept und Arbeitsproben einzureichen und bei Gefallen für einen Monat oder ein Jahr gefördert zu werden, klingt verlockend. Und tatsächlich gibt es großartige Fördermöglichkeiten, wie sie der Deutsche Literaturfonds und die Bundesländer anbieten. Mit den monatlichen 3.000 Euro, steuerfrei da aus öffentlicher Hand, die der Literaturfonds für maximal zwölf Monate vergibt, lässt sich auch in München oder Hamburg materiell temporär sorgenbefreit ein Roman schreiben - und mehr traut sich ein Künstler nicht zu wünschen.
Das sind die Limousinen des Literaturbetriebs, die dich komfortabel von Seite 1 bis 400 bringen. Wer hier nicht einsteigen darf, muss, um aus Solidarität zur schwächelnden Industrie im automobilen Bild zu bleiben, mit einem ziemlich klapprigen und verbeulten Fuhrpark Vorlieb nehmen. Solche Stipendien sind meist mit einem Aufenthalt im Ländlichen und sonstigen Gegenleistungen des Stipendiaten verbunden und in einer nicht nur finanziell bizarren Parallelwelt angesiedelt. Sie heißen hochtrabend - nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen - "Residenzstipendien der Atelier-Stiftung Kunst und Natur" und sind in diesem Fall mit 750 Euro für vier Wochen (also 26,79 Euro pro Tag) honoriert (Vergaberichtlinien). Das läuft unter "Taschengeld", wovon ich sonst lebe, interessiert offenbar nicht. Es besteht "Residenzpflicht", mich frei bewegen darf ich also nicht, wovon auch große Sprünge machen? Besuch ist nur am Wochenende erlaubt und muss angemeldet werden.
Wenn ich jünger wäre oder bessere Nerven hätte, würde ich mich sofort bewerben, um dann eine Provinzposse zu schreiben, irgendwo zwischen Flauberts "Bouvard und Pécuchet", "Withnail & I" und frühem Detlev Buck. Wenn es launig wird, könnte ich den Stoff als "Endlich Freitag"-Movie an die Degeto verkaufen und auf diesem Weg den großen Reibach machen. Aber zum Lachen ist das würdelose Künstler- und Menschenbild, das in solchen Rahmenbedingungen deutlich wird, eigentlich zu traurig. Trotzdem male ich mir die Szene aus, in der meine Freundin es wagt, mich unangemeldet am Mittwoch zu besuchen, und dann "Frau Dr. K." an die Tür meines Einzelzimmers (mit Gemeinschaftsbadbenutzung) klopft und uns zur Räson ruft: Damenbesuch unter der Woche, das kann nur Taschengeldentzug oder einen Extra-Putzdienst bedeuten! Ich war auf keinem Internat, die "Residenz" könnte meinem Werk einen Touch of Törleß verleihen.
Und welches verkorkste Gehirn denkt sich einen Begriff wie "Residenzpflicht" aus, den man eher in autoritären Staaten vermuten würde? Im deutschen Arbeitsrecht ist er verboten, bis auf wenige Ausnahmen, etwa bei Hausmeistern. Liebe Möchtegern-Mäzene, wollt ihr Kulturförderung betreiben oder Künstlerkäfighaltung? Entweder es ist bei euch so angenehm, dass eure Gäste freiwillig bleiben, oder ihr habt das wesentlich größere Problem als die Künstler, die gerade knapp bei Kasse sind.
Überhaupt scheint vielen Stipendien ein Denkfehler zugrunde zu liegen, oder Literaturmenschen haben in Mathe nicht aufgepasst. Denn der Aufenthalt an einem anderen Ort bedeutet keinesfalls, dass Miete und laufende Kosten zuhause nicht bezahlt werden müssten. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 2.220 Euro im Monat. Wer sich das neben freiem Logis nicht leisten kann, sollte auch kein Stipendium vergeben, weil es sonst eine Mogelpackung ist.
Von den kargen Lebensbedingungen abgesehen, wird von den Empfängern solcher Aufenthaltsstipendien allerhand gefordert, oder wie es im Euphemismus der Unmenschen heißt: "erwartet". Nämlich öffentliche Lesungen und das Verfassen von lokalpatriotischen Beiträgen, was von der künstlerischen Arbeit abhält und die Lösung zum Problem macht. So werden dem Stadtschreiber in Allstedt sage und schreibe vier Lesungen abverlangt, mit dem lakonischen Zusatz: "Diese Lesungen sind kostenfrei zu halten". Dabei entspricht ihr Marktwert sieben Wochen des gewährten Stipendiums, wenn man das Basishonorar für eine Lesung zugrunde legt, das Literaturfonds und die Gewerkschaft Verdi übereinstimmend mit 500 Euro veranschlagen. Wenn Gegenleistungen eingefordert werden, handelt es sich um kein Stipendium mehr, sondern um einen schlecht bezahlten Job, den man McGrant nennen könnte.
Die Ausschreibungstexte sprechen großspurig davon, "konzentrierte künstlerische Arbeit" zu ermöglichen, "Freiräume zu schaffen", "die künstlerische Entwicklung entscheidend anzuregen" oder eine "nachhaltige Basis für das zukünftige Schaffen zu bilden". Doch ich frage mich, ob es den nur halbherzig altruistischen Förderern tatsächlich um Wohl und Werk der Künstler geht oder ob nicht die eigene kulturpolitische Profilneurose und existenzielle Leere vom Mantel des Schönen, Guten, Wahren umweht werden soll. So heißt es einmal verräterisch: "Das Industriedorf Kleintettau (Oberfranken) will sich auf die literarische Landkarte Deutschlands setzen."
Auf öffentliche Sichtbarkeit ihrer Neuanschaffung sind manche Auslober ganz versessen. In Pfaffenhofen an der Ilm wird der Stipendiat im "Flaschlturm, einem kleinen Barockgebäude in der Altstadt", untergebracht, wo er dann bestaunt werden kann. Darüber hinaus wird er "angehalten, sich aktiv am Pfaffenhofener Kulturleben zu beteiligen" - was immer das heißen mag. Er soll wohl als Schmuckeremit, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert gegen Bezahlung in englischen Parks hausten, durch nachdenkliche Posen und brillante Konversation Einheimische und Besucher erfreuen.
Tatsächlich fügen sich viele schreibende Kolleginnen und Kollegen derartigen Bedingungen. Doch man wird das ungute Gefühl nicht los, dass hier ökonomische Zwangslagen sittenwidrig ausgenutzt werden. Und für Künstler mit Partnern, Kindern oder anderen sozialen Verpflichtungen stellen sich noch größere Herausforderungen. Dass es um eine poetische Existenz pekuniär nicht immer rosig bestellt sein mag, davon weiß auch der Autor dieser Zeilen manches Lied zu singen. Das heißt aber nicht, dass wir Almosen annehmen sollten, von denen vor allem die Geberseite profitiert. Es gibt eine Art von vermeintlicher Förderung, die dem eigenen Werk kaum nutzt und der persönlichen Würde schadet.
Seitens der Geber scheinen weniger die verfügbaren Mittel das Problem zu sein als vielmehr das tradierte Bild vom Schriftsteller als Spitzwegschem Hungerkünstler, der für jedes Brosämchen dankbar ist: Auch einer wohlhabenden Stadt wie Baden-Baden ist ihr schreibendes Schmuckstück nur 1.100 Euro pro Monat wert. In einem Kompendium "Mäzenatentum für Dummies" würde das erste Kapitel heißen: "Großzügigkeit, materiell und ideell". So schwer kann es doch nicht sein, das Portemonnaie richtig aufzumachen. Und dann: keine kleinlichen, egoistischen "Erwartungen" formulieren, sondern die Dichter ganz einfach ihr Ding machen lassen. Vielleicht bringen sie euer Dorf ja am Freitagabend im Ersten groß raus.
Christian Kortmann
Die Idee, Konzept und Arbeitsproben einzureichen und bei Gefallen für einen Monat oder ein Jahr gefördert zu werden, klingt verlockend. Und tatsächlich gibt es großartige Fördermöglichkeiten, wie sie der Deutsche Literaturfonds und die Bundesländer anbieten. Mit den monatlichen 3.000 Euro, steuerfrei da aus öffentlicher Hand, die der Literaturfonds für maximal zwölf Monate vergibt, lässt sich auch in München oder Hamburg materiell temporär sorgenbefreit ein Roman schreiben - und mehr traut sich ein Künstler nicht zu wünschen.
Das sind die Limousinen des Literaturbetriebs, die dich komfortabel von Seite 1 bis 400 bringen. Wer hier nicht einsteigen darf, muss, um aus Solidarität zur schwächelnden Industrie im automobilen Bild zu bleiben, mit einem ziemlich klapprigen und verbeulten Fuhrpark Vorlieb nehmen. Solche Stipendien sind meist mit einem Aufenthalt im Ländlichen und sonstigen Gegenleistungen des Stipendiaten verbunden und in einer nicht nur finanziell bizarren Parallelwelt angesiedelt. Sie heißen hochtrabend - nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen - "Residenzstipendien der Atelier-Stiftung Kunst und Natur" und sind in diesem Fall mit 750 Euro für vier Wochen (also 26,79 Euro pro Tag) honoriert (Vergaberichtlinien). Das läuft unter "Taschengeld", wovon ich sonst lebe, interessiert offenbar nicht. Es besteht "Residenzpflicht", mich frei bewegen darf ich also nicht, wovon auch große Sprünge machen? Besuch ist nur am Wochenende erlaubt und muss angemeldet werden.
Wenn ich jünger wäre oder bessere Nerven hätte, würde ich mich sofort bewerben, um dann eine Provinzposse zu schreiben, irgendwo zwischen Flauberts "Bouvard und Pécuchet", "Withnail & I" und frühem Detlev Buck. Wenn es launig wird, könnte ich den Stoff als "Endlich Freitag"-Movie an die Degeto verkaufen und auf diesem Weg den großen Reibach machen. Aber zum Lachen ist das würdelose Künstler- und Menschenbild, das in solchen Rahmenbedingungen deutlich wird, eigentlich zu traurig. Trotzdem male ich mir die Szene aus, in der meine Freundin es wagt, mich unangemeldet am Mittwoch zu besuchen, und dann "Frau Dr. K." an die Tür meines Einzelzimmers (mit Gemeinschaftsbadbenutzung) klopft und uns zur Räson ruft: Damenbesuch unter der Woche, das kann nur Taschengeldentzug oder einen Extra-Putzdienst bedeuten! Ich war auf keinem Internat, die "Residenz" könnte meinem Werk einen Touch of Törleß verleihen.
Und welches verkorkste Gehirn denkt sich einen Begriff wie "Residenzpflicht" aus, den man eher in autoritären Staaten vermuten würde? Im deutschen Arbeitsrecht ist er verboten, bis auf wenige Ausnahmen, etwa bei Hausmeistern. Liebe Möchtegern-Mäzene, wollt ihr Kulturförderung betreiben oder Künstlerkäfighaltung? Entweder es ist bei euch so angenehm, dass eure Gäste freiwillig bleiben, oder ihr habt das wesentlich größere Problem als die Künstler, die gerade knapp bei Kasse sind.
Überhaupt scheint vielen Stipendien ein Denkfehler zugrunde zu liegen, oder Literaturmenschen haben in Mathe nicht aufgepasst. Denn der Aufenthalt an einem anderen Ort bedeutet keinesfalls, dass Miete und laufende Kosten zuhause nicht bezahlt werden müssten. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 2.220 Euro im Monat. Wer sich das neben freiem Logis nicht leisten kann, sollte auch kein Stipendium vergeben, weil es sonst eine Mogelpackung ist.
Von den kargen Lebensbedingungen abgesehen, wird von den Empfängern solcher Aufenthaltsstipendien allerhand gefordert, oder wie es im Euphemismus der Unmenschen heißt: "erwartet". Nämlich öffentliche Lesungen und das Verfassen von lokalpatriotischen Beiträgen, was von der künstlerischen Arbeit abhält und die Lösung zum Problem macht. So werden dem Stadtschreiber in Allstedt sage und schreibe vier Lesungen abverlangt, mit dem lakonischen Zusatz: "Diese Lesungen sind kostenfrei zu halten". Dabei entspricht ihr Marktwert sieben Wochen des gewährten Stipendiums, wenn man das Basishonorar für eine Lesung zugrunde legt, das Literaturfonds und die Gewerkschaft Verdi übereinstimmend mit 500 Euro veranschlagen. Wenn Gegenleistungen eingefordert werden, handelt es sich um kein Stipendium mehr, sondern um einen schlecht bezahlten Job, den man McGrant nennen könnte.
Die Ausschreibungstexte sprechen großspurig davon, "konzentrierte künstlerische Arbeit" zu ermöglichen, "Freiräume zu schaffen", "die künstlerische Entwicklung entscheidend anzuregen" oder eine "nachhaltige Basis für das zukünftige Schaffen zu bilden". Doch ich frage mich, ob es den nur halbherzig altruistischen Förderern tatsächlich um Wohl und Werk der Künstler geht oder ob nicht die eigene kulturpolitische Profilneurose und existenzielle Leere vom Mantel des Schönen, Guten, Wahren umweht werden soll. So heißt es einmal verräterisch: "Das Industriedorf Kleintettau (Oberfranken) will sich auf die literarische Landkarte Deutschlands setzen."
Auf öffentliche Sichtbarkeit ihrer Neuanschaffung sind manche Auslober ganz versessen. In Pfaffenhofen an der Ilm wird der Stipendiat im "Flaschlturm, einem kleinen Barockgebäude in der Altstadt", untergebracht, wo er dann bestaunt werden kann. Darüber hinaus wird er "angehalten, sich aktiv am Pfaffenhofener Kulturleben zu beteiligen" - was immer das heißen mag. Er soll wohl als Schmuckeremit, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert gegen Bezahlung in englischen Parks hausten, durch nachdenkliche Posen und brillante Konversation Einheimische und Besucher erfreuen.
Tatsächlich fügen sich viele schreibende Kolleginnen und Kollegen derartigen Bedingungen. Doch man wird das ungute Gefühl nicht los, dass hier ökonomische Zwangslagen sittenwidrig ausgenutzt werden. Und für Künstler mit Partnern, Kindern oder anderen sozialen Verpflichtungen stellen sich noch größere Herausforderungen. Dass es um eine poetische Existenz pekuniär nicht immer rosig bestellt sein mag, davon weiß auch der Autor dieser Zeilen manches Lied zu singen. Das heißt aber nicht, dass wir Almosen annehmen sollten, von denen vor allem die Geberseite profitiert. Es gibt eine Art von vermeintlicher Förderung, die dem eigenen Werk kaum nutzt und der persönlichen Würde schadet.
Seitens der Geber scheinen weniger die verfügbaren Mittel das Problem zu sein als vielmehr das tradierte Bild vom Schriftsteller als Spitzwegschem Hungerkünstler, der für jedes Brosämchen dankbar ist: Auch einer wohlhabenden Stadt wie Baden-Baden ist ihr schreibendes Schmuckstück nur 1.100 Euro pro Monat wert. In einem Kompendium "Mäzenatentum für Dummies" würde das erste Kapitel heißen: "Großzügigkeit, materiell und ideell". So schwer kann es doch nicht sein, das Portemonnaie richtig aufzumachen. Und dann: keine kleinlichen, egoistischen "Erwartungen" formulieren, sondern die Dichter ganz einfach ihr Ding machen lassen. Vielleicht bringen sie euer Dorf ja am Freitagabend im Ersten groß raus.
Christian Kortmann
1 Kommentar