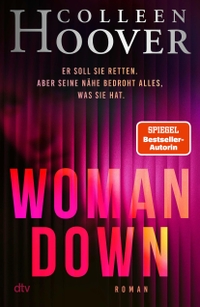Intervention
Schopenhauers Stachelschweine
Von Richard Herzinger
11.03.2021. Möglichst große Nähe zwischen den Menschen gilt heute als Synonym für "soziale Wärme" und damit als humaner Idealzustand. Doch das Gebot, sich so nahe wie möglich zu kommen, senkt auch die Hemmung, anderen zu nahe zu treten und sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Vielleicht lehrt uns die Corona-Pandemie wieder das richtige Maß.Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken und voneinander Abstand zu halten. Zunehmend wird das von den meisten Bürgern als schwere Belastung empfunden. Der Druck, die Einschränkungen zumindest teilweise aufzuheben, nimmt daher zu - was die Gefahr mit sich bringt, dass die Lockerungen zu früh kommen könnten und das Virus umso härter zurückschlägt.
Je länger aber die Lockdown-Maßnahmen anhalten, umso mehr drohen sie nicht nur bleibende wirtschaftliche, sondern auch psychosoziale Schäden zu verursachen. Und doch bietet der pandemiebedingte Ausnahmezustand den modernen westlichen Gesellschaften auch eine Chance: den Wert der Distanz zwischen den Individuen für das zivilisierte Zusammenleben neu zu entdecken und schätzen zu lernen.
In einer berühmten Parabel schrieb der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer 1851: "Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin- und hergeworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten."
Was der Philosoph hier definiert, ist jenes notwendige zivilisatorische Maß an Distanz, das eine Gesellschaft einhalten muss, damit unter den Menschen "ein Beisammensein bestehen kann". Menschen wollen und sollen sich einander zuwenden und unterstützen. Und gerade in der gegenwärtigen Krise beweisen sie, dass die Bereitschaft zu gegenseitiger Fürsorge und Rücksichtnahme nicht erloschen ist.
Doch zu große Nähe bringt laut Schopenhauer jene "widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler" zutage, die "Höflichkeit und feine Sitte" zerstören. Der Sinn für die "mittlere Entfernung", die Schopenhauer empfiehlt, ist den modernen westlichen Gesellschaften in den vergangenen Jahrzehnten jedoch weitgehend abhanden gekommen.
Möglichst große Nähe zwischen den Menschen gilt heute als Synonym für "soziale Wärme" und damit als humaner Idealzustand. Doch das Gebot, sich so nahe wie möglich zu kommen, senkt auch die Hemmung, anderen zu nahe zu treten und sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Es mindert dramatisch die Fähigkeit, "Höflichkeit und gute Sitte" als Leitwerte des zwischenmenschlichen Umgangs anzuerkennen.
Internet und soziale Medien haben diesen Prozess des Abschmelzens von sozialer Distanz erheblich beschleunigt. Das ist insofern paradox, als Kulturkritiker stets gewarnt hatten, das Netz fördere die soziale Isolation. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Durch die Vernetzung setzen sich die Nutzer digitaler Medien nicht nur dem Abgreifen ihrer Daten durch staatliche Institutionen und private Unternehmen aus, sondern auch der ständigen Beobachtung durch die öffentliche Meinung.
Digitales Mobbing, Hasstiraden, Drohungen und Beschimpfungen sind dabei nur extreme Auswüchse des Ausgeliefertseins des Einzelnen an das Urteil der anderen. Weil man von seinen "Freunden" Anerkennung und Zuspruch erhofft und keinen "Shitstorm" riskieren will, fördert die Aktivität in sozialen Medien auch Konformismus und vorauseilendes Wohlverhalten gegenüber der "Community", der man sich zugehörig fühlt. Es zeigt sich hier freilich auch ein neuartiges Zusammenspiel von Nähe und Distanz, das Schopenhauer nicht voraussehen konnte. Denn wer andere digital attackiert, bleibt ja physisch in räumlicher Entfernung von seinem Opfer und fühlt sich so vor dessen unmittelbarer Reaktionen sicher.
Die sozialen Netzwerke produzieren freilich nicht von sich aus, sondern verstärken nur eine vorherrschende Tendenz der Gegenwart: Nur wer sein Leben und sein Inneres für alle sichtbar offenlegt, gilt als vollwertiges soziales Individuum. Wer hingegen sein privates Dasein und seine Gedanken für sich behält, setzt sich dem Verdacht aus, etwas für die Gemeinschaft Bedrohliches zu verbergen. In manchen Unternehmen gilt es daher bereits als Nachteil, wenn ein Mitarbeiter oder ein Bewerber nicht in sozialen Medien aktiv ist.
Diese "Tyrannei der Intimität", wie es der Soziologe Richard Sennett bereits in den 1970er Jahren genannt hat, bestimmt längst auch die Wahrnehmung von Politik. Zwar ist es zweifellos ein Fortschritt, dass Politiker, Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens heute einer stärkeren Kontrolle durch die Öffentlichkeit unterworfen sind als in früheren Jahrzehnten. Amtsmissbrauch und Korruption, aber auch Vergehen wie sexuelle Übergriffe können so häufiger und schneller erkannt werden.
Doch die gesteigerte Transparenz hat auch eine Schattenseite: Sie öffnet zugleich Räume für das Streuen von falschen oder unbewiesenem Verdächtigungen und Gerüchten, für öffentliche Vorverurteilung und Rufmord. Das Privatleben von Politikern wird inzwischen ähnlich intensiv öffentlich ausgeleuchtet wie das von Celebrities der Unterhaltungsindustrie. Die Folge ist, dass Politiker oft nicht mehr primär nach ihren objektiven Leistungen und Fähigkeiten, sondern danach beurteilt werden, ob sie der Öffentlichkeit "glaubwürdig" erscheinen, ob man es mit einem "Sympathieträger" zu tun hat, mit dem der Bürger gerne persönlich befreundet wäre. Dies wiederum fördert den Typus des populistischen Politikers, dem seine Anhängerschaft nicht wegen seiner Argumente, sondern aufgrund seiner vermeintlichen Authentizität blindlings folgt.
Wieder einmal sind somit Schopenhauers "Stachelschweine" zu nah aneinander gerückt. Doch jetzt lernen die Bürger in der Corona-Pandemie notgedrungen, mehr Distanz und mehr Zurückhaltung gegenüber ihren Mitmenschen zu wahren. Es wäre ein zivilisatorischer Gewinn, würden sie sich dieser Erfahrung in der Zeit erinnern, wenn das gesellschaftliche Leben in die "Normalität" zurückkehrt - und daraus die richtigen Lehren zu ziehen.
Richard Herzinger
Der Autor arbeitet als Publizist in Berlin. Hier seine neue Seite "hold these truths". Wir übernehmen in lockerer Folge eine Kolumne, die Richard Herzinger für die ukrainische Zeitschrift Tyzhden schreibt. D.Red. Hier der Link zur Originalkolumne.
Je länger aber die Lockdown-Maßnahmen anhalten, umso mehr drohen sie nicht nur bleibende wirtschaftliche, sondern auch psychosoziale Schäden zu verursachen. Und doch bietet der pandemiebedingte Ausnahmezustand den modernen westlichen Gesellschaften auch eine Chance: den Wert der Distanz zwischen den Individuen für das zivilisierte Zusammenleben neu zu entdecken und schätzen zu lernen.
In einer berühmten Parabel schrieb der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer 1851: "Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin- und hergeworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten."
Was der Philosoph hier definiert, ist jenes notwendige zivilisatorische Maß an Distanz, das eine Gesellschaft einhalten muss, damit unter den Menschen "ein Beisammensein bestehen kann". Menschen wollen und sollen sich einander zuwenden und unterstützen. Und gerade in der gegenwärtigen Krise beweisen sie, dass die Bereitschaft zu gegenseitiger Fürsorge und Rücksichtnahme nicht erloschen ist.
Doch zu große Nähe bringt laut Schopenhauer jene "widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler" zutage, die "Höflichkeit und feine Sitte" zerstören. Der Sinn für die "mittlere Entfernung", die Schopenhauer empfiehlt, ist den modernen westlichen Gesellschaften in den vergangenen Jahrzehnten jedoch weitgehend abhanden gekommen.
Möglichst große Nähe zwischen den Menschen gilt heute als Synonym für "soziale Wärme" und damit als humaner Idealzustand. Doch das Gebot, sich so nahe wie möglich zu kommen, senkt auch die Hemmung, anderen zu nahe zu treten und sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Es mindert dramatisch die Fähigkeit, "Höflichkeit und gute Sitte" als Leitwerte des zwischenmenschlichen Umgangs anzuerkennen.
Internet und soziale Medien haben diesen Prozess des Abschmelzens von sozialer Distanz erheblich beschleunigt. Das ist insofern paradox, als Kulturkritiker stets gewarnt hatten, das Netz fördere die soziale Isolation. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Durch die Vernetzung setzen sich die Nutzer digitaler Medien nicht nur dem Abgreifen ihrer Daten durch staatliche Institutionen und private Unternehmen aus, sondern auch der ständigen Beobachtung durch die öffentliche Meinung.
Digitales Mobbing, Hasstiraden, Drohungen und Beschimpfungen sind dabei nur extreme Auswüchse des Ausgeliefertseins des Einzelnen an das Urteil der anderen. Weil man von seinen "Freunden" Anerkennung und Zuspruch erhofft und keinen "Shitstorm" riskieren will, fördert die Aktivität in sozialen Medien auch Konformismus und vorauseilendes Wohlverhalten gegenüber der "Community", der man sich zugehörig fühlt. Es zeigt sich hier freilich auch ein neuartiges Zusammenspiel von Nähe und Distanz, das Schopenhauer nicht voraussehen konnte. Denn wer andere digital attackiert, bleibt ja physisch in räumlicher Entfernung von seinem Opfer und fühlt sich so vor dessen unmittelbarer Reaktionen sicher.
Die sozialen Netzwerke produzieren freilich nicht von sich aus, sondern verstärken nur eine vorherrschende Tendenz der Gegenwart: Nur wer sein Leben und sein Inneres für alle sichtbar offenlegt, gilt als vollwertiges soziales Individuum. Wer hingegen sein privates Dasein und seine Gedanken für sich behält, setzt sich dem Verdacht aus, etwas für die Gemeinschaft Bedrohliches zu verbergen. In manchen Unternehmen gilt es daher bereits als Nachteil, wenn ein Mitarbeiter oder ein Bewerber nicht in sozialen Medien aktiv ist.
Diese "Tyrannei der Intimität", wie es der Soziologe Richard Sennett bereits in den 1970er Jahren genannt hat, bestimmt längst auch die Wahrnehmung von Politik. Zwar ist es zweifellos ein Fortschritt, dass Politiker, Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens heute einer stärkeren Kontrolle durch die Öffentlichkeit unterworfen sind als in früheren Jahrzehnten. Amtsmissbrauch und Korruption, aber auch Vergehen wie sexuelle Übergriffe können so häufiger und schneller erkannt werden.
Doch die gesteigerte Transparenz hat auch eine Schattenseite: Sie öffnet zugleich Räume für das Streuen von falschen oder unbewiesenem Verdächtigungen und Gerüchten, für öffentliche Vorverurteilung und Rufmord. Das Privatleben von Politikern wird inzwischen ähnlich intensiv öffentlich ausgeleuchtet wie das von Celebrities der Unterhaltungsindustrie. Die Folge ist, dass Politiker oft nicht mehr primär nach ihren objektiven Leistungen und Fähigkeiten, sondern danach beurteilt werden, ob sie der Öffentlichkeit "glaubwürdig" erscheinen, ob man es mit einem "Sympathieträger" zu tun hat, mit dem der Bürger gerne persönlich befreundet wäre. Dies wiederum fördert den Typus des populistischen Politikers, dem seine Anhängerschaft nicht wegen seiner Argumente, sondern aufgrund seiner vermeintlichen Authentizität blindlings folgt.
Wieder einmal sind somit Schopenhauers "Stachelschweine" zu nah aneinander gerückt. Doch jetzt lernen die Bürger in der Corona-Pandemie notgedrungen, mehr Distanz und mehr Zurückhaltung gegenüber ihren Mitmenschen zu wahren. Es wäre ein zivilisatorischer Gewinn, würden sie sich dieser Erfahrung in der Zeit erinnern, wenn das gesellschaftliche Leben in die "Normalität" zurückkehrt - und daraus die richtigen Lehren zu ziehen.
Richard Herzinger
Der Autor arbeitet als Publizist in Berlin. Hier seine neue Seite "hold these truths". Wir übernehmen in lockerer Folge eine Kolumne, die Richard Herzinger für die ukrainische Zeitschrift Tyzhden schreibt. D.Red. Hier der Link zur Originalkolumne.
1 Kommentar