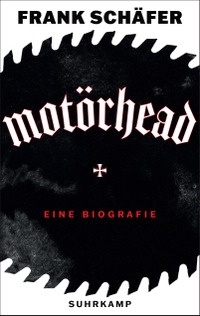Post aus New York
New York, 11.9.01: Horror, Schock & Friedhofsruhe
Von Ute Thon
13.09.2001. "Mach sofort den Fernseher an! Jetzt sehe ich es mit eigenen Augen: Die silbernen Zwillingstürme, deren Anblick mir nach längerer Abwesenheit immer als erstes versichert, dass ich wieder in meiner Heimatstadt angekommen bin, rauchen wie zwei riesige Industrieschlote." Zwei Flugzeuge fliegen in New Yorks World Trade Center, beide Türme stürzen ein. Ein Terroranschlag. Um 8.30 Uhr war die Welt noch in Ordnung. Ich bereite mich auf ein Interview vor, dass ich später in Downtown Manhattan führen wollte, ganz in der Nähe des World Trade Centers. Die Sonne scheint. Strahlend blauer Himmel. Ein herrlicher Spätsommermorgen. Im Hintergrund nehme ich Polizeisirenen wahr, ein paar Feuerwehrautos jagen vorbei, doch dass ist eigentlich nichts besonders in dieser hektischen Millionenstadt. Dann klingelt das Telefon. Hey, du weißt nicht, was los ist? Das World Trade Center brennt, das Pentagon wurde gesprengt... Mach sofort den Fernseher an! Jetzt sehe ich es mit eigenen Augen: Die silbernen Zwillingstürme, deren Anblick mir nach längerer Abwesenheit immer als erstes versichert, dass ich wieder in meiner Heimatstadt angekommen bin, rauchen wie zwei riesige Industrieschlote. Die Bilder sind unwirklich, gespenstisch. Terror vor der eigenen Haustür. Gänsehaut. Eine Freundin ruft an. Sie konnte von ihrem Fenster aus sehen, wie das Flugzeug in einen der Tower krachte. Während wir sprechen, stürzt vor ihren Augen der erste Turm zusammen. Im East Village stehen die Leute auf den Dächern. Zuerst hört man sogar noch einige Jubelrufe angesichts der Rauchwolken überm World Financial Center. In der Gegend wohnen immer noch viele Linke, Antiimperialisten, Hausbesetzer. Manche posieren vor der Rauchwolke und machen Erinnerungsfotos. Dann, als der zweite Turm fällt, plötzlich totale Stille. Ein paar Schluchzer, Schreie. Über der Stadt kreisen F-16-Kampfflugzeuge. Das ist der Beginn des 3. Weltkriegs, sagt mein Mann. Langsam sickert das Ausmaß der Katastrophe ein.
Meine Nachbarin klingelt, Tränen in den Augen. Mein Cousin arbeitet im World Trade Center, ich kann ihn nicht erreichen, stammelt sie. Wir nehmen uns in die Arme. An den Straßenecken versammeln sich Menschen. Leute, die sonst achtlos aneinander vorbeirennen, reden plötzlich aufeinander ein, trösten sich gegenseitig. Die Reaktionen sind besonnen. Keine Panik, wohl aber ein Gefühl von tiefer Unsicherheit, Verwundbarkeit macht sich breit. Alle Brücken und Tunnel, d.h. die Fluchtwege für die Bewohner Manhattans, sind gesperrt. Die U-Bahnen stehen still. Die Leute gehen zu Fuß, kaufen Wasser, Milch und Toilettenpapier in großen Mengen. Keiner schreit nach Rache. Warum gibt es soviel Gewalt und sowenig Toleranz auf dieser Welt, fragt eine junge Frau mit ihrem Baby im Kinderwagen. Die New Yorker, sonst nie um flotte Sprüche verlegen, sind wie betäubt von einem Ereignis, das zu groß, zu grausam ist, um in Worte gefasst zu werden. Alle schauen immer wieder kopfschüttelnd nach Süden, wo sich am Horizont eine riesige schwarze Wolke in den blauen Himmel schiebt.
Die News-Kommentatoren vergleichen das Attentat mit Pearl Harbor. Doch der Hauptunterschied zwischen jenem Ereignis, das den Eintritt Amerikas in den 2. Weltkrieg veranlasste, und dem heutigen Terroranschlag in New York, ist (neben der Zahl der Opfer und den politischen Umständen) die Unmittelbarkeit der Bilder. Keine fünf Minuten nach der ersten Explosion sind die Bilder bereits im Fernsehen. Den ganzen Tag über gibt es Material von Amateurfilmern. Selbst die Notärzte laufen mit Kameras herum. Das Video von dem Doktor, der mit einer Hand Sauerstoffinfusionen verabreicht und mit der anderen seinen Weg durch die Ruinen filmt, wird immer wieder auf CNN gezeigt. Auf den Straßen begegne ich unzähligen Leuten mit Kameras - jeder auf der Suche nach dem Money Shot.
Heute ist ein großes Volk attackiert worden... die Terroristen konnten Stahl zerschmettern, doch sie kriegen keinen Kratzer in unsere stählerne Bestimmtheit... - Bushs Ansprache an die Nation klingt pathetisch, hohl, peinlich. Alle anderen Regierungschefs, selbst Putin und Arafat, schafften es, mit ihrem Herzen zu sprechen, Bush dagegen liest steif von vorbereiteten Papieren ab, es macht mich krank, sagt ein Freund. Er ist eine Schande für Amerika, tobt ein anderer.
Am Abend legt sich eine gespenstische Stille über die Stadt. Die Gegend ums World Trade Center ist abgesperrt. Es sei wie ein Kriegsgebiet, erzählt ein Journalist, der dort war, als die Türme zusammenbrachen und den ein Feuerwehrmann in letzter Sekunde in einen schützenden Keller zog. Jetzt sieht man nur noch einen stetigen Strom von Rettungsfahrzeugen die Second Avenue heruntersausen. Die Leute am Straßenrand feuern die Einsatzmannschaften an. Ganz Downtown ist wie eine Geisterstadt. Alle Geschäfte sind geschlossen, die Restaurants, Kinos, Bars dunkel. Es sind kaum Autos auf den Straßen. Taxifahrer haben die Rücksitze ihrer Limousinen rausgerissen und helfen den Rettungsteams. Vor den Krankenhäusern auf der First Avenue sind Absperrungen. Ärzte und Pfleger gehen auf und ab und warten auf Notfallpatienten. Die Busfahrer haben ihre Kassen mit Pappe zugeklebt. An diesem Tag sind alle Fahrten frei. Am New York University Hospital steigen ein paar Krankenschwestern in meinen Bus. Sie lassen sich müde in die Sitze fallen. Nach einem furchtbar langen Arbeitstag wollen sie nur noch nach Hause zu ihren Familien. Es ist schlimm, sehr schlimm, der schrecklichste Tag in meinem Leben, sagt eine. Der schmerzliche Ausdruck in ihrem Gesicht lässt ahnen, welche Horrorszenen sie heute gesehen haben muss.
Die Ohnmachtsängste, die ja hinter jedem Machtgehabe stehen, hat Amerika immer mit gigantischen Katastrophenfilmen kompensiert, schreibt eine gute Freundin in einer e-mail. Jetzt ist alles Realität. Dass es solche Filme in Zukunft nicht mehr geben kann, ist sicher kein Verlust. Doch die Frage bleibt, wie gehen wir mit den Ohnmachtsgefühlen um? copyright Basler Zeitung
Meine Nachbarin klingelt, Tränen in den Augen. Mein Cousin arbeitet im World Trade Center, ich kann ihn nicht erreichen, stammelt sie. Wir nehmen uns in die Arme. An den Straßenecken versammeln sich Menschen. Leute, die sonst achtlos aneinander vorbeirennen, reden plötzlich aufeinander ein, trösten sich gegenseitig. Die Reaktionen sind besonnen. Keine Panik, wohl aber ein Gefühl von tiefer Unsicherheit, Verwundbarkeit macht sich breit. Alle Brücken und Tunnel, d.h. die Fluchtwege für die Bewohner Manhattans, sind gesperrt. Die U-Bahnen stehen still. Die Leute gehen zu Fuß, kaufen Wasser, Milch und Toilettenpapier in großen Mengen. Keiner schreit nach Rache. Warum gibt es soviel Gewalt und sowenig Toleranz auf dieser Welt, fragt eine junge Frau mit ihrem Baby im Kinderwagen. Die New Yorker, sonst nie um flotte Sprüche verlegen, sind wie betäubt von einem Ereignis, das zu groß, zu grausam ist, um in Worte gefasst zu werden. Alle schauen immer wieder kopfschüttelnd nach Süden, wo sich am Horizont eine riesige schwarze Wolke in den blauen Himmel schiebt.
Die News-Kommentatoren vergleichen das Attentat mit Pearl Harbor. Doch der Hauptunterschied zwischen jenem Ereignis, das den Eintritt Amerikas in den 2. Weltkrieg veranlasste, und dem heutigen Terroranschlag in New York, ist (neben der Zahl der Opfer und den politischen Umständen) die Unmittelbarkeit der Bilder. Keine fünf Minuten nach der ersten Explosion sind die Bilder bereits im Fernsehen. Den ganzen Tag über gibt es Material von Amateurfilmern. Selbst die Notärzte laufen mit Kameras herum. Das Video von dem Doktor, der mit einer Hand Sauerstoffinfusionen verabreicht und mit der anderen seinen Weg durch die Ruinen filmt, wird immer wieder auf CNN gezeigt. Auf den Straßen begegne ich unzähligen Leuten mit Kameras - jeder auf der Suche nach dem Money Shot.
Heute ist ein großes Volk attackiert worden... die Terroristen konnten Stahl zerschmettern, doch sie kriegen keinen Kratzer in unsere stählerne Bestimmtheit... - Bushs Ansprache an die Nation klingt pathetisch, hohl, peinlich. Alle anderen Regierungschefs, selbst Putin und Arafat, schafften es, mit ihrem Herzen zu sprechen, Bush dagegen liest steif von vorbereiteten Papieren ab, es macht mich krank, sagt ein Freund. Er ist eine Schande für Amerika, tobt ein anderer.
Am Abend legt sich eine gespenstische Stille über die Stadt. Die Gegend ums World Trade Center ist abgesperrt. Es sei wie ein Kriegsgebiet, erzählt ein Journalist, der dort war, als die Türme zusammenbrachen und den ein Feuerwehrmann in letzter Sekunde in einen schützenden Keller zog. Jetzt sieht man nur noch einen stetigen Strom von Rettungsfahrzeugen die Second Avenue heruntersausen. Die Leute am Straßenrand feuern die Einsatzmannschaften an. Ganz Downtown ist wie eine Geisterstadt. Alle Geschäfte sind geschlossen, die Restaurants, Kinos, Bars dunkel. Es sind kaum Autos auf den Straßen. Taxifahrer haben die Rücksitze ihrer Limousinen rausgerissen und helfen den Rettungsteams. Vor den Krankenhäusern auf der First Avenue sind Absperrungen. Ärzte und Pfleger gehen auf und ab und warten auf Notfallpatienten. Die Busfahrer haben ihre Kassen mit Pappe zugeklebt. An diesem Tag sind alle Fahrten frei. Am New York University Hospital steigen ein paar Krankenschwestern in meinen Bus. Sie lassen sich müde in die Sitze fallen. Nach einem furchtbar langen Arbeitstag wollen sie nur noch nach Hause zu ihren Familien. Es ist schlimm, sehr schlimm, der schrecklichste Tag in meinem Leben, sagt eine. Der schmerzliche Ausdruck in ihrem Gesicht lässt ahnen, welche Horrorszenen sie heute gesehen haben muss.
Die Ohnmachtsängste, die ja hinter jedem Machtgehabe stehen, hat Amerika immer mit gigantischen Katastrophenfilmen kompensiert, schreibt eine gute Freundin in einer e-mail. Jetzt ist alles Realität. Dass es solche Filme in Zukunft nicht mehr geben kann, ist sicher kein Verlust. Doch die Frage bleibt, wie gehen wir mit den Ohnmachtsgefühlen um? copyright Basler Zeitung