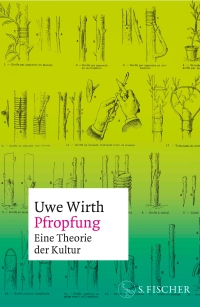Post aus New York
Reagans dritte Amtszeit
Von Ute Thon
29.01.2003. Amerika vor dem Krieg - ein Stimmungsbild. In seiner "State of the Union"-Rede (Wortlaut und Video) betonte US-Präsident Bush gestern noch einmal seine Entschlossenheit zum Präventivkrieg gegen Irak, auch ohne die Zustimmung der internationalen Völkergemeinschaft. Noch Tags zuvor hatten 41 amerikanische Nobel-Preisträger in einer öffentlichen Erklärung vor solch einer militärischen Intervention gewarnt. "Wir glauben, dass selbst im Falle eines Sieges die medizinischen, ökonomischen, umweltpolitischen, moralischen, religiösen und rechtlichen Konsequenzen eines amerikanischen Präventivschlags gegen den Irak die US-Sicherheit und unser Ansehen in der Welt unterminieren, nicht schützen werden", schreiben die Unterzeichner, darunter der Phyiker Hans Bethe, Miterfinder der Atombombe, und Walter Kohn, ein ehemaliger Berater des Verteidigungsministeriums.
Ansonsten ist es merklich still im Land. Die Gespräche in Amerikas Kneipen und Büros drehen sich häufiger um die üblichen Alltagsprobleme, Geldnöte, Liebeskummer oder Probleme im Job als um die Sorge vor einem unkontrolliertem Weltkrieg im Nahen Osten. In einer aktuellen Umfrage des Fernsehsenders CBS zeigte sich die Mehrheit der Amerikaner doppelt so besorgt über die aktuelle Wirtschaftslage als über einen Krieg im Irak. In Washington bekam eine Handvoll Abtreibungsgegner, die am 30. Jahrestag des Verfassungsgerichtsentscheids gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen demonstrierten, mehr Aufmerksamkeit als die Antikriegs-Proteste eine Woche zuvor. In New York wiederum gingen die Kunstsinnigen wie gehabt zum Galerien-Hopping nach SoHo und Chelsea. In der zweiten Januarwoche gab es über 80 Vernissagen, keine der Ausstellung hatte mit Krieg zu tun.
Dabei liegt es sicher nicht am Mangel an Informationen, dass so viele Amerikaner den Ernst der Lage scheinbar verkennen. Seit Monaten vergeht auch in den USA kein Tag, an dem der Irakkonflikt nicht die Schlagzeilen beherrscht. Es gibt Berichte über die Fortschritte und Rückschläge der Waffeninspekteure, Analysen über die Machbarkeit eines militärischen Eingriffs, Abwägungen der möglichen Kriegskosten, Diskussionsrunden mit Politikern und Stimmungsberichte von den Soldaten. Anchorman Peter Jennings moderiert seit einer Woche die ABC-Abendnachrichten live aus Bagdad und verleiht dem anonymen Feind dort ein menschliches Gesicht. Vergangenen Dienstag überraschte er die Zuschauer mit dem Porträt eines irakischen Dirigenten, der trotz Krisenstimmung sein Orchester zusammenhält. Im Interview erzählte der Musiker in akzentfreiem Englisch, wie seine beiden Kinder im ersten Golf-Krieg durch eine Splitterbombe getötet wurden und die Musik von Bach ihm hilft, die Hoffnung auf Frieden nicht zu verlieren.
Auch die Position der Kriegsgegner wird in den Medien inzwischen Ernst genommen. Führende Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post oder die Los Angeles Times berichten über die Friedensbewegung im eigenen Land. Und sie bemühen sich, die kritische Haltung der Europäer, besonders der Deutschen und der Franzosen, zu erklären. Anders als Bushs Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der den untreuen Bündnispartnern nur giftige Kommentare entgengenschleudert, zeichnen viele US-Journalisten ein differenzierteres Bild von selbstbewussten EU-Bürgern und Politikern, die sich an Bushs unilateraler Diplomatie stören. Es sei die Art und Weise, wie der Präsident spricht, sein plumpes Benehmen, der erhobene Zeigefinger und der religiöse Tenor seiner Reden, der die Europäer irritiere, schreibt die New York Times. Das größte Problem sei "Bush, der Cowboy". Tatsächlich hat der US-Präsident in den letzten Monaten auch zu Hause an Popularität verloren. Inzwischen sind laut CBS-Umfrage nur noch 59 Prozent der Amerikaner mit seiner Amtsführung zufrieden. Vor einem Jahr waren es noch über 80 Prozent.
Außerhalb Washingtons ist denn auch wenig Enthusiasmus für Bushs Kriegsrethorik zu spüren. Viele macht sie nur mürbe. "Ich habe keine echte Überzeugung vorgefunden, dass ein Krieg mit dem Irak zur demokratischen Transformation des Nahen Ostens führen könnte", beschreibt Joan Didion ihre Eindrücke von einer Vortragsreise quer durch Amerika. "Dennoch schienen sich die meisten Leute mit der Aussicht abzufinden, dass wir nichtsdestotrotz in den Krieg ziehen werden. Viele redeten von einem Gefühl von 'Unvermeidbarkeit' oder 'Grauen'. Manche erwähnten den August 1914 und jene unwiderrufliche Strömung hin zu etwas, dass nicht gut ausgehen wird. Andere sahen Parallelen zu Vietnam und die gleiche helle Hoffnungsfreude derjenigen, die wieder einen anderen Teil der Welt als Schultafel entdeckt haben, auf der sie ihre Erhabenheitsspiele demonstrieren können."
Die meisten Intellektuellen verharren in angespannter Untätigkeit. Die Argumente für und gegen den Krieg sind ausgetauscht, die Regierungspositionen unerschütterlich. Viele Kriegsgegner hoffen insgeheim sogar auf einen baldigen Start der militärischen Intervention. Denn, so die fatale Logik, erst wenn wirklich geschossen und gestorben wird, werde sich massiver Widerstand formieren. Tatsächlich ist die Zahl derer, die zu Friedensdemonstrationen gehen, immer noch vergleichsweise klein. Und bisher haben sich kaum führende Politiker den Protesten angeschlossen. Bei der letzten Anti-Kriegs-Demo in Washington zeigten sich nur zwei prominente schwarze Bürgerrechtler auf dem Podium: Jesse Jackson und Al Sharpton. Deren Anhängerschaft ist besonders von den Folgen eines Kriegs betroffen. Seit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht stellen Schwarze und Latinos der unteren Gesellschaftsschichten einen überproportional großen Anteil des Berufsheers. Amerikas Minderheiten fühlen sich von der jetzigen Regierung ohnehin nicht richtig vertreten. Viele haben bei den Wahlen gegen Bush gestimmt. Ein Krieg mit hohen Verlusten, in denen ihre Söhne und Töchter als Kanonenfutter für zweifelhafte Ziele verheizt werden, könnte Massendproteste wie seinerzeit gegen den Vietnamkrieg auslösen.
Noch steht die schweigende Mehrheit der Amerikaner jedoch hinter ihrem Präsidenten. Und wenn die US-Geschichte als Gradmesser dient, dürfte sich Bushs Position durch einen Krieg - egal mit welchen Ausgang - sogar noch stärken. John F. Kennedys Popularität stieg nach der misslungenen Invasion Kubas in 1961 dramatisch. Und auch Ronald Reagan gewann mit dem Einmarsch in Grenada 1983 zusätzliche Sympathiepunkte. Das New York Times Magazin kürte Bush in seiner jüngsten Titelgeschichte bereits zu "Reagans Sohn". Times-Kolumnist Bill Keller sieht in Bushs an Reagan erinnernder Cowboy-Mentalität den eigentlichen Schlüssel zu seinem Erfolg. "Er hat gute Chancen, die radikale Agenda, die Reagan nur bis zu einem bestimmten Punkt brachte, weiter voranzutreiben", schreibt Keller in einer Mischung aus Faszination und Resignation. "Anders als Reagan ist Bush kein Original, aber er hat Reagans Ideen an die neuen Zeiten angepasst und eine neue Sprache gefunden, sie zu vermarkten. Gerade werden wir nicht nur Zeuge von Reagans dritter Amtszeit, wenn das so weiter geht, sehen wir vielleicht sogar eine vierte."
Und obwohl der Golfkrieg noch gar nicht begonnen hat, gibt es schon passende Literatur über Bush als entschlossenen Kriegsführer. Bob Woodward, der einst den Watergate-Skandal aufdeckte, durfte den Präsidenten bei seinem "Krieg gegen den Terrorimus" beobachten. Das dabei entstandene Werk liegt nun in allen Buchläden aus. Es heißt "Bush at War" (mehr dazu hier).
Ansonsten ist es merklich still im Land. Die Gespräche in Amerikas Kneipen und Büros drehen sich häufiger um die üblichen Alltagsprobleme, Geldnöte, Liebeskummer oder Probleme im Job als um die Sorge vor einem unkontrolliertem Weltkrieg im Nahen Osten. In einer aktuellen Umfrage des Fernsehsenders CBS zeigte sich die Mehrheit der Amerikaner doppelt so besorgt über die aktuelle Wirtschaftslage als über einen Krieg im Irak. In Washington bekam eine Handvoll Abtreibungsgegner, die am 30. Jahrestag des Verfassungsgerichtsentscheids gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frauen demonstrierten, mehr Aufmerksamkeit als die Antikriegs-Proteste eine Woche zuvor. In New York wiederum gingen die Kunstsinnigen wie gehabt zum Galerien-Hopping nach SoHo und Chelsea. In der zweiten Januarwoche gab es über 80 Vernissagen, keine der Ausstellung hatte mit Krieg zu tun.
Dabei liegt es sicher nicht am Mangel an Informationen, dass so viele Amerikaner den Ernst der Lage scheinbar verkennen. Seit Monaten vergeht auch in den USA kein Tag, an dem der Irakkonflikt nicht die Schlagzeilen beherrscht. Es gibt Berichte über die Fortschritte und Rückschläge der Waffeninspekteure, Analysen über die Machbarkeit eines militärischen Eingriffs, Abwägungen der möglichen Kriegskosten, Diskussionsrunden mit Politikern und Stimmungsberichte von den Soldaten. Anchorman Peter Jennings moderiert seit einer Woche die ABC-Abendnachrichten live aus Bagdad und verleiht dem anonymen Feind dort ein menschliches Gesicht. Vergangenen Dienstag überraschte er die Zuschauer mit dem Porträt eines irakischen Dirigenten, der trotz Krisenstimmung sein Orchester zusammenhält. Im Interview erzählte der Musiker in akzentfreiem Englisch, wie seine beiden Kinder im ersten Golf-Krieg durch eine Splitterbombe getötet wurden und die Musik von Bach ihm hilft, die Hoffnung auf Frieden nicht zu verlieren.
Auch die Position der Kriegsgegner wird in den Medien inzwischen Ernst genommen. Führende Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post oder die Los Angeles Times berichten über die Friedensbewegung im eigenen Land. Und sie bemühen sich, die kritische Haltung der Europäer, besonders der Deutschen und der Franzosen, zu erklären. Anders als Bushs Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der den untreuen Bündnispartnern nur giftige Kommentare entgengenschleudert, zeichnen viele US-Journalisten ein differenzierteres Bild von selbstbewussten EU-Bürgern und Politikern, die sich an Bushs unilateraler Diplomatie stören. Es sei die Art und Weise, wie der Präsident spricht, sein plumpes Benehmen, der erhobene Zeigefinger und der religiöse Tenor seiner Reden, der die Europäer irritiere, schreibt die New York Times. Das größte Problem sei "Bush, der Cowboy". Tatsächlich hat der US-Präsident in den letzten Monaten auch zu Hause an Popularität verloren. Inzwischen sind laut CBS-Umfrage nur noch 59 Prozent der Amerikaner mit seiner Amtsführung zufrieden. Vor einem Jahr waren es noch über 80 Prozent.
Außerhalb Washingtons ist denn auch wenig Enthusiasmus für Bushs Kriegsrethorik zu spüren. Viele macht sie nur mürbe. "Ich habe keine echte Überzeugung vorgefunden, dass ein Krieg mit dem Irak zur demokratischen Transformation des Nahen Ostens führen könnte", beschreibt Joan Didion ihre Eindrücke von einer Vortragsreise quer durch Amerika. "Dennoch schienen sich die meisten Leute mit der Aussicht abzufinden, dass wir nichtsdestotrotz in den Krieg ziehen werden. Viele redeten von einem Gefühl von 'Unvermeidbarkeit' oder 'Grauen'. Manche erwähnten den August 1914 und jene unwiderrufliche Strömung hin zu etwas, dass nicht gut ausgehen wird. Andere sahen Parallelen zu Vietnam und die gleiche helle Hoffnungsfreude derjenigen, die wieder einen anderen Teil der Welt als Schultafel entdeckt haben, auf der sie ihre Erhabenheitsspiele demonstrieren können."
Die meisten Intellektuellen verharren in angespannter Untätigkeit. Die Argumente für und gegen den Krieg sind ausgetauscht, die Regierungspositionen unerschütterlich. Viele Kriegsgegner hoffen insgeheim sogar auf einen baldigen Start der militärischen Intervention. Denn, so die fatale Logik, erst wenn wirklich geschossen und gestorben wird, werde sich massiver Widerstand formieren. Tatsächlich ist die Zahl derer, die zu Friedensdemonstrationen gehen, immer noch vergleichsweise klein. Und bisher haben sich kaum führende Politiker den Protesten angeschlossen. Bei der letzten Anti-Kriegs-Demo in Washington zeigten sich nur zwei prominente schwarze Bürgerrechtler auf dem Podium: Jesse Jackson und Al Sharpton. Deren Anhängerschaft ist besonders von den Folgen eines Kriegs betroffen. Seit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht stellen Schwarze und Latinos der unteren Gesellschaftsschichten einen überproportional großen Anteil des Berufsheers. Amerikas Minderheiten fühlen sich von der jetzigen Regierung ohnehin nicht richtig vertreten. Viele haben bei den Wahlen gegen Bush gestimmt. Ein Krieg mit hohen Verlusten, in denen ihre Söhne und Töchter als Kanonenfutter für zweifelhafte Ziele verheizt werden, könnte Massendproteste wie seinerzeit gegen den Vietnamkrieg auslösen.
Noch steht die schweigende Mehrheit der Amerikaner jedoch hinter ihrem Präsidenten. Und wenn die US-Geschichte als Gradmesser dient, dürfte sich Bushs Position durch einen Krieg - egal mit welchen Ausgang - sogar noch stärken. John F. Kennedys Popularität stieg nach der misslungenen Invasion Kubas in 1961 dramatisch. Und auch Ronald Reagan gewann mit dem Einmarsch in Grenada 1983 zusätzliche Sympathiepunkte. Das New York Times Magazin kürte Bush in seiner jüngsten Titelgeschichte bereits zu "Reagans Sohn". Times-Kolumnist Bill Keller sieht in Bushs an Reagan erinnernder Cowboy-Mentalität den eigentlichen Schlüssel zu seinem Erfolg. "Er hat gute Chancen, die radikale Agenda, die Reagan nur bis zu einem bestimmten Punkt brachte, weiter voranzutreiben", schreibt Keller in einer Mischung aus Faszination und Resignation. "Anders als Reagan ist Bush kein Original, aber er hat Reagans Ideen an die neuen Zeiten angepasst und eine neue Sprache gefunden, sie zu vermarkten. Gerade werden wir nicht nur Zeuge von Reagans dritter Amtszeit, wenn das so weiter geht, sehen wir vielleicht sogar eine vierte."
Und obwohl der Golfkrieg noch gar nicht begonnen hat, gibt es schon passende Literatur über Bush als entschlossenen Kriegsführer. Bob Woodward, der einst den Watergate-Skandal aufdeckte, durfte den Präsidenten bei seinem "Krieg gegen den Terrorimus" beobachten. Das dabei entstandene Werk liegt nun in allen Buchläden aus. Es heißt "Bush at War" (mehr dazu hier).