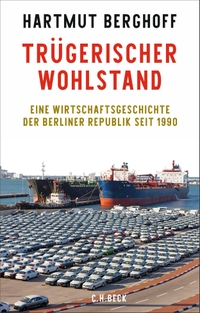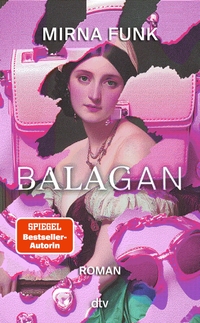Post aus Ramallah
Sehnsucht nach Grün
5. und 6. Brief. Von Uta Ruge
25.04.2006. Ramallah ist eine Überraschung: Es gibt viel Reichtum in der Stadt, sogar Eleganz und viele Farben. Grün aber nur auf Plakaten. 5. Brief
Amiras Auto fällt in Tel Aviv auf, staubig wie es ist. Mit gelbem Klebeband steht auf Kühlerhaube und Rückscheibe TV geschrieben, ein Code für die Kinder der Westbank, den Wagen trotz des israelischen Nummernschilds nicht mit Steinen zu bewerfen. Fahrt von Jaffa nach Ramallah.
Zuerst Industriegebiet, dann Wald. Teils europäische Baumarten, die jetzt allerdings zu sterben beginnen, weil sie das Klima am Ende doch nicht vertragen haben. Schließlich weicht der Wald. Es wird sehr steinig. Im weiten Blick über die Hügel wird die Gestalt der Landschaft erkennbar, Abhänge und Täler, Dörfer, die eigentlich Kleinstädte sind, Straßen, schmale Terassen. Auf steinigem, rotbraunem Grund silbrig schimmernde Olivenbäume, frisches Grün der Mandelbäume, die aussehen wie Kirschbäume. Mal eine Schaf- oder Ziegenherde mit Hirten in Jeans und mit Baseballmütze.
Sanft führt die Entlastungsstraße nach Jerusalem über die Grüne Grenze, und selbst Amira kann nicht mehr genau sagen, wo das besetzte Gebiet, die Westbank anfängt und Israel aufhört. Ganz langsam hat sich die Grenze verwischt, auch durch die Gründung von Städten direkt auf der Grenzlinie, und immer schieben sie sich ein wenig mehr auf palästinensisches Gebiet vor. Ich sehe ein Hinweisschild nach Mod'i, hole meine Israelkarte heraus - und werde ausgelacht. Total nutzlos. Weder die Strasse, auf der wir fahren, noch die auf den Straßenschildern ausgewiesenen Städte sind eingezeichnet. Also los, sage ich. Bitte alles erklären.
Als erstes muss ich wissen, dass dies die "Apartheidstraße" ist, also eine, die zwar über besetztes Gebiet führt und für deren Bau palästinensisches Nutzland enteignet wurde, von Palästinensern aber nicht benutzt werden kann. Das war nicht immer so. Anfangs gab es Ein- und Ausfahrten zu den arabischen Orten. Seit zwei, drei Jahren allerdings sind diese Auffahrten gesperrt. Je rechts und links liegen an ihren Rändern riesige Betonwürfel, die mit einem Stahlriegel verbunden sind.
Sie erinnern mich an Nordirland. Dort wurden vor dem Waffenstillstand auf der Grenze - immerhin einer innereuropäischen Grenze - auch viele Straßen geschlossen, der gesamte grenzüberschreitende Verkehr durch martialische Kontrollstellen geschleust. Oft waren es Bauern, die mit ihren Traktoren zum Bearbeiten ihrer Äcker auf die andere Seite mussten. Manchmal machten die Bauern von beiden Seiten diese Straßen wieder auf, schoben Betonblöcke beiseite, schütteten Gräben zu oder fuhren ganz einfach um aufgeschüttete Erdhaufen herum. Durch Hubschrauberüberwachung waren solche Aktionen der Armee immer sofort bekannt, manchmal ließ man die Leute trotzdem gewähren. Dann allerdings gab es auch massive Militäreinsätze. Die Straßen wieder geschlossen, der Zugang wieder abgeschnitten. Ein nicht ungefährliches Katz- und Mausspiel, das sich über Monate und Jahre hinziehen konnte.
Zurück zur Westbank. Inzwischen sind ein paar einzelne Männer am Straßenrand aufgetaucht. Hoch bepackte Einkaufswagen werden von ihnen durch den rotbraunen Schotter gewuchtet. Es sind palästinensische Arbeiter, deren israelische Arbeitgeber ihnen irgendwie ihre Arbeitsstelle in Israel erhalten haben. Die Wege zur Arbeit und zurück mit dem Auto zu machen ist wegen dieser Stahlriegel unmöglich, trotzdem werden irgendwie Einkäufe mitgebracht.
Zunehmend Baustellen, gigantische Einschnitte in Hügeln. Erdarbeiten, Bau von Sperranlagen, Zäunen, Mauern. Einmal auf der linken Seite eine jüdische Siedlung, eigentlich auch eher eine Kleinstadt, die von einer "Sicherheitsstraße" umrundet wird - ein umzäunter Korridor, in dem nur Armeefahrzeuge sich bewegen dürfen. Ein anderes Mal eine palästinensische Schule inmitten einer jüdischen Siedlung. Sie stand früher auf freiem Feld zwischen mehreren Dörfern. Eigentlich musste sie erweitert werden, erzählt Amira, dafür aber wird die Genehmigung verweigert. Dennoch wird sie weiter von palästinensischen Kinder benutzt.
Das ungemütlichste Bild sehe ich nicht. Amira erzählt mir davon, als wir daran vorbei fahren. Auf dem Hinweg sah sie auf dem Gelände eines Gefangenenlagers eine Gruppe von Männern mit schwarzen Augenbinden und auf dem Rücken gefesselten Händen. "Wahrscheinlich die Ausbeute von den Kontrollen der letzten Nacht." Was haben sie getan?
Viele sind illegal dort, wo sie sind. Zutrittsverordnungen zu diesem oder jenem Teil der Westbank, Gazas oder Ostjerusalems sorgen dafür. Man hält sich nicht daran, besucht Eltern oder Kinder, sucht Arbeit, lässt das Auto in der Werkstatt des Schwagers reparieren, - und irgendwann wird man erwischt.
Die Sache mit dem Passierscheinsystem für verschiedene Zonen und verschiedene Bevölkerungsgruppen ist so kompliziert, dass ich eine Nachhilfestunde mit Amira vereinbare.
Wir fahren einige Straßen entlang, die nur ein paar Wochen alt sind, stehen vor Sperren, und einmal werden vor einem Zugang nach Ramallah unsere Papiere kontrolliert. Der Soldat ist freundlich, es ist nichts Martialisches an der Situation, weniger, als ich es aus Nordirland kenne. Aber wir sind auch nur zwei Frauen mittleren Alters, für die die zahllosen Regeln und Beschränkungen nicht gelten: Ich habe als Ausländerin Zugang zu Ramallah und Amira als Journalistin (ansonsten ist der Zugang für Israelis verboten, von israelischer Seite aus).
Ramallah ist nach all dem eine große Überraschung. Viele Häuser sind groß und reich, viele Autos auch, es scheint Prosperität zu herrschen, und sogar ein wenig Eleganz. Auf den Straßen Männer mit und ohne Keffiah, Frauen mit und ohne Kopftuch, viele grüne Flaggen, die Farbe der Hamas, ausgebleichte, zerfledderte Wahlplakate an den Wänden, ab und zu ein Konterfei von Arafat.
Die Stadt scheint auf mehrere Hügel gebaut, oft geht es sehr steil auf- oder abwärts. Der Reichtum der Häuser kontrastiert heftig mit Straßen voller Schlaglöcher und Schmutz.
Einkaufszentrum. Schwarz eingefärbte Glasfront. Amira trifft auf dem Parkplatz Bekannte, nicht das erste Mal höre ich ihr heftiges Arabisch. Sie stellt sie mir vor: der eine ist Architekt einer Organisation, die alte Gebäude für kommunalen Gebrauch wieder herstellt - eines ihrer Projekte war eine Musikschule für Kinder aus Flüchtlingslager. Ein anderer ist Journalist. Gemeinsam schimpft man über den internen Zwist in Gaza zwischen Fatah und Hamas.
Einkauf im Supermarkt. Die meisten Produkte erkenne ich aus Israel. Aber es gibt auch Cadbury-Schokolade, Kelloggs-Cornflakes, Tee von Teekanne, Schweizer Kräuterzucker von Ricola...
Abends von der Loggia aus der Gesang des Muezzin, der zum Beten ruft - und manchmal Schüsse.
6. Brief
Ich dusche mit Blick auf ein Minarett in der Ferne. Der Wasserstrahl ist dünn, angeblich dürfen lokale Firmen nur Leitungsrohre mit kleinen Durchmessern benutzen.
Wir wollen in die Stadt. Als guter Gast biete ich an, den Müll mit herunter zu nehmen. Aber wohin damit? Es gibt keine Mülltonnen. Wir nehmen ihn im Auto mit, an der Kreuzung zur nächsten Straße steht ein offener Container, in den man den Müll wirft. Wie heißt eigentlich die Straße, in der wir wohnen? Sie hat keinen Namen, oder vielleicht doch, aber jedenfalls gibt es weder ein Schild noch würde irgend jemand, den man nach dem Weg fragt, den Namen wissen.
Gibt es einen Stadtplan von Ramallah? Ja, angeblich gibt es einen. Aber man orientiert sich eher nach Stadtvierteln, vier, fünf großen Straßen und Plätzen, nach Richtungen, öffentlichen Gebäuden, Hotels und Geschäften. Der Stadtplan ist nur für Ausländer, Mitarbeiter der vielen NGOs, die sich hier tummeln.
Und was ist mit der Post? Man schreibt keine Briefe, trifft sich eher, telefoniert. Und die Elektro- und Gasrechnung? Die kommen natürlich auch ohne Postkasten an. Größere Unternehmen benutzen meistens lokale Kurierfirmen. Die Post wird an die Tür gebracht, oder man gibt sie den Nachbarn. Und wenn Briefe ins Ausland gehen? Dauert ewig, muss durch das israelische Postamt.
Wir treffen Djihad, der in einer Woche nach Großbritannien ausreisen wird. Na, mit dem Namen wird's in London auch nicht grad einfach, sage ich. Er lacht. Er ist aus Gaza und man sagt, die Menschen von Gaza finden immer etwas zu lachen. Es ist das Meer, meint er. Die Menschen auf der Westbank sind so trocken wie ihr Land. Dein Name, sage ich. Ich bin zwei Wochen nach dem Sechs-Tage-Krieg geboren, also direkt in die Besatzung hinein. "Djihad" heißt auch Widerstand, Anstrengung, irgendwie so. Es ist ein arabisches Wort, das erst vom Islam die Bedeutung bekam, die man in Europa und Amerika jetzt überall kennt. Aber meine Schwester heißt übersetzt sogar "Waffe". Er lacht wieder.
Wir trinken türkischen Kaffee und rauchen (die Marke Time, die er wiederum "übersetzt" mit "This Is My End"). Djihad ist Mathematikpädagoge. Er lebt seit achtzehn Jahren in Ramallah, davon die letzten illegal, weil es inzwischen illegal geworden ist, als Einwohner von Gaza auf der Westbank zu leben. Seine Frau ist Israelin, allerdings zwangsweise. Sie kommt aus Ostjerusalem, ist Palästinenserin. Sie arbeitet hier in einem mit ausländischem Geld finanzierten Frauenkrisenzentrum. Es geht hier, wie überall auf der Welt, um häusliche Gewalt, Scheidung, Vergewaltigungen. Lässt Hamas sie weiterarbeiten? Ja, sagt Djihad. Noch.
Nach längerem Fachsimpeln über verschiedene Lerntheorien - ich steuere meine Feldenkraisweisheiten bei, die Einbeziehung der Motorik beim Lernen, auch in der Mathematik -, fahren wir zu einer Galerie. Bilder sollen gerahmt werden. Man sucht aus, Passpartouts, Rahmen, Glas, spricht dabei arabisch, englisch und hebräisch durcheinander. Wärenddessen bewundere ich die vielen kitschigen Alpenszenerien, die in vielen Größen und Varianten zum Verkauf sehen: Wälder, Berge, rauschende Bäche. Es ist die Sehnsucht nach Grün, sagt Amira.
Der Galerist ist, wie sich herausstellt, ein Freund von Hani Zu'Rob, einem jungen Maler aus Gaza, der international ausgestellt und gehandelt wird und zur Gründung einer internationalen Kunstakademie in Ramallah beigetragen hat.
Seine Bilder waren zu Anfang vor allem eine Auseinandersetzung mit der Situation des Isoliertsein, der Gefangenschaft, seine Mittel die des figurativen Expressionismus, ein wenig erinnernd an die Jungen Wilden der Achtziger Jahre in Berlin. Zur Zeit malt er fast nur noch abstrakt, offenbar um sich, wie es im Katalog seiner letzten Ausstellung heißt, von der "kollektiven Rhetorik" zu befreien. Kräftige Farben, starke Kontraste, enorme Bewegung, und dann wieder fast eine Aufhebung von Farbe durch Farbigkeit. Eines seiner Bilder hängt bei Amira über dem Schreibtisch. Ein anderes, dass ich nur aus dem Katalog kenne, belegt das Motiv der Befreiung von der "kollektiven Rhetorik" mit dem Bild eines männlichen Akts in witziger Perspektive, nämlich von seinen übergroßen Füßen aus gesehen, umgeben von Farblichkeit, die Wüste assoziieren lässt. Der Titel: "Myself, the siege und your love".
Weiter geht es. Eine Tischlerei für kleine Reparaturarbeiten, ein Gemüsegeschäft mit Bergen von stark duftenden Kräutern - Minze, Korinader, Thymian; auf einem oberen Holzbrett entdecke ich Salzgurken eingelegt in recyclten Saftflaschen aus Plastik, aus denen ich später zu Hause die Gurken nicht herauskriege (schneidet man die Flaschen auf?). Einmal verfahren wir uns und landen an einer neuerdings blockierten Straße, müssen umdrehen.
Abends kommt auf einen Sprung Ghada Karmi ("In Search of Fatima"). Wir sprechen über das, worüber alle hier ständig sprechen: Hamas und die Reaktion Israels, Europas etc... Wie viele andere fragt auch sie sich: Ist dies das Ende der palästinensischen Sache?
Während ich dies am nächsten Tag tippe, bekommt Amira einen Anruf von einer Gruppe von Frauen der israelischen Menschenrechtsorganisation Machsom-Watch. Im Norden sind mehrere Checkpoints blockiert, die Menschen werden stundenlang aufgehalten. Gründe werden nicht genannt. Sie stellt die Information auf die Internetseite von Haaretz, ruft dann bei der Armee an. Manchmal hilft es.
Übrigens haben wir auch im Internet eine Erklärung für die Schüsse von gestern Abend gefunden. Eine Gruppe von Fatah-Leuten hat ihrer Forderung nach Taxi-Lizenzen mit Schüssen in die Luft Nachdruck verliehen. Die Lizenzen waren ihnen von der Verwaltung versprochen worden, Hamas hat die Ausführung gestoppt. Nicht etwa, so sagen Beobachter, weil sie selbst ihre Leute mit Lizenzen versorgen wollen, sondern um dem alles erstickenden Filz der Korruption zu Leibe zu rücken. Dafür sind sie gewählt worden, sagen Beobachter.
Amiras Auto fällt in Tel Aviv auf, staubig wie es ist. Mit gelbem Klebeband steht auf Kühlerhaube und Rückscheibe TV geschrieben, ein Code für die Kinder der Westbank, den Wagen trotz des israelischen Nummernschilds nicht mit Steinen zu bewerfen. Fahrt von Jaffa nach Ramallah.
Zuerst Industriegebiet, dann Wald. Teils europäische Baumarten, die jetzt allerdings zu sterben beginnen, weil sie das Klima am Ende doch nicht vertragen haben. Schließlich weicht der Wald. Es wird sehr steinig. Im weiten Blick über die Hügel wird die Gestalt der Landschaft erkennbar, Abhänge und Täler, Dörfer, die eigentlich Kleinstädte sind, Straßen, schmale Terassen. Auf steinigem, rotbraunem Grund silbrig schimmernde Olivenbäume, frisches Grün der Mandelbäume, die aussehen wie Kirschbäume. Mal eine Schaf- oder Ziegenherde mit Hirten in Jeans und mit Baseballmütze.
Sanft führt die Entlastungsstraße nach Jerusalem über die Grüne Grenze, und selbst Amira kann nicht mehr genau sagen, wo das besetzte Gebiet, die Westbank anfängt und Israel aufhört. Ganz langsam hat sich die Grenze verwischt, auch durch die Gründung von Städten direkt auf der Grenzlinie, und immer schieben sie sich ein wenig mehr auf palästinensisches Gebiet vor. Ich sehe ein Hinweisschild nach Mod'i, hole meine Israelkarte heraus - und werde ausgelacht. Total nutzlos. Weder die Strasse, auf der wir fahren, noch die auf den Straßenschildern ausgewiesenen Städte sind eingezeichnet. Also los, sage ich. Bitte alles erklären.
Als erstes muss ich wissen, dass dies die "Apartheidstraße" ist, also eine, die zwar über besetztes Gebiet führt und für deren Bau palästinensisches Nutzland enteignet wurde, von Palästinensern aber nicht benutzt werden kann. Das war nicht immer so. Anfangs gab es Ein- und Ausfahrten zu den arabischen Orten. Seit zwei, drei Jahren allerdings sind diese Auffahrten gesperrt. Je rechts und links liegen an ihren Rändern riesige Betonwürfel, die mit einem Stahlriegel verbunden sind.
Sie erinnern mich an Nordirland. Dort wurden vor dem Waffenstillstand auf der Grenze - immerhin einer innereuropäischen Grenze - auch viele Straßen geschlossen, der gesamte grenzüberschreitende Verkehr durch martialische Kontrollstellen geschleust. Oft waren es Bauern, die mit ihren Traktoren zum Bearbeiten ihrer Äcker auf die andere Seite mussten. Manchmal machten die Bauern von beiden Seiten diese Straßen wieder auf, schoben Betonblöcke beiseite, schütteten Gräben zu oder fuhren ganz einfach um aufgeschüttete Erdhaufen herum. Durch Hubschrauberüberwachung waren solche Aktionen der Armee immer sofort bekannt, manchmal ließ man die Leute trotzdem gewähren. Dann allerdings gab es auch massive Militäreinsätze. Die Straßen wieder geschlossen, der Zugang wieder abgeschnitten. Ein nicht ungefährliches Katz- und Mausspiel, das sich über Monate und Jahre hinziehen konnte.
Zurück zur Westbank. Inzwischen sind ein paar einzelne Männer am Straßenrand aufgetaucht. Hoch bepackte Einkaufswagen werden von ihnen durch den rotbraunen Schotter gewuchtet. Es sind palästinensische Arbeiter, deren israelische Arbeitgeber ihnen irgendwie ihre Arbeitsstelle in Israel erhalten haben. Die Wege zur Arbeit und zurück mit dem Auto zu machen ist wegen dieser Stahlriegel unmöglich, trotzdem werden irgendwie Einkäufe mitgebracht.
Zunehmend Baustellen, gigantische Einschnitte in Hügeln. Erdarbeiten, Bau von Sperranlagen, Zäunen, Mauern. Einmal auf der linken Seite eine jüdische Siedlung, eigentlich auch eher eine Kleinstadt, die von einer "Sicherheitsstraße" umrundet wird - ein umzäunter Korridor, in dem nur Armeefahrzeuge sich bewegen dürfen. Ein anderes Mal eine palästinensische Schule inmitten einer jüdischen Siedlung. Sie stand früher auf freiem Feld zwischen mehreren Dörfern. Eigentlich musste sie erweitert werden, erzählt Amira, dafür aber wird die Genehmigung verweigert. Dennoch wird sie weiter von palästinensischen Kinder benutzt.
Das ungemütlichste Bild sehe ich nicht. Amira erzählt mir davon, als wir daran vorbei fahren. Auf dem Hinweg sah sie auf dem Gelände eines Gefangenenlagers eine Gruppe von Männern mit schwarzen Augenbinden und auf dem Rücken gefesselten Händen. "Wahrscheinlich die Ausbeute von den Kontrollen der letzten Nacht." Was haben sie getan?
Viele sind illegal dort, wo sie sind. Zutrittsverordnungen zu diesem oder jenem Teil der Westbank, Gazas oder Ostjerusalems sorgen dafür. Man hält sich nicht daran, besucht Eltern oder Kinder, sucht Arbeit, lässt das Auto in der Werkstatt des Schwagers reparieren, - und irgendwann wird man erwischt.
Die Sache mit dem Passierscheinsystem für verschiedene Zonen und verschiedene Bevölkerungsgruppen ist so kompliziert, dass ich eine Nachhilfestunde mit Amira vereinbare.
Wir fahren einige Straßen entlang, die nur ein paar Wochen alt sind, stehen vor Sperren, und einmal werden vor einem Zugang nach Ramallah unsere Papiere kontrolliert. Der Soldat ist freundlich, es ist nichts Martialisches an der Situation, weniger, als ich es aus Nordirland kenne. Aber wir sind auch nur zwei Frauen mittleren Alters, für die die zahllosen Regeln und Beschränkungen nicht gelten: Ich habe als Ausländerin Zugang zu Ramallah und Amira als Journalistin (ansonsten ist der Zugang für Israelis verboten, von israelischer Seite aus).
Ramallah ist nach all dem eine große Überraschung. Viele Häuser sind groß und reich, viele Autos auch, es scheint Prosperität zu herrschen, und sogar ein wenig Eleganz. Auf den Straßen Männer mit und ohne Keffiah, Frauen mit und ohne Kopftuch, viele grüne Flaggen, die Farbe der Hamas, ausgebleichte, zerfledderte Wahlplakate an den Wänden, ab und zu ein Konterfei von Arafat.
Die Stadt scheint auf mehrere Hügel gebaut, oft geht es sehr steil auf- oder abwärts. Der Reichtum der Häuser kontrastiert heftig mit Straßen voller Schlaglöcher und Schmutz.
Einkaufszentrum. Schwarz eingefärbte Glasfront. Amira trifft auf dem Parkplatz Bekannte, nicht das erste Mal höre ich ihr heftiges Arabisch. Sie stellt sie mir vor: der eine ist Architekt einer Organisation, die alte Gebäude für kommunalen Gebrauch wieder herstellt - eines ihrer Projekte war eine Musikschule für Kinder aus Flüchtlingslager. Ein anderer ist Journalist. Gemeinsam schimpft man über den internen Zwist in Gaza zwischen Fatah und Hamas.
Einkauf im Supermarkt. Die meisten Produkte erkenne ich aus Israel. Aber es gibt auch Cadbury-Schokolade, Kelloggs-Cornflakes, Tee von Teekanne, Schweizer Kräuterzucker von Ricola...
Abends von der Loggia aus der Gesang des Muezzin, der zum Beten ruft - und manchmal Schüsse.
6. Brief
Ich dusche mit Blick auf ein Minarett in der Ferne. Der Wasserstrahl ist dünn, angeblich dürfen lokale Firmen nur Leitungsrohre mit kleinen Durchmessern benutzen.
Wir wollen in die Stadt. Als guter Gast biete ich an, den Müll mit herunter zu nehmen. Aber wohin damit? Es gibt keine Mülltonnen. Wir nehmen ihn im Auto mit, an der Kreuzung zur nächsten Straße steht ein offener Container, in den man den Müll wirft. Wie heißt eigentlich die Straße, in der wir wohnen? Sie hat keinen Namen, oder vielleicht doch, aber jedenfalls gibt es weder ein Schild noch würde irgend jemand, den man nach dem Weg fragt, den Namen wissen.
Gibt es einen Stadtplan von Ramallah? Ja, angeblich gibt es einen. Aber man orientiert sich eher nach Stadtvierteln, vier, fünf großen Straßen und Plätzen, nach Richtungen, öffentlichen Gebäuden, Hotels und Geschäften. Der Stadtplan ist nur für Ausländer, Mitarbeiter der vielen NGOs, die sich hier tummeln.
Und was ist mit der Post? Man schreibt keine Briefe, trifft sich eher, telefoniert. Und die Elektro- und Gasrechnung? Die kommen natürlich auch ohne Postkasten an. Größere Unternehmen benutzen meistens lokale Kurierfirmen. Die Post wird an die Tür gebracht, oder man gibt sie den Nachbarn. Und wenn Briefe ins Ausland gehen? Dauert ewig, muss durch das israelische Postamt.
Wir treffen Djihad, der in einer Woche nach Großbritannien ausreisen wird. Na, mit dem Namen wird's in London auch nicht grad einfach, sage ich. Er lacht. Er ist aus Gaza und man sagt, die Menschen von Gaza finden immer etwas zu lachen. Es ist das Meer, meint er. Die Menschen auf der Westbank sind so trocken wie ihr Land. Dein Name, sage ich. Ich bin zwei Wochen nach dem Sechs-Tage-Krieg geboren, also direkt in die Besatzung hinein. "Djihad" heißt auch Widerstand, Anstrengung, irgendwie so. Es ist ein arabisches Wort, das erst vom Islam die Bedeutung bekam, die man in Europa und Amerika jetzt überall kennt. Aber meine Schwester heißt übersetzt sogar "Waffe". Er lacht wieder.
Wir trinken türkischen Kaffee und rauchen (die Marke Time, die er wiederum "übersetzt" mit "This Is My End"). Djihad ist Mathematikpädagoge. Er lebt seit achtzehn Jahren in Ramallah, davon die letzten illegal, weil es inzwischen illegal geworden ist, als Einwohner von Gaza auf der Westbank zu leben. Seine Frau ist Israelin, allerdings zwangsweise. Sie kommt aus Ostjerusalem, ist Palästinenserin. Sie arbeitet hier in einem mit ausländischem Geld finanzierten Frauenkrisenzentrum. Es geht hier, wie überall auf der Welt, um häusliche Gewalt, Scheidung, Vergewaltigungen. Lässt Hamas sie weiterarbeiten? Ja, sagt Djihad. Noch.
Nach längerem Fachsimpeln über verschiedene Lerntheorien - ich steuere meine Feldenkraisweisheiten bei, die Einbeziehung der Motorik beim Lernen, auch in der Mathematik -, fahren wir zu einer Galerie. Bilder sollen gerahmt werden. Man sucht aus, Passpartouts, Rahmen, Glas, spricht dabei arabisch, englisch und hebräisch durcheinander. Wärenddessen bewundere ich die vielen kitschigen Alpenszenerien, die in vielen Größen und Varianten zum Verkauf sehen: Wälder, Berge, rauschende Bäche. Es ist die Sehnsucht nach Grün, sagt Amira.
Der Galerist ist, wie sich herausstellt, ein Freund von Hani Zu'Rob, einem jungen Maler aus Gaza, der international ausgestellt und gehandelt wird und zur Gründung einer internationalen Kunstakademie in Ramallah beigetragen hat.
Seine Bilder waren zu Anfang vor allem eine Auseinandersetzung mit der Situation des Isoliertsein, der Gefangenschaft, seine Mittel die des figurativen Expressionismus, ein wenig erinnernd an die Jungen Wilden der Achtziger Jahre in Berlin. Zur Zeit malt er fast nur noch abstrakt, offenbar um sich, wie es im Katalog seiner letzten Ausstellung heißt, von der "kollektiven Rhetorik" zu befreien. Kräftige Farben, starke Kontraste, enorme Bewegung, und dann wieder fast eine Aufhebung von Farbe durch Farbigkeit. Eines seiner Bilder hängt bei Amira über dem Schreibtisch. Ein anderes, dass ich nur aus dem Katalog kenne, belegt das Motiv der Befreiung von der "kollektiven Rhetorik" mit dem Bild eines männlichen Akts in witziger Perspektive, nämlich von seinen übergroßen Füßen aus gesehen, umgeben von Farblichkeit, die Wüste assoziieren lässt. Der Titel: "Myself, the siege und your love".
Weiter geht es. Eine Tischlerei für kleine Reparaturarbeiten, ein Gemüsegeschäft mit Bergen von stark duftenden Kräutern - Minze, Korinader, Thymian; auf einem oberen Holzbrett entdecke ich Salzgurken eingelegt in recyclten Saftflaschen aus Plastik, aus denen ich später zu Hause die Gurken nicht herauskriege (schneidet man die Flaschen auf?). Einmal verfahren wir uns und landen an einer neuerdings blockierten Straße, müssen umdrehen.
Abends kommt auf einen Sprung Ghada Karmi ("In Search of Fatima"). Wir sprechen über das, worüber alle hier ständig sprechen: Hamas und die Reaktion Israels, Europas etc... Wie viele andere fragt auch sie sich: Ist dies das Ende der palästinensischen Sache?
Während ich dies am nächsten Tag tippe, bekommt Amira einen Anruf von einer Gruppe von Frauen der israelischen Menschenrechtsorganisation Machsom-Watch. Im Norden sind mehrere Checkpoints blockiert, die Menschen werden stundenlang aufgehalten. Gründe werden nicht genannt. Sie stellt die Information auf die Internetseite von Haaretz, ruft dann bei der Armee an. Manchmal hilft es.
Übrigens haben wir auch im Internet eine Erklärung für die Schüsse von gestern Abend gefunden. Eine Gruppe von Fatah-Leuten hat ihrer Forderung nach Taxi-Lizenzen mit Schüssen in die Luft Nachdruck verliehen. Die Lizenzen waren ihnen von der Verwaltung versprochen worden, Hamas hat die Ausführung gestoppt. Nicht etwa, so sagen Beobachter, weil sie selbst ihre Leute mit Lizenzen versorgen wollen, sondern um dem alles erstickenden Filz der Korruption zu Leibe zu rücken. Dafür sind sie gewählt worden, sagen Beobachter.