9punkt - Die Debattenrundschau
Ein Ort fast unbegrenzter Möglichkeiten
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
05.06.2023. In Zeit online fragt die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger, was aus Demokratie werden soll, wenn jeder nur um seine individuelle Differenz besorgt ist. Im Tagesspiegel denkt auch die italienische Philosophin Donatella Di Cesare über Demokratie nach: Verschwörungstheorien entstehen, wenn Macht gesichtslos wird, fürchtet sie. Die NZZ sieht sich in der heimlichen Kulturhauptstadt Europas um: Chisinau. Was soll man davon halten, wenn ausgerechnet Silicon-Valley-Größen vor Künstlicher Intelligenz warnen, fragen FAZ und Welt.
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
05.06.2023
finden Sie hier
Ideen
 Im Interview mit Zeit online (und in ihrem Buch "Zumutung Demokratie") denkt die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger darüber nach, warum Demokratie hierzulande immer stärker als Kränkung empfunden wird: "Überall geht es heute darum, besonders, hervorgehoben, individuell und irgendwie anders zu sein. Ziel ist das bestmögliche Ich, das sich von den anderen unterscheidet. Die Demokratie verspricht uns dabei, dass wir das alles dürfen. Und trotzdem legt sie uns die Zumutung auf, dass wir, wenn es ums demokratische Entscheiden geht, eben nicht individuell sind und es nicht darum geht, wie einzigartig wir sind, sondern dass wir alle gleich sind und dass meine Stimme, so großartig ich sie auch finde, im demokratischen Prozess nicht mehr oder weniger wert ist als jede andere auch." Um das Gemeinschaftsgefühl wieder zu stärken, wünscht sie sich mehr "anthropologische Orte", wie die Eckkneipe oder die Bibliothek, in der Menschen aus allen Milieus "gefahrlos miteinander in Kontakt treten" können.
Im Interview mit Zeit online (und in ihrem Buch "Zumutung Demokratie") denkt die Verfassungsrechtlerin Sophie Schönberger darüber nach, warum Demokratie hierzulande immer stärker als Kränkung empfunden wird: "Überall geht es heute darum, besonders, hervorgehoben, individuell und irgendwie anders zu sein. Ziel ist das bestmögliche Ich, das sich von den anderen unterscheidet. Die Demokratie verspricht uns dabei, dass wir das alles dürfen. Und trotzdem legt sie uns die Zumutung auf, dass wir, wenn es ums demokratische Entscheiden geht, eben nicht individuell sind und es nicht darum geht, wie einzigartig wir sind, sondern dass wir alle gleich sind und dass meine Stimme, so großartig ich sie auch finde, im demokratischen Prozess nicht mehr oder weniger wert ist als jede andere auch." Um das Gemeinschaftsgefühl wieder zu stärken, wünscht sie sich mehr "anthropologische Orte", wie die Eckkneipe oder die Bibliothek, in der Menschen aus allen Milieus "gefahrlos miteinander in Kontakt treten" können.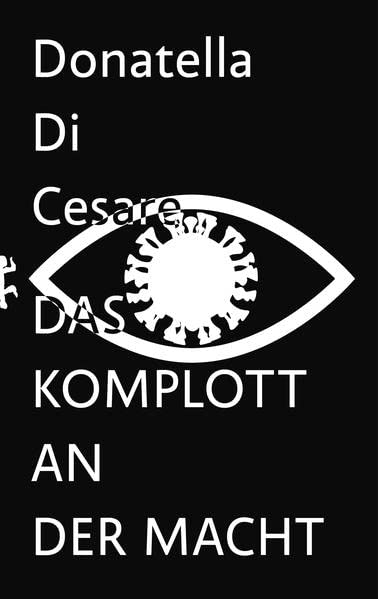 Im Gespräch mit dem Tagesspiegel denkt auch die italienische Philosophin Donatella Di Cesare über Demokratie nach, der immer mehr Verschwörungstheoretiker misstrauen (Sie hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, "Das Komplott an der Macht"). Stigmatisierung nützt da gar nichts, meint sie, viele wissen einfach nicht mehr, wer wofür verantwortlich ist: "Bis vor ein paar Jahren war die Macht eine recht konkrete Instanz: Für uns in Italien war es die Regierung in Rom. Aber an wen soll ich mich heute wenden? Rom verweist einen in vielen Punkten an Brüssel, Brüssel verweist auf größere globale Zusammenhänge und Zwänge. Zugleich wirkt sich die reale Macht konkret auf das Leben der Menschen aus. Sie kriegen täglich eine Ökonomie mit empörender Ungleichheit zu spüren. Doch wer die Verhältnisse ändern will, hört: Es gibt keine Alternative. Daher fühlen sich die Leute desorientiert und sehen keinen Fortschritt mehr. Sie empfinden die Demokratie als eine Täuschung. Aus dieser Ohnmacht und Entpolitisierung entsteht ein Komplottismus, der ständig fragt, wer im Hintergrund die Fäden zieht und Vorstellungen von einem 'Deep State' und einer 'Neuen Weltordnung' entwickelt."
Im Gespräch mit dem Tagesspiegel denkt auch die italienische Philosophin Donatella Di Cesare über Demokratie nach, der immer mehr Verschwörungstheoretiker misstrauen (Sie hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, "Das Komplott an der Macht"). Stigmatisierung nützt da gar nichts, meint sie, viele wissen einfach nicht mehr, wer wofür verantwortlich ist: "Bis vor ein paar Jahren war die Macht eine recht konkrete Instanz: Für uns in Italien war es die Regierung in Rom. Aber an wen soll ich mich heute wenden? Rom verweist einen in vielen Punkten an Brüssel, Brüssel verweist auf größere globale Zusammenhänge und Zwänge. Zugleich wirkt sich die reale Macht konkret auf das Leben der Menschen aus. Sie kriegen täglich eine Ökonomie mit empörender Ungleichheit zu spüren. Doch wer die Verhältnisse ändern will, hört: Es gibt keine Alternative. Daher fühlen sich die Leute desorientiert und sehen keinen Fortschritt mehr. Sie empfinden die Demokratie als eine Täuschung. Aus dieser Ohnmacht und Entpolitisierung entsteht ein Komplottismus, der ständig fragt, wer im Hintergrund die Fäden zieht und Vorstellungen von einem 'Deep State' und einer 'Neuen Weltordnung' entwickelt."Außerdem: In der NZZ würdigt die Wirtschaftsphilosophin Karen Horn den schottischen Aufklärer und Ökonom Adam Smith zum 300. Geburtstag.
Europa
Rada Leu und Jörg Scheller haben sich für die NZZ in der moldauischen Hauptstadt Chisinau umgesehen, die sich gerade zur heimlichen Kulturhauptstadt Europas mausert - jedenfalls für ukrainische Künstler. Das hat auch damit zu tun, dass die freie Kulturszene in Moldau staatlich kaum unterstützt wird und deshalb schon lange nach dem "Prinzip der Graswurzel-Revolution" arbeitet: "Fehlende Unterstützung bedeutet auch weniger Abhängigkeit. So ist Chisinau, eine Stadt, die in den Augen vieler westlicher Beobachter synonym für 'Probleme' steht, für Exilanten zu einem Ort der Freiheit geworden: 'Für mich ist Chisinau ein Ort fast unbegrenzter Möglichkeiten', sagt Dmitri Ermalowitsch-Daschtschinski, der das künstlerisch-kulturelle Programm des 'Queer Café' kuratiert. Als der Theaterwissenschafter das weißrussische Minsk verlassen musste, fiel es ihm schwer, in EU-Ländern Arbeit zu finden. 'Ich stand vor verschlossenen Türen, bis ich nach Chisinau kam. Hier kann ich meine Expertise jenseits der Universität einbringen: Ich organisiere Lesungen, zeige seltenes Filmmaterial über die osteuropäische LGBTQ+-Community, leite einen Klub, der sich der polnischen Kultur widmet. Als Migrant kann ich sonst nirgends vergleichbare Veranstaltungen durchführen.'"
Sigmar Gabriel war als Wirtschafts- und Außenminister und Kumpel Gerhard Schröders einer der wichtigsten proputinistischen Politiker in der Regierung Merkel. FAZ-Autor Christian Geyer beobachtet seine Selbstrechtfertigungsversuche bei einer Vorstellung des neuen Buchs von Rüdiger von Fritsch, wo Gabriel versucht zu behaupten, man habe nach 2014 Fehler aus der Zeit davor reparieren wollen: "Die künstliche Trennung in eine dämliche Politik vor 2014 und eine verantwortungsethische Auslöffel-Politik nach 2014, die dann nur danach trachten konnte, Schlimmeres zu verhüten - dieses deterministische Gabriel-Narrativ, in dem er selbst eine manierliche Figur abgibt, ist kurios, aber Gabriel kommt bei der Darstellung desselben jedes Mal richtig in Fahrt."
Sigmar Gabriel war als Wirtschafts- und Außenminister und Kumpel Gerhard Schröders einer der wichtigsten proputinistischen Politiker in der Regierung Merkel. FAZ-Autor Christian Geyer beobachtet seine Selbstrechtfertigungsversuche bei einer Vorstellung des neuen Buchs von Rüdiger von Fritsch, wo Gabriel versucht zu behaupten, man habe nach 2014 Fehler aus der Zeit davor reparieren wollen: "Die künstliche Trennung in eine dämliche Politik vor 2014 und eine verantwortungsethische Auslöffel-Politik nach 2014, die dann nur danach trachten konnte, Schlimmeres zu verhüten - dieses deterministische Gabriel-Narrativ, in dem er selbst eine manierliche Figur abgibt, ist kurios, aber Gabriel kommt bei der Darstellung desselben jedes Mal richtig in Fahrt."
Internet
Einigermaßen amüsiert liest FAZ-Autor Christopher Lauer, ehemals eine der prominenteren Figuren der Piratenpartei, den offenen Brief, in dem ausgerechnet Elon Musk und mit ihm George Dyson, Steve Wozniak und Yuval Noah Harari eine Aussetzung der Entwicklung Künstlicher Intelligenz fordern. Im Brief stellen die Autoren einige Fragen. Und "bei der letzten Frage drängt sich der Verdacht auf, dass einige der Unterzeichner, die ja teilweise tatsächlich sehr klug sind, den unterzeichneten offenen Brief gar nicht gelesen haben. Die Frage lautet, ob wir das Risiko eingehen sollen, die Kontrolle über unsere Zivilisation zu verlieren. Die Frage wäre allerdings, wann wir jemals die Kontrolle darüber hatten. Hätten wir sie, würden wir doch in einem Utopia ohne Leid und Elend wohnen."
Auch Adrian Lobe ist in der Welt eher skeptisch, vor allem, weil die Zukunftsangst ausgerechnet von Protagonisten des Silicon Valley betrieben wird. "Das Geraune über KI steht daher im Verdacht, eine PR-Strategie zu sein: Das Sprechen über KI als Vernichtungswaffe macht eine Technik womöglich mächtiger als sie tatsächlich ist. Der Technologiewissenschaftler Lee Vinsel hat das mal treffend als 'criti-hype' bezeichnet: Man baut einfach eine monströse Drohkulisse auf, um dann mit vermeintlichen technologischen 'Lösungen' Kasse zu machen."
Auch Adrian Lobe ist in der Welt eher skeptisch, vor allem, weil die Zukunftsangst ausgerechnet von Protagonisten des Silicon Valley betrieben wird. "Das Geraune über KI steht daher im Verdacht, eine PR-Strategie zu sein: Das Sprechen über KI als Vernichtungswaffe macht eine Technik womöglich mächtiger als sie tatsächlich ist. Der Technologiewissenschaftler Lee Vinsel hat das mal treffend als 'criti-hype' bezeichnet: Man baut einfach eine monströse Drohkulisse auf, um dann mit vermeintlichen technologischen 'Lösungen' Kasse zu machen."
Geschichte
Hubertus Knabe erinnert auf einer Seite in der FAZ an die "ungewöhnliche Kraft" des Aufstandes vom 17. Juni 1953, dessen nähere Umstände heute weitgehend vergessen seien. Er sichtet alte Fotos und zeigt, wie weit die Aufständischen vor allem in Provinzstädten vorgedrungen waren, wo sie teilweise die Rathäuser besetzten und politische Gefangene freiließen. Aber der Aufstand werde bis heute von seiner Zerschlagung her gesehen. Und "selbst Geschichtslehrer können meist keinen einzigen Aufständischen mit Namen nennen". Der siebzigste Jahrestag wird wohl der letzte sein, wo das Gedenken einigermaßen konkret wird, vermutet Knabe. Hierfür macht er auch den Einigungsvertrag verantwortlich: "Dort wurde 1990 festgelegt, den 17. Juni als Nationalfeiertag abzuschaffen und den 3. Oktober an dessen Stelle zu setzen. Eine ganze Generation ist seitdem herangewachsen, die sich niemals die Frage stellen musste, warum an diesem Tag Schulen und Geschäfte geschlossen sind. Mindestens ebenso relevant sind freilich auch die Versäumnisse von Politik, Schulen und Medien bei der Aufgabe, das historische Erbe zu pflegen. Das Beispiel der Geschwister Scholl zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, ein weit zurückliegendes Ereignis auch ohne Feiertag im kollektiven Gedächtnis zu verankern."
Politik
Der Sudan wird zum "Failed State". Das hätte nicht so sein müssen. Der Norden wiederholte die Fehler, die er bei kollabierenden Staaten in Afrika schon häufiger machte, schreibt Dominic Johnson in der taz: "Bevor Somalia 1991 in Flammen aufging, wäre es möglich gewesen, mit zivilen Kräften eine Neugründung des Staatswesens zu diskutieren und einen Ausweg aus dem Krieg zu entwickeln. Damals war die Welt aber gerade mit dem US-Golfkrieg zur Befreiung des von Irak besetzten Kuwait abgelenkt... 2023 geht Sudan in Flammen auf, und auch heute ist die Welt abgelenkt, diesmal von Russlands Krieg in der Ukraine. Es wäre auch in Sudan möglich gewesen, mit den zivilen Kräften des Landes eine demokratische Neuordnung auf den Weg zu bringen. Stattdessen wurden international Generäle zu Gesprächspartnern erklärt. Plötzlich sind sie Todesbringer. Das waren sie vorher schon, aber nur für Sudanesen, also zählte das international nicht."
Religion
Bald ist Deutscher Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Reinhard Bingener erzählt in einem Hintergrundartikel für die FAS die Geschichte der Institution, die ihr heutiges Gesicht mit der Friedensbewegung in den Achtzigern bekam. Eine der Protagonistinnen dieser Strömungen, Margot Käßmann, deren Bibelstunden einst der zuverlässigste Publikumsmagnet der Kirchentage war, wird allerdings diesmal nicht kommen. Sie hat sogar angekündigt, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, wohl auch ein bisschen eingeschnappt nach Kritik, denn sie hatte den Aufruf von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht mit unterschrieben. Selbst in der evangelischen Kirche wird der einstige Pazifismus nicht mehr so gern gesehen, der lange zum positiven Selbstbild gehörte: "Zur Sehnsucht nach Frieden und der Solidarität mit den Unterdrückten in aller Welt gehörten allerdings blinde Flecken: Die westdeutsche Friedensbewegung war nicht nur von einem tief sitzenden Antiamerikanismus durchzogen, sondern auch von Geheimdiensten aus dem Osten unterwandert. Auch eine linkssektiererische Israelkritik machte sich damals breit. Beide Strömungen sind bis heute in Nischen der evangelischen Kirche präsent und personell eng miteinander verflochten. "
Medien
Wie geht's eigentlich dem Gonzo-Journalismus in Zeiten von Social Media, fragt Daniel Haas in der NZZ nach der Pleite von Vice Media und blickt zurück auf eine Geschichte mit Höhen und Tiefen.
Kommentieren







