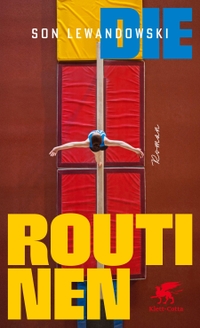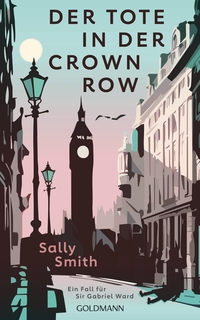Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 6. Tag
Von Thekla Dannenberg, Ekkehard Knörer, Christoph Mayerl
13.02.2008. Wie Federball im Krieg: Yoji Yamadas "Kabei". Erklärt die feinen Unterschiede zwischen krimineller und legaler Folter: Errol Morris' Dokumentarfilm "Standard Operating Procedure". Kichert alles nieder: Mike Leighs "Happy Go Lucky". Beschreibt die Komödie der männlichen Existenz: Hong Sangsoos "Nacht und Tag". Miss-Helden in Leipzig: Gunther Scholz findet sie in "Sag mir, wo die Schönen sind..." Solidarisches Verzweiflungsidyll: Yoji Yamadas "Kabei - Our Mother" (Wettbewerb)
 Tokio im Jahr 1940, Japan im Krieg mit China und vor dem Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte bald darauf. Der Germanist Shigeru Nogami (Mitsugoro Bando) hat sich in seinen Schriften nicht nationalistisch genug gezeigt. Erst bekommt er Ärger mit der Zensur, dann wird er abgeholt, des Landesverrats angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Zurück bleibt seine Familie: seine Frau Kayo (Sayuri Yoshinaga) und die zwei Töchter.
Tokio im Jahr 1940, Japan im Krieg mit China und vor dem Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte bald darauf. Der Germanist Shigeru Nogami (Mitsugoro Bando) hat sich in seinen Schriften nicht nationalistisch genug gezeigt. Erst bekommt er Ärger mit der Zensur, dann wird er abgeholt, des Landesverrats angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Zurück bleibt seine Familie: seine Frau Kayo (Sayuri Yoshinaga) und die zwei Töchter.
Sie machen ihm keinen Vorwurf, sie verbünden sich zum solidarischen Verzweiflungsidyll. Erzählt wird der Film - es liegt eine autobiografische Kurzgeschichte zugrunde - aus der Perspektive der jüngsten Tochter, deren sonore Erwachsenen-Erzählstimme sich immer wieder über und unter die Bilder legt. Zum Haushalt gehören noch die attraktive junge Schwester der Mutter, recht bald auch Yama (Tadanobu Asano) ein Ex-Student von Professor Nogami, der ihm, schnell aber auch der Frau Nogami in Verehrung und Liebe ergeben ist. Klaviermusik klimpert. Nicht unangenehm sind die Farben der Bilder aus dem Studio, das ein bisschen was von einem Puppenhaus hat. Spätestes wenn es wieder mal schneit, legt sich die Melancholie sanft aufs Gemüt. "Kabei" ist ein Film über schreckliche Zeiten, der zwar, versteht sich, traurig ist, aber - außer möglicherweise ein paar japanischen Rechten - niemandem weh tut.
 Die Art, wie Yoji Yamada, in den letzten Jahren aus schwer erfindlichen Gründen ständiger Gast im Berlinale-Wettbewerb, Filme macht, kann man altmodisch nennen oder einfach verschnarcht. Da "stimmt" jede Geste, kein Gefühl ist zuviel und kein Wort ist zuwenig. Das ist alles angenehm flauschig, unauffällig rausgeputzt und aufgeräumt und auf den ersten Blick vertraut, weil tausendundeinmal gesehen. Wenn eine Todesnachricht kommt, muss, des Kontrasts wegen, vorher Federball gespielt werden. (Als Zuschauer weiß man natürlich, dass, wenn da jetzt mitten im Krieg Federball gespielt wird, gleich die Todesnachricht kommt. So ist das mit dem ganzen Film.) Nicht fehlen darf ein lauter Onkel mit schlechten Manieren der sorgt für Comic Relief. "Kabei" ist kein schlechter, kein böser, kein ärgerlicher Film. Er ist nur von erlesener Gedankenlosigkeit, betulich und konventionell. Kein Wunder, dass das Schnarchgeräusch vom Nebensitz lauter ist als alles, was man während des Films zu hören bekommt.
Die Art, wie Yoji Yamada, in den letzten Jahren aus schwer erfindlichen Gründen ständiger Gast im Berlinale-Wettbewerb, Filme macht, kann man altmodisch nennen oder einfach verschnarcht. Da "stimmt" jede Geste, kein Gefühl ist zuviel und kein Wort ist zuwenig. Das ist alles angenehm flauschig, unauffällig rausgeputzt und aufgeräumt und auf den ersten Blick vertraut, weil tausendundeinmal gesehen. Wenn eine Todesnachricht kommt, muss, des Kontrasts wegen, vorher Federball gespielt werden. (Als Zuschauer weiß man natürlich, dass, wenn da jetzt mitten im Krieg Federball gespielt wird, gleich die Todesnachricht kommt. So ist das mit dem ganzen Film.) Nicht fehlen darf ein lauter Onkel mit schlechten Manieren der sorgt für Comic Relief. "Kabei" ist kein schlechter, kein böser, kein ärgerlicher Film. Er ist nur von erlesener Gedankenlosigkeit, betulich und konventionell. Kein Wunder, dass das Schnarchgeräusch vom Nebensitz lauter ist als alles, was man während des Films zu hören bekommt.
Ekkehard Knörer
Yoji Yamada: "Kabei - Our Mother". Mit Sayuri Yoshinaga, Mitsugoro Bando, Tadanobu Asano, Rei Dan. Japan 2007, 132 Minuten. (Alle Termine)
Erklärt die feinen Unterschiede zwischen krimineller und legaler Folter: Errol Morris' Dokumentarfilm "Standard Operating Procedure" (Wettbewerb)
"Die Bilder sagen alles", schrieb Seymour Hersh in seinem legendären Artikel im New Yorker, in dem er im Mai 2004 den Folterskandal von Abu Ghraib öffentlich machte. Die Bilder von Charles A. Graner, Ivan Frederick und Sabrina Harman halten alles fest, was den irakischen Gefangenen im amerikanischen Militärgefängnis angetan wurde, wie sie körperlich misshandelt und sexuell gedemütigt, gefoltert und getötet wurden.
"Ohne die Bilder hätte es keinen Skandal gegeben", sagt einer der beteiligten Soldaten. Errol Morris' Dokumentation "Standard Operating Procedure" zeigt, wie Recht er damit hat. Und wie falsch er liegt. Dafür hat Morris die beteiligten Soldaten und Soldatinnen interviewt, natürlich Lynndie England, Sabrina Harman und Megan Ambuhl, die zuständige Generalin Jane Karpinski, den Militärermittler Scott Bobeck und einen Verhörspezialisten (Die Haupttäter Graner und Frederick sehen wir nicht). Während sie vor einer grauen Wand erklären, warum sie sich wie verhalten haben, während sie sich rechtfertigen, entschuldigen und Verständnis heischen, sehen wir in immer wiederkehrender Abfolge die mal mehr mal weniger bekannten, Fotografien und Videos. Dazwischen sehr stilisierte nachgestellte Szenen, die in ihrer nichtssagenden Dramatik einen peinlichen Kontrast zu den Fotos darstellen, um die es geht.
Was wir hier erfahren, ist alles nicht neu. Richtig interessant sind in dem Film die Aussagen von Scott Bobeck, dem Ermittler der US-Armee: "Natürlich hast Du ein Problem, wenn Du den Präsidenten dazu zwingst, sich vor der Welt zu entschuldigen", sagt er. Das große Unrecht, das die Soldaten begangen haben, war, sich erwischen zu lassen. Also liegen die 19- und 20-jährigen Gefreiten und Sergeants nicht so falsch, wenn sie sich zum Sündenbock für eine in den Militärgefängnissen übliche Praxis abgestempelt sehen. Die Gefangenen sollten eingeschüchtert und unter Druck gesetzt werden. Die beiden Getöteten, die die Fotos auch zeigen, gehen nicht auf ihr Konto, sie sind während eines Verhörs ums Leben gekommen. Dabei waren ganz andere Behörden am Werke.
Und dann erklärt Ermittler Bobeck, auf welchen Fotos nach Armee-Maßstäben Misshandlungen festgehalten sind und auf welchen lediglich "Standard Operating Procedures". Kriminell ist es demnach, Männer zum Masturbieren zu zwingen oder sie nackt aufeinander zu stapeln. Dem Standard-Prozedere entspricht es, Gefangene stehend mit Handschellen an Etagenbetten zu ketten, ihnen Frauenslips über den Kopf zu ziehen und ihnen so tagelang den Schlaf zu entziehen. Es ist auch kein Vergehen, einem Mann eine Kapuze über den Kopf zu ziehen, ihn zum Schein elektrisch zu verkabeln und mit der Hinrichtung zu drohen.
"Standard Operating Procedure" ist der erste Dokumentarfilm überhaupt, der je im Wettbewerb gezeigt wurde. Dass ihm ein solch hervorgehobener Platz eingeräumt wurde, verwundert, auch dass er in der Konkurrenz läuft. Wie soll das gehen? In welcher Kategorie? Soll Lynndie England einen Silbernen Bären bekommen? Für die beste Darstellung oder für die beste Kamera?
Thekla Dannenberg
Errol Morris: "Standard Operating Procedure". USA 2008, 118 Minuten. (Alle Termine)
Kichert alles nieder: Mike Leighs "Happy Go Lucky" (Wettbewerb)
 Wer in England Lotto spielt, unterstützt unweigerlich auch den einen oder anderen einheimischen Film. Mit Mike Leigh hat die Lottogesellschaft diesmal leider eine Niete gezogen. Wirklich schlimm ist, dass "Happy-go-lucky" an manchen Stellen durchaus glänzt. Leigh schreibt Dialoge voller Esprit und Wortwitz, und die Nebenfiguren sind mit Sorgfalt und Sympathie entwickelt.
Wer in England Lotto spielt, unterstützt unweigerlich auch den einen oder anderen einheimischen Film. Mit Mike Leigh hat die Lottogesellschaft diesmal leider eine Niete gezogen. Wirklich schlimm ist, dass "Happy-go-lucky" an manchen Stellen durchaus glänzt. Leigh schreibt Dialoge voller Esprit und Wortwitz, und die Nebenfiguren sind mit Sorgfalt und Sympathie entwickelt.
"Da es sich oft um typisierte Figuren handelt, treten sie dem Publikum weniger plastisch entgegen als die Hauptfiguren", heißt es bei den Literaturwissenschaftlichen Begriffen online. Das Problem ist nun, dass es hier nur Nebenfiguren gibt, zum Teil recht extreme Charaktere. Nur sieht man leider die extremste von allen, eine dauerkichernde Grundschullehrerin aus London, die unbedingt die britische Amelie sein möchte, fast volle zwei Stunden lang. Denn sie ist Leighs Hauptfigur.
Pauline ist ihr Name. Aber natürlich ruft man sie Poppy.
Was hätte man mit Leighs Talent alles anstellen können? Und dann so ein Film, in dem man die ganze Zeit denkt, jetzt muss doch der Schicksalsschlag kommen und Poppy mit den ernsteren Dingen des Lebens konfrontieren. Doch jede Chance streicht ungenutzt vorbei, und die dreißigjährige Poppy kichert am Ende ebenso grenzdebil wie zu Beginn. Entwickelt hat sich nichts während der zwei Stunden. Ach ja, es gibt einen unglücklich verliebten Fahrlehrer und einen glücklich verliebten Sozialarbeiter mehr. Entwickelt hat sich nur eine Aversion gegen eine zurückgebliebene Dreißigjährige.
Leigh wird auf der Berlinale-Seite tragischerweise auch noch mit einem Vorsatz zitiert, den er gerade mit seinem neuen Werk so gar nicht mehr einhalten kann. "In meinen Filmen möchte ich eine Welt schaffen, die genauso wahrhaftig ist, etwas, das so dreidimensional und echt aussieht, dass man mit dem Messer reinstechen möchte."
 "Happy-go-lucky" tauchte im Kino wohl 1922 zum ersten Mal auf, bei Robert J. Flahertys Dokumentarfilm "Nanook of the North". Und ebenso wie es schon im ersten Dokumentarfilm der Welt unglaubwürdig war, die Inuit als "happy-go-lucky people", als unbekümmertes Volk zu bezeichnen, ist anzunehmen, dass in der Londoner Finsbury Road eine Alien-Frau wohnt, die sich Hühnerfilets in den BH steckt, in ihrer Garderobe nur Quietschgrün oder Knallrosa kennt und ansonsten alles niederkichert, was nicht bei Drei auf dem Baum ist.
"Happy-go-lucky" tauchte im Kino wohl 1922 zum ersten Mal auf, bei Robert J. Flahertys Dokumentarfilm "Nanook of the North". Und ebenso wie es schon im ersten Dokumentarfilm der Welt unglaubwürdig war, die Inuit als "happy-go-lucky people", als unbekümmertes Volk zu bezeichnen, ist anzunehmen, dass in der Londoner Finsbury Road eine Alien-Frau wohnt, die sich Hühnerfilets in den BH steckt, in ihrer Garderobe nur Quietschgrün oder Knallrosa kennt und ansonsten alles niederkichert, was nicht bei Drei auf dem Baum ist.
Wie gesagt Nebenfiguren sind Leighs Stärke. Die resolute Flamenco-Lehrerin, die ihrem Mann die Eier abreißen will. Der cholerische Fahrlehrer, der seinen Rückspiegel nach einem Engel Enrahah nennt. Und ja, die Dialoge: "Willst Du noch ein Baby?" - "Danke, ich hatte gerade einen Döner." Das ist witzig! Aber all diese Perlen gehen verloren, sie werden von einem unaufhörlichen Rinnsal nihilistischen Gekichers weggespült.
Poppy heißt Mohn. Aus Mohn macht man Opium. Vielleicht ist das ja Mike Leighs subtiler Protest gegen Drogenmissbrauch. Oder Afghanistan? Interpretationen, die Leighs geheimes Motiv erläutern, werden dankend entgegengenommen.
Christoph Mayerl
Mike Leigh: "Happy-Go-Lucky". Mit Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Eddie Marsan. Großbritannien 2007, 118 Minuten. (Alle Termine)
Beschreibt die Komödie der männlichen Existenz: Hong Sangsoos "Nacht und Tag" (Wettbewerb)
 Sung-nam (Kim Youngho) ist Maler, lebt in Seoul, kifft das erste Mal in seinem Leben, die Polizei erfährt davon; er flieht überstürzt nach Paris. Das erzählt sehr lakonisch der Vorspann. Im ersten Bild ist Sung-nam schon in Frankreich, steht mit nicht mehr als einem Köfferchen vor der Flughafentür und seine erste - und fast schon die letzte - Begegnung mit einem Franzosen: Der bittet Sung-nam um Feuer, sagt nur "Sei vorsichtig" und ist wieder weg. (Natürlich ist Sung-nam nicht vorsichtig. Und geraucht wird im ganzen Film viel. Getrunken natürlich, dies ist ein Hong-Sangsoo-Film, auch.)
Sung-nam (Kim Youngho) ist Maler, lebt in Seoul, kifft das erste Mal in seinem Leben, die Polizei erfährt davon; er flieht überstürzt nach Paris. Das erzählt sehr lakonisch der Vorspann. Im ersten Bild ist Sung-nam schon in Frankreich, steht mit nicht mehr als einem Köfferchen vor der Flughafentür und seine erste - und fast schon die letzte - Begegnung mit einem Franzosen: Der bittet Sung-nam um Feuer, sagt nur "Sei vorsichtig" und ist wieder weg. (Natürlich ist Sung-nam nicht vorsichtig. Und geraucht wird im ganzen Film viel. Getrunken natürlich, dies ist ein Hong-Sangsoo-Film, auch.)
Sung-nam führt Tagebuch und das gibt dem Film die Form einzelner Notizen. Die Kapitel sind unterschiedlich lang und durch Datumsangaben getrennt. Die Stimmungen schwanken, es kommt zu Begegnungen, es gibt Ellipsen und Sprünge und Sung-nam ist das Ich, mit dem der Film uns nachhaltiger noch als mit all den anderen Männern in den Filmen des koreanischen Regisseurs konfrontiert. Sung-nam ist ein typischer Hong Sangsoo-Mann: Ein Künstler, narzisstisch. Einer, der sich mit Frauen einlässt und ihnen das Blaue und die Wolken vom Himmel verspricht, um sich im nächsten Moment um alles zu drücken. Einer, der große Worte macht und ihnen keine oder bestenfalls kleine Taten folgen lässt. Einer, das bringt ihn offenkundig am klarsten auf den Punkt, der so wenig Kontrolle hat über sich und sein Leben, dass er immerzu unfreiwillig Frauen schwängert. Darum glaubt er an einer wichtigen Stelle des Films die Lüge, es sei mal wieder eine Frau von ihm schwanger, umstandslos.
 In dieser Differenz, ja, dem grundsätzlichen Widerspruch zwischen Reden und Handeln sieht Hong Sangsoo die Tragödie, vielleicht auch die Komödie der männlichen Existenz. Zwischen beidem, Tragik und Komik, ist so recht bei ihm schon immer nicht zu unterscheiden; vieles ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist, vieles, das lustig ist, eigentlich traurig. So will es der Zufall, dass Sung-nam mitten auf der Straße in Paris eine Koreanerin zuwinkt. Er ist erstaunt - oder tut jedenfalls so. (Man kann ihm da wirklich nicht trauen, dieser Ich-Erzähler ist notorisch unzuverlässig.) Er erkennt sie nicht, behauptet er, sie kann es nicht fassen. Das begreift man, wenn man gleich darauf erfährt, dass die beiden lange Jahre zusammen waren, einst in Korea. "Weißt du, wie viele Abtreibungen ich deinetwegen hatte", fragt sie ihn. Er blickt sie mit großen Augen an. "Sechs", sagt sie. "Ist das dein Ernst?" fragt er. Womöglich ja.
In dieser Differenz, ja, dem grundsätzlichen Widerspruch zwischen Reden und Handeln sieht Hong Sangsoo die Tragödie, vielleicht auch die Komödie der männlichen Existenz. Zwischen beidem, Tragik und Komik, ist so recht bei ihm schon immer nicht zu unterscheiden; vieles ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist, vieles, das lustig ist, eigentlich traurig. So will es der Zufall, dass Sung-nam mitten auf der Straße in Paris eine Koreanerin zuwinkt. Er ist erstaunt - oder tut jedenfalls so. (Man kann ihm da wirklich nicht trauen, dieser Ich-Erzähler ist notorisch unzuverlässig.) Er erkennt sie nicht, behauptet er, sie kann es nicht fassen. Das begreift man, wenn man gleich darauf erfährt, dass die beiden lange Jahre zusammen waren, einst in Korea. "Weißt du, wie viele Abtreibungen ich deinetwegen hatte", fragt sie ihn. Er blickt sie mit großen Augen an. "Sechs", sagt sie. "Ist das dein Ernst?" fragt er. Womöglich ja.
Min-Sun (Kim Youjin) ist jetzt verheiratet in Paris, die beiden gehen trotzdem gemeinsam auf ein Hotelzimmer, wo Sung-nam wie ein Wahnsinniger die Bibel zitiert, da, wo sie vor Ehebruch warnt. Darum schlafen die beiden - wahrscheinlich - nicht miteinander. (Man kann dem Film da nicht unbedingt trauen, der zur Trennung von Traum und Realität nicht die eindeutigste Haltung hat.) Auf einer Party von Koreanern begegnet Sung-nam einer weiteren Frau. Hyun-ju studiert Kunst, sie nimmt ihn mit ins Musee d'Orsay, wo sie lange Courbets "Ursprung der Welt" betrachten. Hyun-ju (Seo Minjeong) hat eine Mitbewohnerin, Yu-jeong (Park Eunhye), in deren Füße sich Sung-nam sehr verliebt. Zuhause in Korea freilich wartet Sung-nams Frau, sie telefonieren täglich, wenn es in Paris Nacht ist, ist es in Seoul Tag. "Kannst du für mich masturbieren", bittet er sie einmal. (Jedenfalls wird sie davon gewiss nicht schwanger. Obwohl...)
 Der Film "Nacht und Tag" erzählt von diesem koreanischen Mann und all diesen koreanischen Frauen in der französischen Fremde, aber er tut dies in der vertrauten Hong-Manier. Zum einen heißt das: Hong Sangsoo hat sich Paris ganz und gar angeeignet, es sieht aus wie Seoul aussieht, wenn Hong Will es filmt: recht starre, die Distanz eher als die Nähe zur Figur suchende Einstellungen; immer etwas überdeutliche Schwenks; seltsame Zooms als Unterstreichungsgesten. Und zum anderen heißt es auch: Alles Lineare täuscht. Das Erzählen vollzieht sich in - teils aller Wahrscheinlichkeit spottenden - Motivwiederholungen und Sprüngen der Dinge durch Zeit und Raum. Wenig ist eindeutig, vieles auf Sand gebaut, schon gar, wenn sich die Geschichte auf die Ich-Perspektive eines Kerls wie Sung-nam einlässt. Manches doppelt sich, auf irritierende Weise. Die Zeichnung eines doppelköpfigen Kalbs spielt eine gewisse Rolle. Ein Spatz fällt aus dem Nest und später taucht ein weiterer Spatz auf. (Was ist das überhaupt mit den Spatzen in diesem Jahr? Jetzt schon der dritte Wettbewerbsfilm mit Spatz an wichtiger Stelle.) Mehr als einmal sieht man Bilder von Wolken, zum Beispiel am Ende, das auf seine Weise ein Happy Ending ist. Aber es ist eines der gemeinsten Happy Endings der Welt. Das glückliche Leben: ein Alptraum.
Der Film "Nacht und Tag" erzählt von diesem koreanischen Mann und all diesen koreanischen Frauen in der französischen Fremde, aber er tut dies in der vertrauten Hong-Manier. Zum einen heißt das: Hong Sangsoo hat sich Paris ganz und gar angeeignet, es sieht aus wie Seoul aussieht, wenn Hong Will es filmt: recht starre, die Distanz eher als die Nähe zur Figur suchende Einstellungen; immer etwas überdeutliche Schwenks; seltsame Zooms als Unterstreichungsgesten. Und zum anderen heißt es auch: Alles Lineare täuscht. Das Erzählen vollzieht sich in - teils aller Wahrscheinlichkeit spottenden - Motivwiederholungen und Sprüngen der Dinge durch Zeit und Raum. Wenig ist eindeutig, vieles auf Sand gebaut, schon gar, wenn sich die Geschichte auf die Ich-Perspektive eines Kerls wie Sung-nam einlässt. Manches doppelt sich, auf irritierende Weise. Die Zeichnung eines doppelköpfigen Kalbs spielt eine gewisse Rolle. Ein Spatz fällt aus dem Nest und später taucht ein weiterer Spatz auf. (Was ist das überhaupt mit den Spatzen in diesem Jahr? Jetzt schon der dritte Wettbewerbsfilm mit Spatz an wichtiger Stelle.) Mehr als einmal sieht man Bilder von Wolken, zum Beispiel am Ende, das auf seine Weise ein Happy Ending ist. Aber es ist eines der gemeinsten Happy Endings der Welt. Das glückliche Leben: ein Alptraum.
Ekkehard Knörer
Hong Sangsoo: "Bam gua Nat - Nacht und Tag". Mit Kim Youngho, Park Eunhye, Hwang Soojung. Republik Korea 2008, 145 Minuten. (Alle Termine)
Miss-Helden in Leipzig: Gunther Scholz findet sie in "Sag mir, wo die Schönen sind..." (Panorama)
 Im Frühjahr 1989 rief die Leipziger Volkszeitung alle jungen Sozialistinnen auf, sich bei der Wahl zur Miss Leipzig zu beteiligen. Der Fotograf Gerhard Gäbler fotografierte zwanzig der Bewerberinnen, zu Hause und am Arbeitsplatz. Außerdem befragt er sie nach dem Grund ihres Engagements und ihren Träumen. Die damals aufgenommenen Bilder und auch die Kassetten mit den Interviews hat Gäbler immer noch, und zusammen mit dem Filmemacher Günther Scholz hat er sich zwanzig Jahre später aufgemacht, um zu sehen, was aus den Frauen geworden ist.
Im Frühjahr 1989 rief die Leipziger Volkszeitung alle jungen Sozialistinnen auf, sich bei der Wahl zur Miss Leipzig zu beteiligen. Der Fotograf Gerhard Gäbler fotografierte zwanzig der Bewerberinnen, zu Hause und am Arbeitsplatz. Außerdem befragt er sie nach dem Grund ihres Engagements und ihren Träumen. Die damals aufgenommenen Bilder und auch die Kassetten mit den Interviews hat Gäbler immer noch, und zusammen mit dem Filmemacher Günther Scholz hat er sich zwanzig Jahre später aufgemacht, um zu sehen, was aus den Frauen geworden ist.
Die Kombination von Achtzigern und DDR liefert nicht wenige Steilvorlagen, aber der in Görlitz geborene Scholz begegnet den Frauen mit viel Sympathie und Respekt, und stellt sie nicht bloß. Überraschend ist zum einen, dass die Mädchen, die höchsten fünfundzwanzig Jahre alt waren, bei den Kurzinterviews schon 1989 kein Blatt vor den Mund nahmen und sich recht deutlich über den Mangel an Konsumgütern und den Mangel an Perspektiven beschwerten. Die Misswahl sollte für einige der Ausweg sein.
Daran hat sich nicht viel geändert. Am 15. Februar ist Bewerbungsschluss für die Miss Leipzig 2008. Der Veranstalter verspricht der Gewinnerin "einen optimalen Start in eine aussichtsreiche nationale und vor allem internationale Beautykarriere". Die damalige Gewinnerin, die Scholz fast als letzte vorstellt, hat ihren persönlichen Ausweg schon gefunden. Sie hatte ein "Lichterlebnis", meditiert und befindet sich nun in ihrer letzten Reinkarnation. Miss Delitzsch war sie auch.
 Die meisten in der DDR begonnenen Lebenswege haben mit der Wende einen Einschnitt erlebt, der sie in die verschiedensten Richtungen weiterführte. Man kennt das: für die einen war 1989 ein Segen, für die anderen eher zwiespältig. Doch Scholz schafft es, dass man sich mit Neugier anhört, was mit den einzelnen Frauen geschehen ist. Dabei baut Scholz nicht auf den Sonnenallee-Effekt des real existierenden und heute teils surreal anmutenden Sozialismus, sondern auf das Interesse an echten Personen.
Die meisten in der DDR begonnenen Lebenswege haben mit der Wende einen Einschnitt erlebt, der sie in die verschiedensten Richtungen weiterführte. Man kennt das: für die einen war 1989 ein Segen, für die anderen eher zwiespältig. Doch Scholz schafft es, dass man sich mit Neugier anhört, was mit den einzelnen Frauen geschehen ist. Dabei baut Scholz nicht auf den Sonnenallee-Effekt des real existierenden und heute teils surreal anmutenden Sozialismus, sondern auf das Interesse an echten Personen.
Die Lebenswege sind wie erwartet recht unterschiedlich. Eine ist Innenarchitektin in Zürich, die andere Zimmermädchen in einem Leipziger Oberklassehotel. Eine sortiert Post in Koblenz, die andere macht PR in Dubai. Eine ist glücklich verheiratet, die andere trennt sich gerade nach achtzehn Jahren von ihrem Mann. Und so weiter. Scholz dreht unaufgeregt und mit einem sicheren Auge für die unterschiedlichen Charaktere seiner Figuren. Langer Applaus im überfüllten Kinosaal.
Christoph Mayerl
Gunther Scholz: "Sag mir, wo die Schönen sind...". Deutschland, 2007, 90 Minuten. (Alle Termine)
 Tokio im Jahr 1940, Japan im Krieg mit China und vor dem Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte bald darauf. Der Germanist Shigeru Nogami (Mitsugoro Bando) hat sich in seinen Schriften nicht nationalistisch genug gezeigt. Erst bekommt er Ärger mit der Zensur, dann wird er abgeholt, des Landesverrats angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Zurück bleibt seine Familie: seine Frau Kayo (Sayuri Yoshinaga) und die zwei Töchter.
Tokio im Jahr 1940, Japan im Krieg mit China und vor dem Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte bald darauf. Der Germanist Shigeru Nogami (Mitsugoro Bando) hat sich in seinen Schriften nicht nationalistisch genug gezeigt. Erst bekommt er Ärger mit der Zensur, dann wird er abgeholt, des Landesverrats angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Zurück bleibt seine Familie: seine Frau Kayo (Sayuri Yoshinaga) und die zwei Töchter.Sie machen ihm keinen Vorwurf, sie verbünden sich zum solidarischen Verzweiflungsidyll. Erzählt wird der Film - es liegt eine autobiografische Kurzgeschichte zugrunde - aus der Perspektive der jüngsten Tochter, deren sonore Erwachsenen-Erzählstimme sich immer wieder über und unter die Bilder legt. Zum Haushalt gehören noch die attraktive junge Schwester der Mutter, recht bald auch Yama (Tadanobu Asano) ein Ex-Student von Professor Nogami, der ihm, schnell aber auch der Frau Nogami in Verehrung und Liebe ergeben ist. Klaviermusik klimpert. Nicht unangenehm sind die Farben der Bilder aus dem Studio, das ein bisschen was von einem Puppenhaus hat. Spätestes wenn es wieder mal schneit, legt sich die Melancholie sanft aufs Gemüt. "Kabei" ist ein Film über schreckliche Zeiten, der zwar, versteht sich, traurig ist, aber - außer möglicherweise ein paar japanischen Rechten - niemandem weh tut.
 Die Art, wie Yoji Yamada, in den letzten Jahren aus schwer erfindlichen Gründen ständiger Gast im Berlinale-Wettbewerb, Filme macht, kann man altmodisch nennen oder einfach verschnarcht. Da "stimmt" jede Geste, kein Gefühl ist zuviel und kein Wort ist zuwenig. Das ist alles angenehm flauschig, unauffällig rausgeputzt und aufgeräumt und auf den ersten Blick vertraut, weil tausendundeinmal gesehen. Wenn eine Todesnachricht kommt, muss, des Kontrasts wegen, vorher Federball gespielt werden. (Als Zuschauer weiß man natürlich, dass, wenn da jetzt mitten im Krieg Federball gespielt wird, gleich die Todesnachricht kommt. So ist das mit dem ganzen Film.) Nicht fehlen darf ein lauter Onkel mit schlechten Manieren der sorgt für Comic Relief. "Kabei" ist kein schlechter, kein böser, kein ärgerlicher Film. Er ist nur von erlesener Gedankenlosigkeit, betulich und konventionell. Kein Wunder, dass das Schnarchgeräusch vom Nebensitz lauter ist als alles, was man während des Films zu hören bekommt.
Die Art, wie Yoji Yamada, in den letzten Jahren aus schwer erfindlichen Gründen ständiger Gast im Berlinale-Wettbewerb, Filme macht, kann man altmodisch nennen oder einfach verschnarcht. Da "stimmt" jede Geste, kein Gefühl ist zuviel und kein Wort ist zuwenig. Das ist alles angenehm flauschig, unauffällig rausgeputzt und aufgeräumt und auf den ersten Blick vertraut, weil tausendundeinmal gesehen. Wenn eine Todesnachricht kommt, muss, des Kontrasts wegen, vorher Federball gespielt werden. (Als Zuschauer weiß man natürlich, dass, wenn da jetzt mitten im Krieg Federball gespielt wird, gleich die Todesnachricht kommt. So ist das mit dem ganzen Film.) Nicht fehlen darf ein lauter Onkel mit schlechten Manieren der sorgt für Comic Relief. "Kabei" ist kein schlechter, kein böser, kein ärgerlicher Film. Er ist nur von erlesener Gedankenlosigkeit, betulich und konventionell. Kein Wunder, dass das Schnarchgeräusch vom Nebensitz lauter ist als alles, was man während des Films zu hören bekommt.Ekkehard Knörer
Yoji Yamada: "Kabei - Our Mother". Mit Sayuri Yoshinaga, Mitsugoro Bando, Tadanobu Asano, Rei Dan. Japan 2007, 132 Minuten. (Alle Termine)
Erklärt die feinen Unterschiede zwischen krimineller und legaler Folter: Errol Morris' Dokumentarfilm "Standard Operating Procedure" (Wettbewerb)
"Die Bilder sagen alles", schrieb Seymour Hersh in seinem legendären Artikel im New Yorker, in dem er im Mai 2004 den Folterskandal von Abu Ghraib öffentlich machte. Die Bilder von Charles A. Graner, Ivan Frederick und Sabrina Harman halten alles fest, was den irakischen Gefangenen im amerikanischen Militärgefängnis angetan wurde, wie sie körperlich misshandelt und sexuell gedemütigt, gefoltert und getötet wurden.
"Ohne die Bilder hätte es keinen Skandal gegeben", sagt einer der beteiligten Soldaten. Errol Morris' Dokumentation "Standard Operating Procedure" zeigt, wie Recht er damit hat. Und wie falsch er liegt. Dafür hat Morris die beteiligten Soldaten und Soldatinnen interviewt, natürlich Lynndie England, Sabrina Harman und Megan Ambuhl, die zuständige Generalin Jane Karpinski, den Militärermittler Scott Bobeck und einen Verhörspezialisten (Die Haupttäter Graner und Frederick sehen wir nicht). Während sie vor einer grauen Wand erklären, warum sie sich wie verhalten haben, während sie sich rechtfertigen, entschuldigen und Verständnis heischen, sehen wir in immer wiederkehrender Abfolge die mal mehr mal weniger bekannten, Fotografien und Videos. Dazwischen sehr stilisierte nachgestellte Szenen, die in ihrer nichtssagenden Dramatik einen peinlichen Kontrast zu den Fotos darstellen, um die es geht.
Was wir hier erfahren, ist alles nicht neu. Richtig interessant sind in dem Film die Aussagen von Scott Bobeck, dem Ermittler der US-Armee: "Natürlich hast Du ein Problem, wenn Du den Präsidenten dazu zwingst, sich vor der Welt zu entschuldigen", sagt er. Das große Unrecht, das die Soldaten begangen haben, war, sich erwischen zu lassen. Also liegen die 19- und 20-jährigen Gefreiten und Sergeants nicht so falsch, wenn sie sich zum Sündenbock für eine in den Militärgefängnissen übliche Praxis abgestempelt sehen. Die Gefangenen sollten eingeschüchtert und unter Druck gesetzt werden. Die beiden Getöteten, die die Fotos auch zeigen, gehen nicht auf ihr Konto, sie sind während eines Verhörs ums Leben gekommen. Dabei waren ganz andere Behörden am Werke.
Und dann erklärt Ermittler Bobeck, auf welchen Fotos nach Armee-Maßstäben Misshandlungen festgehalten sind und auf welchen lediglich "Standard Operating Procedures". Kriminell ist es demnach, Männer zum Masturbieren zu zwingen oder sie nackt aufeinander zu stapeln. Dem Standard-Prozedere entspricht es, Gefangene stehend mit Handschellen an Etagenbetten zu ketten, ihnen Frauenslips über den Kopf zu ziehen und ihnen so tagelang den Schlaf zu entziehen. Es ist auch kein Vergehen, einem Mann eine Kapuze über den Kopf zu ziehen, ihn zum Schein elektrisch zu verkabeln und mit der Hinrichtung zu drohen.
"Standard Operating Procedure" ist der erste Dokumentarfilm überhaupt, der je im Wettbewerb gezeigt wurde. Dass ihm ein solch hervorgehobener Platz eingeräumt wurde, verwundert, auch dass er in der Konkurrenz läuft. Wie soll das gehen? In welcher Kategorie? Soll Lynndie England einen Silbernen Bären bekommen? Für die beste Darstellung oder für die beste Kamera?
Thekla Dannenberg
Errol Morris: "Standard Operating Procedure". USA 2008, 118 Minuten. (Alle Termine)
Kichert alles nieder: Mike Leighs "Happy Go Lucky" (Wettbewerb)
 Wer in England Lotto spielt, unterstützt unweigerlich auch den einen oder anderen einheimischen Film. Mit Mike Leigh hat die Lottogesellschaft diesmal leider eine Niete gezogen. Wirklich schlimm ist, dass "Happy-go-lucky" an manchen Stellen durchaus glänzt. Leigh schreibt Dialoge voller Esprit und Wortwitz, und die Nebenfiguren sind mit Sorgfalt und Sympathie entwickelt.
Wer in England Lotto spielt, unterstützt unweigerlich auch den einen oder anderen einheimischen Film. Mit Mike Leigh hat die Lottogesellschaft diesmal leider eine Niete gezogen. Wirklich schlimm ist, dass "Happy-go-lucky" an manchen Stellen durchaus glänzt. Leigh schreibt Dialoge voller Esprit und Wortwitz, und die Nebenfiguren sind mit Sorgfalt und Sympathie entwickelt."Da es sich oft um typisierte Figuren handelt, treten sie dem Publikum weniger plastisch entgegen als die Hauptfiguren", heißt es bei den Literaturwissenschaftlichen Begriffen online. Das Problem ist nun, dass es hier nur Nebenfiguren gibt, zum Teil recht extreme Charaktere. Nur sieht man leider die extremste von allen, eine dauerkichernde Grundschullehrerin aus London, die unbedingt die britische Amelie sein möchte, fast volle zwei Stunden lang. Denn sie ist Leighs Hauptfigur.
Pauline ist ihr Name. Aber natürlich ruft man sie Poppy.
Was hätte man mit Leighs Talent alles anstellen können? Und dann so ein Film, in dem man die ganze Zeit denkt, jetzt muss doch der Schicksalsschlag kommen und Poppy mit den ernsteren Dingen des Lebens konfrontieren. Doch jede Chance streicht ungenutzt vorbei, und die dreißigjährige Poppy kichert am Ende ebenso grenzdebil wie zu Beginn. Entwickelt hat sich nichts während der zwei Stunden. Ach ja, es gibt einen unglücklich verliebten Fahrlehrer und einen glücklich verliebten Sozialarbeiter mehr. Entwickelt hat sich nur eine Aversion gegen eine zurückgebliebene Dreißigjährige.
Leigh wird auf der Berlinale-Seite tragischerweise auch noch mit einem Vorsatz zitiert, den er gerade mit seinem neuen Werk so gar nicht mehr einhalten kann. "In meinen Filmen möchte ich eine Welt schaffen, die genauso wahrhaftig ist, etwas, das so dreidimensional und echt aussieht, dass man mit dem Messer reinstechen möchte."
 "Happy-go-lucky" tauchte im Kino wohl 1922 zum ersten Mal auf, bei Robert J. Flahertys Dokumentarfilm "Nanook of the North". Und ebenso wie es schon im ersten Dokumentarfilm der Welt unglaubwürdig war, die Inuit als "happy-go-lucky people", als unbekümmertes Volk zu bezeichnen, ist anzunehmen, dass in der Londoner Finsbury Road eine Alien-Frau wohnt, die sich Hühnerfilets in den BH steckt, in ihrer Garderobe nur Quietschgrün oder Knallrosa kennt und ansonsten alles niederkichert, was nicht bei Drei auf dem Baum ist.
"Happy-go-lucky" tauchte im Kino wohl 1922 zum ersten Mal auf, bei Robert J. Flahertys Dokumentarfilm "Nanook of the North". Und ebenso wie es schon im ersten Dokumentarfilm der Welt unglaubwürdig war, die Inuit als "happy-go-lucky people", als unbekümmertes Volk zu bezeichnen, ist anzunehmen, dass in der Londoner Finsbury Road eine Alien-Frau wohnt, die sich Hühnerfilets in den BH steckt, in ihrer Garderobe nur Quietschgrün oder Knallrosa kennt und ansonsten alles niederkichert, was nicht bei Drei auf dem Baum ist.Wie gesagt Nebenfiguren sind Leighs Stärke. Die resolute Flamenco-Lehrerin, die ihrem Mann die Eier abreißen will. Der cholerische Fahrlehrer, der seinen Rückspiegel nach einem Engel Enrahah nennt. Und ja, die Dialoge: "Willst Du noch ein Baby?" - "Danke, ich hatte gerade einen Döner." Das ist witzig! Aber all diese Perlen gehen verloren, sie werden von einem unaufhörlichen Rinnsal nihilistischen Gekichers weggespült.
Poppy heißt Mohn. Aus Mohn macht man Opium. Vielleicht ist das ja Mike Leighs subtiler Protest gegen Drogenmissbrauch. Oder Afghanistan? Interpretationen, die Leighs geheimes Motiv erläutern, werden dankend entgegengenommen.
Christoph Mayerl
Mike Leigh: "Happy-Go-Lucky". Mit Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Eddie Marsan. Großbritannien 2007, 118 Minuten. (Alle Termine)
Beschreibt die Komödie der männlichen Existenz: Hong Sangsoos "Nacht und Tag" (Wettbewerb)
 Sung-nam (Kim Youngho) ist Maler, lebt in Seoul, kifft das erste Mal in seinem Leben, die Polizei erfährt davon; er flieht überstürzt nach Paris. Das erzählt sehr lakonisch der Vorspann. Im ersten Bild ist Sung-nam schon in Frankreich, steht mit nicht mehr als einem Köfferchen vor der Flughafentür und seine erste - und fast schon die letzte - Begegnung mit einem Franzosen: Der bittet Sung-nam um Feuer, sagt nur "Sei vorsichtig" und ist wieder weg. (Natürlich ist Sung-nam nicht vorsichtig. Und geraucht wird im ganzen Film viel. Getrunken natürlich, dies ist ein Hong-Sangsoo-Film, auch.)
Sung-nam (Kim Youngho) ist Maler, lebt in Seoul, kifft das erste Mal in seinem Leben, die Polizei erfährt davon; er flieht überstürzt nach Paris. Das erzählt sehr lakonisch der Vorspann. Im ersten Bild ist Sung-nam schon in Frankreich, steht mit nicht mehr als einem Köfferchen vor der Flughafentür und seine erste - und fast schon die letzte - Begegnung mit einem Franzosen: Der bittet Sung-nam um Feuer, sagt nur "Sei vorsichtig" und ist wieder weg. (Natürlich ist Sung-nam nicht vorsichtig. Und geraucht wird im ganzen Film viel. Getrunken natürlich, dies ist ein Hong-Sangsoo-Film, auch.)Sung-nam führt Tagebuch und das gibt dem Film die Form einzelner Notizen. Die Kapitel sind unterschiedlich lang und durch Datumsangaben getrennt. Die Stimmungen schwanken, es kommt zu Begegnungen, es gibt Ellipsen und Sprünge und Sung-nam ist das Ich, mit dem der Film uns nachhaltiger noch als mit all den anderen Männern in den Filmen des koreanischen Regisseurs konfrontiert. Sung-nam ist ein typischer Hong Sangsoo-Mann: Ein Künstler, narzisstisch. Einer, der sich mit Frauen einlässt und ihnen das Blaue und die Wolken vom Himmel verspricht, um sich im nächsten Moment um alles zu drücken. Einer, der große Worte macht und ihnen keine oder bestenfalls kleine Taten folgen lässt. Einer, das bringt ihn offenkundig am klarsten auf den Punkt, der so wenig Kontrolle hat über sich und sein Leben, dass er immerzu unfreiwillig Frauen schwängert. Darum glaubt er an einer wichtigen Stelle des Films die Lüge, es sei mal wieder eine Frau von ihm schwanger, umstandslos.
 In dieser Differenz, ja, dem grundsätzlichen Widerspruch zwischen Reden und Handeln sieht Hong Sangsoo die Tragödie, vielleicht auch die Komödie der männlichen Existenz. Zwischen beidem, Tragik und Komik, ist so recht bei ihm schon immer nicht zu unterscheiden; vieles ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist, vieles, das lustig ist, eigentlich traurig. So will es der Zufall, dass Sung-nam mitten auf der Straße in Paris eine Koreanerin zuwinkt. Er ist erstaunt - oder tut jedenfalls so. (Man kann ihm da wirklich nicht trauen, dieser Ich-Erzähler ist notorisch unzuverlässig.) Er erkennt sie nicht, behauptet er, sie kann es nicht fassen. Das begreift man, wenn man gleich darauf erfährt, dass die beiden lange Jahre zusammen waren, einst in Korea. "Weißt du, wie viele Abtreibungen ich deinetwegen hatte", fragt sie ihn. Er blickt sie mit großen Augen an. "Sechs", sagt sie. "Ist das dein Ernst?" fragt er. Womöglich ja.
In dieser Differenz, ja, dem grundsätzlichen Widerspruch zwischen Reden und Handeln sieht Hong Sangsoo die Tragödie, vielleicht auch die Komödie der männlichen Existenz. Zwischen beidem, Tragik und Komik, ist so recht bei ihm schon immer nicht zu unterscheiden; vieles ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist, vieles, das lustig ist, eigentlich traurig. So will es der Zufall, dass Sung-nam mitten auf der Straße in Paris eine Koreanerin zuwinkt. Er ist erstaunt - oder tut jedenfalls so. (Man kann ihm da wirklich nicht trauen, dieser Ich-Erzähler ist notorisch unzuverlässig.) Er erkennt sie nicht, behauptet er, sie kann es nicht fassen. Das begreift man, wenn man gleich darauf erfährt, dass die beiden lange Jahre zusammen waren, einst in Korea. "Weißt du, wie viele Abtreibungen ich deinetwegen hatte", fragt sie ihn. Er blickt sie mit großen Augen an. "Sechs", sagt sie. "Ist das dein Ernst?" fragt er. Womöglich ja. Min-Sun (Kim Youjin) ist jetzt verheiratet in Paris, die beiden gehen trotzdem gemeinsam auf ein Hotelzimmer, wo Sung-nam wie ein Wahnsinniger die Bibel zitiert, da, wo sie vor Ehebruch warnt. Darum schlafen die beiden - wahrscheinlich - nicht miteinander. (Man kann dem Film da nicht unbedingt trauen, der zur Trennung von Traum und Realität nicht die eindeutigste Haltung hat.) Auf einer Party von Koreanern begegnet Sung-nam einer weiteren Frau. Hyun-ju studiert Kunst, sie nimmt ihn mit ins Musee d'Orsay, wo sie lange Courbets "Ursprung der Welt" betrachten. Hyun-ju (Seo Minjeong) hat eine Mitbewohnerin, Yu-jeong (Park Eunhye), in deren Füße sich Sung-nam sehr verliebt. Zuhause in Korea freilich wartet Sung-nams Frau, sie telefonieren täglich, wenn es in Paris Nacht ist, ist es in Seoul Tag. "Kannst du für mich masturbieren", bittet er sie einmal. (Jedenfalls wird sie davon gewiss nicht schwanger. Obwohl...)
 Der Film "Nacht und Tag" erzählt von diesem koreanischen Mann und all diesen koreanischen Frauen in der französischen Fremde, aber er tut dies in der vertrauten Hong-Manier. Zum einen heißt das: Hong Sangsoo hat sich Paris ganz und gar angeeignet, es sieht aus wie Seoul aussieht, wenn Hong Will es filmt: recht starre, die Distanz eher als die Nähe zur Figur suchende Einstellungen; immer etwas überdeutliche Schwenks; seltsame Zooms als Unterstreichungsgesten. Und zum anderen heißt es auch: Alles Lineare täuscht. Das Erzählen vollzieht sich in - teils aller Wahrscheinlichkeit spottenden - Motivwiederholungen und Sprüngen der Dinge durch Zeit und Raum. Wenig ist eindeutig, vieles auf Sand gebaut, schon gar, wenn sich die Geschichte auf die Ich-Perspektive eines Kerls wie Sung-nam einlässt. Manches doppelt sich, auf irritierende Weise. Die Zeichnung eines doppelköpfigen Kalbs spielt eine gewisse Rolle. Ein Spatz fällt aus dem Nest und später taucht ein weiterer Spatz auf. (Was ist das überhaupt mit den Spatzen in diesem Jahr? Jetzt schon der dritte Wettbewerbsfilm mit Spatz an wichtiger Stelle.) Mehr als einmal sieht man Bilder von Wolken, zum Beispiel am Ende, das auf seine Weise ein Happy Ending ist. Aber es ist eines der gemeinsten Happy Endings der Welt. Das glückliche Leben: ein Alptraum.
Der Film "Nacht und Tag" erzählt von diesem koreanischen Mann und all diesen koreanischen Frauen in der französischen Fremde, aber er tut dies in der vertrauten Hong-Manier. Zum einen heißt das: Hong Sangsoo hat sich Paris ganz und gar angeeignet, es sieht aus wie Seoul aussieht, wenn Hong Will es filmt: recht starre, die Distanz eher als die Nähe zur Figur suchende Einstellungen; immer etwas überdeutliche Schwenks; seltsame Zooms als Unterstreichungsgesten. Und zum anderen heißt es auch: Alles Lineare täuscht. Das Erzählen vollzieht sich in - teils aller Wahrscheinlichkeit spottenden - Motivwiederholungen und Sprüngen der Dinge durch Zeit und Raum. Wenig ist eindeutig, vieles auf Sand gebaut, schon gar, wenn sich die Geschichte auf die Ich-Perspektive eines Kerls wie Sung-nam einlässt. Manches doppelt sich, auf irritierende Weise. Die Zeichnung eines doppelköpfigen Kalbs spielt eine gewisse Rolle. Ein Spatz fällt aus dem Nest und später taucht ein weiterer Spatz auf. (Was ist das überhaupt mit den Spatzen in diesem Jahr? Jetzt schon der dritte Wettbewerbsfilm mit Spatz an wichtiger Stelle.) Mehr als einmal sieht man Bilder von Wolken, zum Beispiel am Ende, das auf seine Weise ein Happy Ending ist. Aber es ist eines der gemeinsten Happy Endings der Welt. Das glückliche Leben: ein Alptraum. Ekkehard Knörer
Hong Sangsoo: "Bam gua Nat - Nacht und Tag". Mit Kim Youngho, Park Eunhye, Hwang Soojung. Republik Korea 2008, 145 Minuten. (Alle Termine)
Miss-Helden in Leipzig: Gunther Scholz findet sie in "Sag mir, wo die Schönen sind..." (Panorama)
 Im Frühjahr 1989 rief die Leipziger Volkszeitung alle jungen Sozialistinnen auf, sich bei der Wahl zur Miss Leipzig zu beteiligen. Der Fotograf Gerhard Gäbler fotografierte zwanzig der Bewerberinnen, zu Hause und am Arbeitsplatz. Außerdem befragt er sie nach dem Grund ihres Engagements und ihren Träumen. Die damals aufgenommenen Bilder und auch die Kassetten mit den Interviews hat Gäbler immer noch, und zusammen mit dem Filmemacher Günther Scholz hat er sich zwanzig Jahre später aufgemacht, um zu sehen, was aus den Frauen geworden ist.
Im Frühjahr 1989 rief die Leipziger Volkszeitung alle jungen Sozialistinnen auf, sich bei der Wahl zur Miss Leipzig zu beteiligen. Der Fotograf Gerhard Gäbler fotografierte zwanzig der Bewerberinnen, zu Hause und am Arbeitsplatz. Außerdem befragt er sie nach dem Grund ihres Engagements und ihren Träumen. Die damals aufgenommenen Bilder und auch die Kassetten mit den Interviews hat Gäbler immer noch, und zusammen mit dem Filmemacher Günther Scholz hat er sich zwanzig Jahre später aufgemacht, um zu sehen, was aus den Frauen geworden ist.Die Kombination von Achtzigern und DDR liefert nicht wenige Steilvorlagen, aber der in Görlitz geborene Scholz begegnet den Frauen mit viel Sympathie und Respekt, und stellt sie nicht bloß. Überraschend ist zum einen, dass die Mädchen, die höchsten fünfundzwanzig Jahre alt waren, bei den Kurzinterviews schon 1989 kein Blatt vor den Mund nahmen und sich recht deutlich über den Mangel an Konsumgütern und den Mangel an Perspektiven beschwerten. Die Misswahl sollte für einige der Ausweg sein.
Daran hat sich nicht viel geändert. Am 15. Februar ist Bewerbungsschluss für die Miss Leipzig 2008. Der Veranstalter verspricht der Gewinnerin "einen optimalen Start in eine aussichtsreiche nationale und vor allem internationale Beautykarriere". Die damalige Gewinnerin, die Scholz fast als letzte vorstellt, hat ihren persönlichen Ausweg schon gefunden. Sie hatte ein "Lichterlebnis", meditiert und befindet sich nun in ihrer letzten Reinkarnation. Miss Delitzsch war sie auch.
 Die meisten in der DDR begonnenen Lebenswege haben mit der Wende einen Einschnitt erlebt, der sie in die verschiedensten Richtungen weiterführte. Man kennt das: für die einen war 1989 ein Segen, für die anderen eher zwiespältig. Doch Scholz schafft es, dass man sich mit Neugier anhört, was mit den einzelnen Frauen geschehen ist. Dabei baut Scholz nicht auf den Sonnenallee-Effekt des real existierenden und heute teils surreal anmutenden Sozialismus, sondern auf das Interesse an echten Personen.
Die meisten in der DDR begonnenen Lebenswege haben mit der Wende einen Einschnitt erlebt, der sie in die verschiedensten Richtungen weiterführte. Man kennt das: für die einen war 1989 ein Segen, für die anderen eher zwiespältig. Doch Scholz schafft es, dass man sich mit Neugier anhört, was mit den einzelnen Frauen geschehen ist. Dabei baut Scholz nicht auf den Sonnenallee-Effekt des real existierenden und heute teils surreal anmutenden Sozialismus, sondern auf das Interesse an echten Personen.Die Lebenswege sind wie erwartet recht unterschiedlich. Eine ist Innenarchitektin in Zürich, die andere Zimmermädchen in einem Leipziger Oberklassehotel. Eine sortiert Post in Koblenz, die andere macht PR in Dubai. Eine ist glücklich verheiratet, die andere trennt sich gerade nach achtzehn Jahren von ihrem Mann. Und so weiter. Scholz dreht unaufgeregt und mit einem sicheren Auge für die unterschiedlichen Charaktere seiner Figuren. Langer Applaus im überfüllten Kinosaal.
Christoph Mayerl
Gunther Scholz: "Sag mir, wo die Schönen sind...". Deutschland, 2007, 90 Minuten. (Alle Termine)