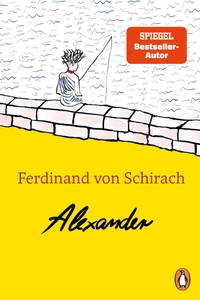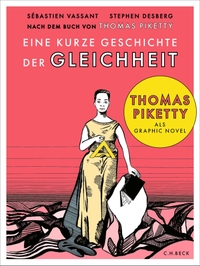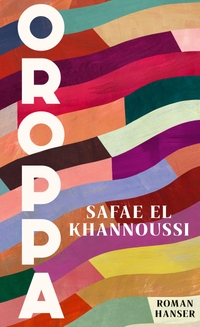Außer Atem: Das Berlinale Blog
Lav Diaz' 'A Lullaby to the Sorrowful Mystery' - ein Halbzeitbericht
Von Lukas Foerster
18.02.2016. Gute acht Stunden dauert der Wettbewerbsbeitrag von Lav Diaz über den philippinischen Unabhängigkeitskriegs. Hier ein Halbzeitbericht.
Vor einigen Stunden hat im Berlinale-Palast die Vorführung des philippinischen Wettbewerbsbeitrags "A Lullaby to the Sorrowful Mystery" begonnen. Nach der Pause folgen vier weitere Stunden. Aber selbst wenn die Vorführung jetzt abgebrochen und der Film als Rumpf stehenbleiben müsste, wäre er das beste, was ich auf dieser Berlinale bislang gesehen habe.
Der Regisseur von "Lullaby", Lav Diaz, hat schon viele außergewöhnlich lange Filme gemacht. Was ob dieser Besonderheit oft übersehen wird: Alle diese Filme sind auf unterschiedliche Art lang, und aus unterschiedlichen Gründen. Sein neuer, der während des philippinischen Unabhängigkeitskriegs 1896-1897 spielt, ist zunächst einmal schlicht deswegen lang, weil er viel zu erzählen, zu zeigen, darzustellen, aufzuführen hat. Reine Zeitbilder, ausgestellte Dauer gibt es kaum; einmal ruht eine junge Frau ihre müden Füße in einem sanft rauschenden Gewässer aus, ein andermal darf ein Wasserbüffel ein paar Minuten lang stur hinter seinem stumm kauernden Besitzer im Bild herum stehen.
Ansonsten ist immer etwas los. Tatsächlich scheint der zentrale Modus des Films das Konfliktbild zu sein. Das ist durchaus historisch zu verstehen: Dr. Jose Rizal und Andres Bonifacio, zwei zentrale Figuren des antikolonialen Widerstands, werden gleich in der ersten Stunde ermordet. Ersterer bleibt komplett offscreen (nur sein Abschiedsgedicht wird verlesen, den zweiten kann man vor seinem Tod zwei-, dreimal im Bildhintergrund erahnen. Offensichtlich geht es dem Film nicht um die überlieferten Helden der Geschichte.
Sondern stattdessen unter anderem um eine reuige Verräterin; um einen anderen Verräter, der sein schlechtes Gewissen in Alkohol und nihilistischer Geschichtsphilosophie ertränkt; um einen obdachlosen Dichter; um die innerlich von Mikroben zerfressene Nachhut der Revolution. Auch auf Seiten der Spanier: Keine stolzen, oder auch nur besonders grausamen Kolonisatoren, sondern lediglich ein Haufen vulgärer Schweinepriester und opiumsüchtiger Großmäuler.
Die Erzählung entfaltet sich bislang auf (und zwischen) zwei Schauplätzen. Der Großteil des Films spielt im philippinischen Dschungel, bei den Rebellen, die freilich den Kampf gegen die spanischen Kolonisatoren längst aufgegeben haben und sich stattdessen gegenseitig zerfleischen. Eine Gruppe von (hauptsächlich) Frauen sucht einen Mann, von dem eigentlich alle schon wissen, dass er längst tot ist. Auch wenn dieser Teil des Films in der freien Natur spielt, wirken die Bilder äußerst beengt. Nicht selten ist die komplette Leinwand mit mehreren, gestaffelten Schichten von Blattwerk ausgefüllt, das oft jegliche Tiefendimension zerstört. Diaz' Dschungel hat eigentlich überhaupt keine Ausdehnung, er ist nicht kartografierbar, nicht durchquerbar. Ein zirkulärer Raum: Wohin man sich auch wendet, man kommt immer wieder bei derselben Hütte an.

Noch weitaus sonderbarer, und für Diaz ungewöhnlicher, ist ein zweiter Handlungsstrang, der in der Stadt, in unmittelbarer Nähe der kolonialen Machtzentren spielt. Hier schmieden Filipinos wie Spanier finstere Pläne, deren Dimension sich zur Halbzeit noch nicht überblicken lassen; vor allem aber führen sie mit- und untereinander lange, ausführliche, exaltierte Gespräche, in Tagalog, Englisch, Spanisch. Noch deutlicher als in den Dschungelszenen verlässt Diaz im urbanen Setting das naturalistische Register. Die Kolonialarchitektur ist offensichtlich ein Studioset, passend dazu sind viele Szenen in Kunstnebel gehüllt, der von gespenstischen Lichtquellen illuminiert und mit harten, teilweise an expressionistische Stummfilme gemahnende Schatten durchsetzt ist.
Das ist noch längst nicht alles. Eine Szene zeigt eine bizarre Kinovorführung (schließlich spielt der Film ein Jahr nach der Erfindung des Kinematografen); mehrere wunderschöne Schlaf- oder Trauerlieder werden gesungen. Und vor allem tauchen noch drei extrem bizarre Figuren auf, ein Mann und zwei Frauen, die als Mitglieder einer Theatergruppe eingeführt werden, aber ebenfalls politische Ambitionen haben und möglicherweise magisch begabt sind. Jedenfalls tauchen sie unvermittelt mal im Dschungel, mal in der Stadt auf. Der Mann, der ausschaut, als sei er einem besonders derangierten Fantasyfilm entsprungen, grunzt und hechelt exaltiert, die eine Frau posiert mit einem derangierten Pudel, die andere springt elfengleich und doch äußerst unheilverkündend durch die Gegend.
Wo wird das noch hinführen? Wird der Film in der zweiten Hälfte den ewigen Dschungel doch noch hinter sich lassen (es hat ein paar Anzeichen dafür gegeben in der letzten halben Stunde vor der Pause)? Wird sich aus dem Dickicht der Paranoiker doch noch ein revolutionäres Subjekt formen? Oder werden Spanier und Filipinos am Ende gemeinsam im Opiumdunst versinken? Anders als die Bilder hat die Erzählung einen komplett offenen Horizont, auch noch nach vier Stunden.
Gleich geht es weiter. Der Berlinalepalast ist noch erstaunlich voll.
Kommentieren