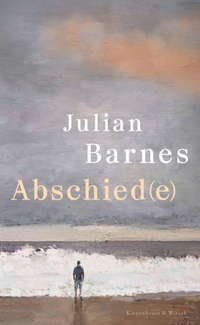 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Julian Barnes wird im Januar 2026 achtzig Jahre alt. Er weiß, dass die längste Zeit seines Lebens hinter ihm liegt, und er möchte…
 Sie sind die Helden der Stunde: Alle Welt will den mRNA-Impfstoff von Biontech, den das deutsch-türkische Forscherpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci - eigentlich Krebs-Forscher - in Mainz gegen das Corona-Virus entwickelt hat. Dementsprechend hungrig verschlingen die Kritiker das Buch "Projekt Lightspeed" (Bestellen), das der Financial-Times-Korrespondent Joe Miller zusammen mit Sahin und Türeci verfasst hat, auch wenn es sie forderte. Für Arno Widmann in der FR ist es glatt "das wichtigste Buch der Saison", weil es mit seiner Mischung von Wissenschaft, Business und Hollywoodeskem Mut macht, eigene Wege zu gehen. In der SZ hätte sich Christina Berndt zwar auch ein bisschen mehr Distanz von Autor Joe Miller vorstellen können, lässt sich aber dann doch mitreißen von dem Innovationswillen, der Weitsicht und wissenschaftlichen Leistung von Sahin und Türeci. Informativ und gut geschrieben, findet das Buch auch Joachim Müller-Jung in der FAZ. Apropos Pioniere: Der britische Althistoriker Robin Lane Fox blickt in seiner Kulturgeschichte "Die Entdeckung der Medizin" auf die Anfänge der Heilkunst in der Antike. Die FAZ findet das Buch vielleicht ein bisschen altmodisch, aber durchaus informativ, der DlfKultur folgt der Entwicklung der Medizin von Homer bis Hippokrates durchweg gespannt.
Sie sind die Helden der Stunde: Alle Welt will den mRNA-Impfstoff von Biontech, den das deutsch-türkische Forscherpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci - eigentlich Krebs-Forscher - in Mainz gegen das Corona-Virus entwickelt hat. Dementsprechend hungrig verschlingen die Kritiker das Buch "Projekt Lightspeed" (Bestellen), das der Financial-Times-Korrespondent Joe Miller zusammen mit Sahin und Türeci verfasst hat, auch wenn es sie forderte. Für Arno Widmann in der FR ist es glatt "das wichtigste Buch der Saison", weil es mit seiner Mischung von Wissenschaft, Business und Hollywoodeskem Mut macht, eigene Wege zu gehen. In der SZ hätte sich Christina Berndt zwar auch ein bisschen mehr Distanz von Autor Joe Miller vorstellen können, lässt sich aber dann doch mitreißen von dem Innovationswillen, der Weitsicht und wissenschaftlichen Leistung von Sahin und Türeci. Informativ und gut geschrieben, findet das Buch auch Joachim Müller-Jung in der FAZ. Apropos Pioniere: Der britische Althistoriker Robin Lane Fox blickt in seiner Kulturgeschichte "Die Entdeckung der Medizin" auf die Anfänge der Heilkunst in der Antike. Die FAZ findet das Buch vielleicht ein bisschen altmodisch, aber durchaus informativ, der DlfKultur folgt der Entwicklung der Medizin von Homer bis Hippokrates durchweg gespannt. Es ist in gewissem Sinne verständlich, dass ein Buch wie Leon Poliakovs "Vom Hass zum Genozid - Das Dritte Reich und die Juden" (bestellen) kein großes Aufsehen erregte. Es ist siebzig Jahre alt. Nur die FAZ hat es bisher besprochen. Aber eigentlich ist das Buch eine Sensation. Denn es zeigt, was vielfach vergessen wurde: nämlich, wie viel man 1951, als es im französischen Original erschien, schon über den Holocaust wusste. Und jetzt erst wird es auf Deutsch übersetzt! Eine Menge wusste man, nur wollte es wohl niemand hören. Poliakov, ein Autor der von den "Neuen Philosophen" später verehrt wurde, hatte die Grundzüge der Geschichte der Judenvernichtung vor allem den Akten der Nürnberger Prozesse entnommen und in seinem monumentalen Buch wohl die erste gründliche Chronologie vorgelegt. Hannah Arendt hatte es für Commentary besprochen. Die Welt druckte die Besprechung Anfang September erstmals auf Deutsch nach. Sie liest sich erschreckend sachlich. Arendt weist auf Kontinuitätslinien hin: "Der Zusammenhang von Massenvernichtung und 'Euthanasie' in Deutschland ist eine von Poliakovs wichtigsten Erkenntnissen; er spürt ihr bis in alle Verästelungen nach. Die Ärzte, Ingenieure und anderen Personen, die die Techniken der 'Euthanasie' im ersten Kriegsjahr perfektionierten, um sie auf geisteskranke Deutsche anzuwenden, waren die gleichen, die später mit den Einrichtungen in Auschwitz und Belzec beauftragt wurden." In der Topografie des Terrors fand eine Podiumsdiskussion zum Buch statt, wo unter anderem Susanne Heim sprach. Hier das Video.
Es ist in gewissem Sinne verständlich, dass ein Buch wie Leon Poliakovs "Vom Hass zum Genozid - Das Dritte Reich und die Juden" (bestellen) kein großes Aufsehen erregte. Es ist siebzig Jahre alt. Nur die FAZ hat es bisher besprochen. Aber eigentlich ist das Buch eine Sensation. Denn es zeigt, was vielfach vergessen wurde: nämlich, wie viel man 1951, als es im französischen Original erschien, schon über den Holocaust wusste. Und jetzt erst wird es auf Deutsch übersetzt! Eine Menge wusste man, nur wollte es wohl niemand hören. Poliakov, ein Autor der von den "Neuen Philosophen" später verehrt wurde, hatte die Grundzüge der Geschichte der Judenvernichtung vor allem den Akten der Nürnberger Prozesse entnommen und in seinem monumentalen Buch wohl die erste gründliche Chronologie vorgelegt. Hannah Arendt hatte es für Commentary besprochen. Die Welt druckte die Besprechung Anfang September erstmals auf Deutsch nach. Sie liest sich erschreckend sachlich. Arendt weist auf Kontinuitätslinien hin: "Der Zusammenhang von Massenvernichtung und 'Euthanasie' in Deutschland ist eine von Poliakovs wichtigsten Erkenntnissen; er spürt ihr bis in alle Verästelungen nach. Die Ärzte, Ingenieure und anderen Personen, die die Techniken der 'Euthanasie' im ersten Kriegsjahr perfektionierten, um sie auf geisteskranke Deutsche anzuwenden, waren die gleichen, die später mit den Einrichtungen in Auschwitz und Belzec beauftragt wurden." In der Topografie des Terrors fand eine Podiumsdiskussion zum Buch statt, wo unter anderem Susanne Heim sprach. Hier das Video. 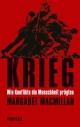 Die Oxforder Historikerin Margaret MacMillan legt mit "Krieg - Wie Konflikte die Menschheit prägten" (bestellen) eine Generalgeschichte des Krieges vor, wie sie ein deutscher Historiker wohl kaum hinbekommen würde. Der Krieg ist hier eine anthropologische Konstante. Ja, er bringt Positives hervor: Das Steuer- und Finanzwesen etwa entwickelte sich entlang der Bedürfnisse der Kriegsfinanzierung, auch die Emanzipation der Frau trieben die Weltkriege voran, da Frauen oft Männerpositionen einnehmen mussten, erfährt etwa Wolfgang Schneider, der für Dlf Kultur rezensiert. In der Zeit schrieb Großgeostratege Herfried Münkler, der ein bisschen mäkelt: Mit letzter Konsequenz schildert MacMillan den Krieg dann doch nicht als Vater aller Dinge.
Die Oxforder Historikerin Margaret MacMillan legt mit "Krieg - Wie Konflikte die Menschheit prägten" (bestellen) eine Generalgeschichte des Krieges vor, wie sie ein deutscher Historiker wohl kaum hinbekommen würde. Der Krieg ist hier eine anthropologische Konstante. Ja, er bringt Positives hervor: Das Steuer- und Finanzwesen etwa entwickelte sich entlang der Bedürfnisse der Kriegsfinanzierung, auch die Emanzipation der Frau trieben die Weltkriege voran, da Frauen oft Männerpositionen einnehmen mussten, erfährt etwa Wolfgang Schneider, der für Dlf Kultur rezensiert. In der Zeit schrieb Großgeostratege Herfried Münkler, der ein bisschen mäkelt: Mit letzter Konsequenz schildert MacMillan den Krieg dann doch nicht als Vater aller Dinge. Angesichts all der postkolonialen Debatten in den letzten Jahren erstaunt es, dass die Verlage nicht allzu viel zu diesem Thema vorlegen. Eine Ausnahme ist Bernhard Maiers "Die Bekehrung der Welt - Eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit" (bestellen). Maier beleuchtet einen Aspekt am Kolonialismus, der in den aktuellen Debatten kaum eine Rolle spielt: die christliche Missionierung. Liegt es daran, dass einige prominente Autoren des Postkolonialismus, wie der Dominikaner-Schüler Achille Mbembe, selbst Missionierte sind? Aber wie so häufig sind die Dinge komplex, denn die Missionierung erbrachte zugleich Einblicke in die Fremde, die die bloß wirtschaftliche Ausbeutung sich nicht erhoffen konnte: "Bernhard Maier zeigt, wie Missionare die Unterwerfung der Welt moralisch flankierten, doch dabei bald an Grenzen stießen. Erzwungene Bekehrungen waren selten nachhaltig. Man musste die Sprachen der Heiden erlernen, die Frohe Botschaft übersetzen, Mythen und Rituale christlich deuten, Schulen gründen, medizinische Versorgung bieten", heißt es im Klappentext. Das Buch ist bisher nur im Dlf Kultur besprochen. Katharina Döbler empfiehlt es als nützliches Nachschlagewerk, macht aber auch Eurozentrismus aus.
Angesichts all der postkolonialen Debatten in den letzten Jahren erstaunt es, dass die Verlage nicht allzu viel zu diesem Thema vorlegen. Eine Ausnahme ist Bernhard Maiers "Die Bekehrung der Welt - Eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit" (bestellen). Maier beleuchtet einen Aspekt am Kolonialismus, der in den aktuellen Debatten kaum eine Rolle spielt: die christliche Missionierung. Liegt es daran, dass einige prominente Autoren des Postkolonialismus, wie der Dominikaner-Schüler Achille Mbembe, selbst Missionierte sind? Aber wie so häufig sind die Dinge komplex, denn die Missionierung erbrachte zugleich Einblicke in die Fremde, die die bloß wirtschaftliche Ausbeutung sich nicht erhoffen konnte: "Bernhard Maier zeigt, wie Missionare die Unterwerfung der Welt moralisch flankierten, doch dabei bald an Grenzen stießen. Erzwungene Bekehrungen waren selten nachhaltig. Man musste die Sprachen der Heiden erlernen, die Frohe Botschaft übersetzen, Mythen und Rituale christlich deuten, Schulen gründen, medizinische Versorgung bieten", heißt es im Klappentext. Das Buch ist bisher nur im Dlf Kultur besprochen. Katharina Döbler empfiehlt es als nützliches Nachschlagewerk, macht aber auch Eurozentrismus aus. In jüngster Zeit wurde viel über das Deutsche Kaiserreich diskutiert: Ob es nicht doch fortschrittlicher war als bislang angenommen, wie Hedwig Richter u.a. in ihrem Band "Aufbruch in die Moderne" (bestellen) behauptet. Oder ob es direkt in den Nationalsozialismus führte. Wer sich über diesen Streit informieren möchte, lese Heinrich August Winklers Band "Deutungskämpfe" (bestellen), empfiehlt Gustav Seibt in der SZ. Wer aber einfach eine Reise durch die Bismarckzeit unternehmen möchte, der greife zu Bruno Preisendörfers "Als Deutschland erstmals einig wurde" (bestellen), ermuntert der Rezensent, dem das Buch ein sehr anschauliches Bild jener Zeit vermittelt hat: Geschichte von unten. Wenn Preisendörfer über Arbeiterfragen und Wohnungsnot schreibt oder Frauenrechtlerinnen wie Hedwig Dohm zitiert, kommen dem Rezensenten die Menschen von damals wirklich nah. Und auch die "Reise"-Metapher passt, meint er, weil sie die Mischung aus Befremdung und allmählichem Vertrautwerden erfasst, die ein unbekanntes Land auslöst.
In jüngster Zeit wurde viel über das Deutsche Kaiserreich diskutiert: Ob es nicht doch fortschrittlicher war als bislang angenommen, wie Hedwig Richter u.a. in ihrem Band "Aufbruch in die Moderne" (bestellen) behauptet. Oder ob es direkt in den Nationalsozialismus führte. Wer sich über diesen Streit informieren möchte, lese Heinrich August Winklers Band "Deutungskämpfe" (bestellen), empfiehlt Gustav Seibt in der SZ. Wer aber einfach eine Reise durch die Bismarckzeit unternehmen möchte, der greife zu Bruno Preisendörfers "Als Deutschland erstmals einig wurde" (bestellen), ermuntert der Rezensent, dem das Buch ein sehr anschauliches Bild jener Zeit vermittelt hat: Geschichte von unten. Wenn Preisendörfer über Arbeiterfragen und Wohnungsnot schreibt oder Frauenrechtlerinnen wie Hedwig Dohm zitiert, kommen dem Rezensenten die Menschen von damals wirklich nah. Und auch die "Reise"-Metapher passt, meint er, weil sie die Mischung aus Befremdung und allmählichem Vertrautwerden erfasst, die ein unbekanntes Land auslöst. Wenn ein historisches Buch dieser Saison bleibt, dann sicherlich Stephan Malinowskis "Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration" (bestellen), das wir schon im Oktober-Bücherbrief empfahlen. Über die Hohenzollern, die schon in gründliche Vergessenheit zu geraten drohten, ist vieles erschienen in den letzten zwei drei Jahren: Die Frage ist immer, ob sie den Nazis "erheblichen Vorschub" geleistet haben und darum die Enteignungen, die gegen sie verfügt wurden, rechtens. Die Nachfahren möchten Entschädigung, und wer gönnt ihnen nicht ihr komfortables Leben? Das mit dem "erheblichen Vorschub" dürfte nach der Lektüre des Buchs allerdings geklärt sein.
Wenn ein historisches Buch dieser Saison bleibt, dann sicherlich Stephan Malinowskis "Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration" (bestellen), das wir schon im Oktober-Bücherbrief empfahlen. Über die Hohenzollern, die schon in gründliche Vergessenheit zu geraten drohten, ist vieles erschienen in den letzten zwei drei Jahren: Die Frage ist immer, ob sie den Nazis "erheblichen Vorschub" geleistet haben und darum die Enteignungen, die gegen sie verfügt wurden, rechtens. Die Nachfahren möchten Entschädigung, und wer gönnt ihnen nicht ihr komfortables Leben? Das mit dem "erheblichen Vorschub" dürfte nach der Lektüre des Buchs allerdings geklärt sein. 

 Ebenfalls zu den Büchern der Saison gehört Per Leos "Tränen ohne Trauer" (bestellen), das wir im Bücherbrief des Monats August vorstellten: Es ist Dokument des Paradigmenwandels, der durch die Mbembe- und die Moses-Debatte eingeleitet wurde. Dass es eine Singularität des Holocaust gibt, wird seit dieser Saison nicht mehr nur von rechts, sondern nun auch wieder von links in Frage gestellt. Wie auch immer man zur postkolonialen Unterordnung des Holocaust in ein Globalgeschehen stehen mag - Leos Buch ist sicher einer der prägenden Beiträge zu dieser Debatte. Diese Debatte wurde von Micha Brumlik aus seiner Position in "Postkolonialer Antisemitismus?" (bestellen) resümiert. Zu den historischen Büchern der Saison gehört auch Richard J. Evans' Studie "Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien" (bestellen), die den Einfluss etwa der "Protokolle der Weisen von Zion" auf die Nazis untersucht - die Rezensenten lesen es mit Interesse.
Ebenfalls zu den Büchern der Saison gehört Per Leos "Tränen ohne Trauer" (bestellen), das wir im Bücherbrief des Monats August vorstellten: Es ist Dokument des Paradigmenwandels, der durch die Mbembe- und die Moses-Debatte eingeleitet wurde. Dass es eine Singularität des Holocaust gibt, wird seit dieser Saison nicht mehr nur von rechts, sondern nun auch wieder von links in Frage gestellt. Wie auch immer man zur postkolonialen Unterordnung des Holocaust in ein Globalgeschehen stehen mag - Leos Buch ist sicher einer der prägenden Beiträge zu dieser Debatte. Diese Debatte wurde von Micha Brumlik aus seiner Position in "Postkolonialer Antisemitismus?" (bestellen) resümiert. Zu den historischen Büchern der Saison gehört auch Richard J. Evans' Studie "Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien" (bestellen), die den Einfluss etwa der "Protokolle der Weisen von Zion" auf die Nazis untersucht - die Rezensenten lesen es mit Interesse.

 Und noch drei Bücher, die man sich gut als Weihnachtsgeschenke vorstellen kann: Tim Marshalls "Die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert - 10 Karten erklären die Politik von heute und die Krisen der Zukunft" (bestellen) zum Beispiel. Wie schon in seinem Bestseller "Die Macht der Geografie" von 2015 erzählt Marshall laut Rezensionen lehrreich und unterhaltsam anhand von Karten, wie Geografie Geschichte prägt. Ein plastisches Zeitbild liefert Uwe Wittstocks Zeitreise in den "Februar 1933" (bestellen), als sich die deutsche Geisteswelt im Magnetismus der Nazis kuschte, sich duckte oder verschwand. Wittstock lässt laut den Rezensenten auf kluge Art die Dokumente sprechen. Wer Thomas Manns Tagebücher aus dem Jahr 1933 kennt, weiß, wie spannend es ist, Geschichte gewissermaßen "live" mitzuleben. Schließlich sei noch auf Philipp Sarasins "1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart" (bestellen) hingewiesen, das nicht von den großen Umwälzungen erzählt, so in der SZ Diedrich Diederichsen, sondern im Gegenteil die Narrative "zerbröseln" lässt und zeigt, dass viele der dargestellten Phänomene (Hippie-Kultur, Identitätspolitik, sexuelle Selbstverwirklichung) schon lange vor 1977 ihren Ausgang nahmen. Ein fesselndes und differenziertes Buch, finden auch die Kritiker in FR, NZZ und FAZ.
Und noch drei Bücher, die man sich gut als Weihnachtsgeschenke vorstellen kann: Tim Marshalls "Die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert - 10 Karten erklären die Politik von heute und die Krisen der Zukunft" (bestellen) zum Beispiel. Wie schon in seinem Bestseller "Die Macht der Geografie" von 2015 erzählt Marshall laut Rezensionen lehrreich und unterhaltsam anhand von Karten, wie Geografie Geschichte prägt. Ein plastisches Zeitbild liefert Uwe Wittstocks Zeitreise in den "Februar 1933" (bestellen), als sich die deutsche Geisteswelt im Magnetismus der Nazis kuschte, sich duckte oder verschwand. Wittstock lässt laut den Rezensenten auf kluge Art die Dokumente sprechen. Wer Thomas Manns Tagebücher aus dem Jahr 1933 kennt, weiß, wie spannend es ist, Geschichte gewissermaßen "live" mitzuleben. Schließlich sei noch auf Philipp Sarasins "1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart" (bestellen) hingewiesen, das nicht von den großen Umwälzungen erzählt, so in der SZ Diedrich Diederichsen, sondern im Gegenteil die Narrative "zerbröseln" lässt und zeigt, dass viele der dargestellten Phänomene (Hippie-Kultur, Identitätspolitik, sexuelle Selbstverwirklichung) schon lange vor 1977 ihren Ausgang nahmen. Ein fesselndes und differenziertes Buch, finden auch die Kritiker in FR, NZZ und FAZ. 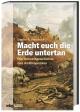 Die Umweltgeschichte des amerikanischen Historikers Daniel Headrick wurde bisher nur in der FAZ von Jürgen Osterhammel besprochen, aber immerhin. In "Macht euch die Erde untertan" (Bestellen) staucht Headrick zehntausend Jahre Menschheitsgeschichte zu einer schwarzen Anthropologie, warnt Osterhammel, in der sich die Brutalitäten des Anthropozäns nur so aneinanderreihen: Nicht erst mit dem Klimawandel drückte der Mensch der Natur seinen Stempel auf, sondern seit speerbewaffnete Jäger erstmals ihre Massaker am Großwild verübten. Osterhammel kann diese "kumulativen Kalamitäten" verkraften, zumal Headrick im Ton nüchtern und historisch integer bleibe, wie der Rezensent versichert.
Die Umweltgeschichte des amerikanischen Historikers Daniel Headrick wurde bisher nur in der FAZ von Jürgen Osterhammel besprochen, aber immerhin. In "Macht euch die Erde untertan" (Bestellen) staucht Headrick zehntausend Jahre Menschheitsgeschichte zu einer schwarzen Anthropologie, warnt Osterhammel, in der sich die Brutalitäten des Anthropozäns nur so aneinanderreihen: Nicht erst mit dem Klimawandel drückte der Mensch der Natur seinen Stempel auf, sondern seit speerbewaffnete Jäger erstmals ihre Massaker am Großwild verübten. Osterhammel kann diese "kumulativen Kalamitäten" verkraften, zumal Headrick im Ton nüchtern und historisch integer bleibe, wie der Rezensent versichert. 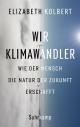
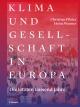 Der Historiker Christian Pfister und der Klimatologe Heinz Wanner nehmen in ihrer Geschichte "Klima und Gesellschaft in Europa" (Bestellen) immerhin die letzten tausend Jahre in den Blick. Im Dlf weiß Dagmar Rörhlich die Sachlichkeit der beiden Schweizer Autoren zu schätzen, die ihr viel Raum ließ, die Auswirkungen von Klimaereignissen auf die Gesellschaft selbst zu reflektieren und zu fürchten. Auf Elizabeth Kolberts vielfach gelobtes Buch "Wir Klimawandler" (Bestellen) haben wir schon in unserem Bücherbrief hingewiesen. Die amerikanische Journalistin untersucht in verschiedenen Reportagen Möglichkeiten und Grenzen des Geo-Engineering, etwa die Stauung des Mississippi, die Simulierung von Vulkanausbrüchen oder die Bekämpfung von Schneckeninvasionen.
Der Historiker Christian Pfister und der Klimatologe Heinz Wanner nehmen in ihrer Geschichte "Klima und Gesellschaft in Europa" (Bestellen) immerhin die letzten tausend Jahre in den Blick. Im Dlf weiß Dagmar Rörhlich die Sachlichkeit der beiden Schweizer Autoren zu schätzen, die ihr viel Raum ließ, die Auswirkungen von Klimaereignissen auf die Gesellschaft selbst zu reflektieren und zu fürchten. Auf Elizabeth Kolberts vielfach gelobtes Buch "Wir Klimawandler" (Bestellen) haben wir schon in unserem Bücherbrief hingewiesen. Die amerikanische Journalistin untersucht in verschiedenen Reportagen Möglichkeiten und Grenzen des Geo-Engineering, etwa die Stauung des Mississippi, die Simulierung von Vulkanausbrüchen oder die Bekämpfung von Schneckeninvasionen. 
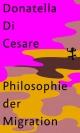 Bis zu ihrem tragischen Unfalltod im Jahr 2015 hat die französische Psychoanalytikerin und Philosophin Anne Dufourmantelle ein beeindruckendes Werk eigenwilliger Schriften verfasst, zu denen neben einem Plädoyer für das persönliche Wagnis ("Lob des Risikos") und eine Eloge auf die Sanftmut ("Puissance de douceur") auch die nun erschienene "Verteidigung des Geheimnis" (Bestellen) gehört. Dufourmantelle plädiert darin für die Wahrung der Intimität im Persönlichen wie im Politischen und gegen den Zwang, sich selbst permanent offenlegen zu müssen. Eine verschwiegene Wahrheit muss keine Lüge sein, nicht jeder Bruch der Privatsphäre ein Akt befreiender Transparenz. In der taz ist Marlen Hobrack fasziniert von diesem Text, der mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Eine weitere interessante Denkerin stellt Thomas Palzer im Dlf vor: Donatella Di Cesare erkundet in ihrer "Philosophie der Migration" (Bestellen), welche Provokation der Mensch, der nicht dazugehört, für die Souveränität eines Staates und die Ordnung einer Gesellschaft bedeutet. Facettenreich und tiefgründig findet Palzer Cesares Überlegungen.
Bis zu ihrem tragischen Unfalltod im Jahr 2015 hat die französische Psychoanalytikerin und Philosophin Anne Dufourmantelle ein beeindruckendes Werk eigenwilliger Schriften verfasst, zu denen neben einem Plädoyer für das persönliche Wagnis ("Lob des Risikos") und eine Eloge auf die Sanftmut ("Puissance de douceur") auch die nun erschienene "Verteidigung des Geheimnis" (Bestellen) gehört. Dufourmantelle plädiert darin für die Wahrung der Intimität im Persönlichen wie im Politischen und gegen den Zwang, sich selbst permanent offenlegen zu müssen. Eine verschwiegene Wahrheit muss keine Lüge sein, nicht jeder Bruch der Privatsphäre ein Akt befreiender Transparenz. In der taz ist Marlen Hobrack fasziniert von diesem Text, der mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Eine weitere interessante Denkerin stellt Thomas Palzer im Dlf vor: Donatella Di Cesare erkundet in ihrer "Philosophie der Migration" (Bestellen), welche Provokation der Mensch, der nicht dazugehört, für die Souveränität eines Staates und die Ordnung einer Gesellschaft bedeutet. Facettenreich und tiefgründig findet Palzer Cesares Überlegungen. Svenja Flaßpöhler geht keinem Streit aus dem Weg. In ihrem neuen Buch "Sensibilität" (Bestellen) fragt die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, ob die Sensibilität, eine große Errungenschaft des Zivilisationsprozesses, ins Regressive umschlagen kann, wenn sie permanent eingefordert wird. Welt, FAZ und SZ finden Flaßpöhlers Ritt durch die Theorien von Nietzsche, Jünger, Elias, Derrida und Butler etwas forsch. Aber taz und FR lesen ihr Buch doch auch mit Gewinn und Amüsement, wenn sie die hypersensible Schneeflöckchen gegen resiliente Kämpfernaturen in Stellung bringt.
Svenja Flaßpöhler geht keinem Streit aus dem Weg. In ihrem neuen Buch "Sensibilität" (Bestellen) fragt die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, ob die Sensibilität, eine große Errungenschaft des Zivilisationsprozesses, ins Regressive umschlagen kann, wenn sie permanent eingefordert wird. Welt, FAZ und SZ finden Flaßpöhlers Ritt durch die Theorien von Nietzsche, Jünger, Elias, Derrida und Butler etwas forsch. Aber taz und FR lesen ihr Buch doch auch mit Gewinn und Amüsement, wenn sie die hypersensible Schneeflöckchen gegen resiliente Kämpfernaturen in Stellung bringt. 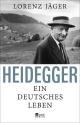
 Nicht leicht getan haben sich die Kritiker mit Lorenz Jägers Biografie "Heidegger" (Bestellen). Gut geschrieben und souverän komponiert sei sie, geben alle zu, und auch nicht unkritisch gegenüber Heideggers politischen Verirrungen. Aber ob sie dem "Skandal Heidegger" wirklich gerecht wird, möchte Micha Brumlik in der taz lieber nicht sagen. In der FAZ stört sich Karl-Heinz Ott an zu viel Einfühlung. In der Welt sieht Hans Ulrich Gumbrecht allerdings Kühnheit und Gegenwärtigkeit von Heideggers Denken gut zur Geltung gebracht. Vielfach gelobt wurde auch Rüdiger Safranskis "Einzeln sein" (Bestellen). Safranski zeichnet darin eine Ideengeschichte der großen Einzelgänger, die von Pico della Mirandola über Montaigne, Luther, Kierkegaard zu Heidegger, Sartre und Arendt führt und dabei die hellen und dunklen Seiten des Individualismus gekonnt ausleuchtet.
Nicht leicht getan haben sich die Kritiker mit Lorenz Jägers Biografie "Heidegger" (Bestellen). Gut geschrieben und souverän komponiert sei sie, geben alle zu, und auch nicht unkritisch gegenüber Heideggers politischen Verirrungen. Aber ob sie dem "Skandal Heidegger" wirklich gerecht wird, möchte Micha Brumlik in der taz lieber nicht sagen. In der FAZ stört sich Karl-Heinz Ott an zu viel Einfühlung. In der Welt sieht Hans Ulrich Gumbrecht allerdings Kühnheit und Gegenwärtigkeit von Heideggers Denken gut zur Geltung gebracht. Vielfach gelobt wurde auch Rüdiger Safranskis "Einzeln sein" (Bestellen). Safranski zeichnet darin eine Ideengeschichte der großen Einzelgänger, die von Pico della Mirandola über Montaigne, Luther, Kierkegaard zu Heidegger, Sartre und Arendt führt und dabei die hellen und dunklen Seiten des Individualismus gekonnt ausleuchtet.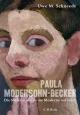 Die Malerin Paula Modersohn-Becker starb 1907 mit nur 31 Jahren - von Galeristen verkannt, von der Kritik verrissen und selbst von ihrem Mann, dem Maler Otto Modersohn, und seinen Freunden in der Künstlerkolonie Worpswede verächtlich gemacht. Dabei war sie ihm künstlerisch um Lichtjahre voraus, wie Eva Hepper von der Monografie (Bestellen) des Kunshistorikers Uwe M. Schneede lernt. Herausragend findet sie im Dlf, wie der Kunsthistoriker gerade die Arbeiten des Malerspaares vergleichend betrachtet, spannend aber auch, wie sich Paula Modersohn-Becker immer wieder nach Paris begab, um von Cezanne, Gauguin und den Fauvisten zu lernen. Als "genuss- und erkenntnisreich" empfiehlt Annette Schneider im NDR diese Monografie, die ihr das ganz und gar eigene Werk einer "Pionierin der Moderne" nahebringt.
Die Malerin Paula Modersohn-Becker starb 1907 mit nur 31 Jahren - von Galeristen verkannt, von der Kritik verrissen und selbst von ihrem Mann, dem Maler Otto Modersohn, und seinen Freunden in der Künstlerkolonie Worpswede verächtlich gemacht. Dabei war sie ihm künstlerisch um Lichtjahre voraus, wie Eva Hepper von der Monografie (Bestellen) des Kunshistorikers Uwe M. Schneede lernt. Herausragend findet sie im Dlf, wie der Kunsthistoriker gerade die Arbeiten des Malerspaares vergleichend betrachtet, spannend aber auch, wie sich Paula Modersohn-Becker immer wieder nach Paris begab, um von Cezanne, Gauguin und den Fauvisten zu lernen. Als "genuss- und erkenntnisreich" empfiehlt Annette Schneider im NDR diese Monografie, die ihr das ganz und gar eigene Werk einer "Pionierin der Moderne" nahebringt.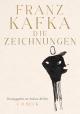
 Kafka konnte nicht nur irrwitzig erzählen, sondern auch fantastisch zeichnen. Dass "Die Zeichnungen" (Bestellen) nun erstmals gesammelt herausgegeben werden, lässt den Schriftsteller Daniel Kehlmann in der Zeit jubeln. Wie Kafka hier mit wenigen Strichen seine eigenen Geschichten illustriert, kann Kehlmann nur bewundern. Die "profunde Komik" der gestrichelten Gestalten lässt bei ihm aber auch den Verdacht aufkommen, dass Kafka durchaus so etwas wie Fröhlichkeit kannte. In der FAZ bewundert Jeremy Adler die Kraft, Energie und Eleganz, mit der Kafka seine Zeichnungen hinwarf, in denen der Kritiker mitunter auch Überraschendes entdeckt, nackte Aggression etwa oder bizarren Humor. In der SZ erhebt Lothar Müller allerdings Einwände gegen die vielen Kritzelen, die wahrscheinlich der Vollständigkeit halber ebenfalls in den Band mitaufgenommen wurden. Auf Horst Bredekamps große Michelangelo-Biografie (Bestellen) haben wird schon in unserem Bücherbrief im September hingewiesen. Seitdem ist das Buch noch häufiger, aber nicht weniger nachdrücklich als neues Standardwerk gefeiert worden, wobei etwa Kia Vahland in der SZ Bredekamps subjektive, Ästhetisches und Psychologisches kombinierende Herangehensweise ganz passend findet für einen unkonventionellen Künstler wie Michelangelo.
Kafka konnte nicht nur irrwitzig erzählen, sondern auch fantastisch zeichnen. Dass "Die Zeichnungen" (Bestellen) nun erstmals gesammelt herausgegeben werden, lässt den Schriftsteller Daniel Kehlmann in der Zeit jubeln. Wie Kafka hier mit wenigen Strichen seine eigenen Geschichten illustriert, kann Kehlmann nur bewundern. Die "profunde Komik" der gestrichelten Gestalten lässt bei ihm aber auch den Verdacht aufkommen, dass Kafka durchaus so etwas wie Fröhlichkeit kannte. In der FAZ bewundert Jeremy Adler die Kraft, Energie und Eleganz, mit der Kafka seine Zeichnungen hinwarf, in denen der Kritiker mitunter auch Überraschendes entdeckt, nackte Aggression etwa oder bizarren Humor. In der SZ erhebt Lothar Müller allerdings Einwände gegen die vielen Kritzelen, die wahrscheinlich der Vollständigkeit halber ebenfalls in den Band mitaufgenommen wurden. Auf Horst Bredekamps große Michelangelo-Biografie (Bestellen) haben wird schon in unserem Bücherbrief im September hingewiesen. Seitdem ist das Buch noch häufiger, aber nicht weniger nachdrücklich als neues Standardwerk gefeiert worden, wobei etwa Kia Vahland in der SZ Bredekamps subjektive, Ästhetisches und Psychologisches kombinierende Herangehensweise ganz passend findet für einen unkonventionellen Künstler wie Michelangelo.
 Höchst liebevoll nehmen die Kritiker Christoph Dallachs Hommage auf den Krautrock auf, jene verstörenden Klänge, mit denen deutsche Bands wie Can, Neu!, Amon Düül, Popul Vuh, Tangerine Dream, Faust, Cluster oder Kraftwerk die Rockmusik modernisierten. Für FR-Kritiker Stefan Michalzik ist "Future Sounds" (Bestellen) mit all den Interviews, die Dallach damals mit den Beteiligten führte, ein neues Standardwerk, für Philipp Krohn in der FAZ ein Vermächtnis, dessen glofizierende Momente er gut verkraften kann. Nur in der SZ vermisst Diedrich Diederichsen ein bisschen Atmo aus dem krautigen Konzertalltag. Und bitte nicht vergessen, was für großartige Musikerinnen Beate Bartel, Gudrun Gut, Bettina Köster waren, ruft in der FR Christina Mohr. Wärmstens empfiehlt sie daher den Band "M_Dokumente", der sehr schön nachzeichnet, wie die Frauenpunkbands Mania D., Malaria! oder Matador neue Musik, neue Looks und neue Frauenbilder schufen.
Höchst liebevoll nehmen die Kritiker Christoph Dallachs Hommage auf den Krautrock auf, jene verstörenden Klänge, mit denen deutsche Bands wie Can, Neu!, Amon Düül, Popul Vuh, Tangerine Dream, Faust, Cluster oder Kraftwerk die Rockmusik modernisierten. Für FR-Kritiker Stefan Michalzik ist "Future Sounds" (Bestellen) mit all den Interviews, die Dallach damals mit den Beteiligten führte, ein neues Standardwerk, für Philipp Krohn in der FAZ ein Vermächtnis, dessen glofizierende Momente er gut verkraften kann. Nur in der SZ vermisst Diedrich Diederichsen ein bisschen Atmo aus dem krautigen Konzertalltag. Und bitte nicht vergessen, was für großartige Musikerinnen Beate Bartel, Gudrun Gut, Bettina Köster waren, ruft in der FR Christina Mohr. Wärmstens empfiehlt sie daher den Band "M_Dokumente", der sehr schön nachzeichnet, wie die Frauenpunkbands Mania D., Malaria! oder Matador neue Musik, neue Looks und neue Frauenbilder schufen. 

 Toll fanden die Kritikerinnen auch Helene Hegemanns Buch über "Patti Smith" (Bestellen), das etwa die Zeit mit den Worten empfiehlt: "Ein bisschen Irrenhaus, aber auch Kunst." Vergnügt liest die FR Daniel Deckers "Not Available" (Bestellen), eine Geschichte nicht erschienener Platten. Und Christoph Wagners Interviewband "Geistertöne" (bestellen) hat die Kritiker aus den Socken gehauen: Koryphäen wie Meredith Monk oder Marshal Allen vom Sun Ra Arkestra und Peter Conradin Zumthor erzählen offen und freudig von ihrer Kunst, vom Avantgarde-Leben und von Klangutopien, staunt ein hingerissener Andreas Schäfer in der in der NZZ. Anja-Rosa Thöming stimmt in der FAZ in das Lob ein.
Toll fanden die Kritikerinnen auch Helene Hegemanns Buch über "Patti Smith" (Bestellen), das etwa die Zeit mit den Worten empfiehlt: "Ein bisschen Irrenhaus, aber auch Kunst." Vergnügt liest die FR Daniel Deckers "Not Available" (Bestellen), eine Geschichte nicht erschienener Platten. Und Christoph Wagners Interviewband "Geistertöne" (bestellen) hat die Kritiker aus den Socken gehauen: Koryphäen wie Meredith Monk oder Marshal Allen vom Sun Ra Arkestra und Peter Conradin Zumthor erzählen offen und freudig von ihrer Kunst, vom Avantgarde-Leben und von Klangutopien, staunt ein hingerissener Andreas Schäfer in der in der NZZ. Anja-Rosa Thöming stimmt in der FAZ in das Lob ein.
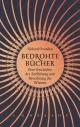
 Die Kritikerin Hanna Engelmeier überrascht die RezensentInnen mit literarischen Exerzitien des Trostes, so wie sie sie vom Jesuiten Ignacio de Loyola gelernt hat: Schreiben, Hören, Beten, Lesen sind die vier Übungen, die dabei helfen sollen, sich selbst "Trost" (Bestellen) zu spenden. Wie Engelmeier dabei Lektüren von Rilke, Cheryl Strayed, David Foster Wallace und Adorno mit Intellekt und Humor verbindet, beeindruckt ihre KollegInnen bei FAZ und taz gleichermaßen. Richard Ovendens "Bedrohte Bücher" (Bestellen) wurde als Liebeserklärung und Manifest gleichermaßen verstanden. Dass sich Ovenden als passionierter Bibliothekar dabei auch um den Bestand gedruckter Bücher ebenso sorgt, wie um die mangelnde Sicherung von digitalen Schriften, rechnen ihm Dlf und FAZ hoch an. Ein Selbstläufer dürfte Florian Illies' neues Buch "Liebe in Zeiten des Hasses" (Bestellen) werden, in dem er von der Liebe unter Literaten in den dreißiger Jahren erzählt. Eine Hymne von Elke Heidenreich in der SZ garantiert dem Buch den Verkaufserfolg.
Die Kritikerin Hanna Engelmeier überrascht die RezensentInnen mit literarischen Exerzitien des Trostes, so wie sie sie vom Jesuiten Ignacio de Loyola gelernt hat: Schreiben, Hören, Beten, Lesen sind die vier Übungen, die dabei helfen sollen, sich selbst "Trost" (Bestellen) zu spenden. Wie Engelmeier dabei Lektüren von Rilke, Cheryl Strayed, David Foster Wallace und Adorno mit Intellekt und Humor verbindet, beeindruckt ihre KollegInnen bei FAZ und taz gleichermaßen. Richard Ovendens "Bedrohte Bücher" (Bestellen) wurde als Liebeserklärung und Manifest gleichermaßen verstanden. Dass sich Ovenden als passionierter Bibliothekar dabei auch um den Bestand gedruckter Bücher ebenso sorgt, wie um die mangelnde Sicherung von digitalen Schriften, rechnen ihm Dlf und FAZ hoch an. Ein Selbstläufer dürfte Florian Illies' neues Buch "Liebe in Zeiten des Hasses" (Bestellen) werden, in dem er von der Liebe unter Literaten in den dreißiger Jahren erzählt. Eine Hymne von Elke Heidenreich in der SZ garantiert dem Buch den Verkaufserfolg.
 Stefan Buijsman war ein mathematisches Wunderkind, mit nicht mal zwanzig Jahren hatte er schon seinen Doktor. Dass er trotzdem populär über die Welt der Zahlen und Algorithmen schreiben kann, rechnet ihm Andrian Kreye in der SZ hoch an. Dass Buijsmann ihm dann auch noch in "Ada und die Algorithmen" (Bestellen) versichert, dass Künstliche Intelligenz immer nur Wahrscheinlichkeiten wird ausrechnen können, aber nie Bedeutungen herstellen, beruhigt den Rezensenten - halb. Der Report "Inside Facebook" (Bestellen) der beiden New-York-Times-Autorinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang ist schon vor der Veröffentlichung der Facebook Papers erschienen, überholt scheint er dadurch aber nicht. Denn Frenkel und Kang haben die Missstände und Probleme des Konzern (Manipulation, Agitation, Geldgier) hervorragend recherchiert, wie die Kritiker in FAZ, NZZ, SZ und DlfKultur versichern. Vor allem das Gebaren von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zwischen römischem Imperator und Kriegs-CEO finden sie so informativ wie unterhaltsam dargestellt.
Stefan Buijsman war ein mathematisches Wunderkind, mit nicht mal zwanzig Jahren hatte er schon seinen Doktor. Dass er trotzdem populär über die Welt der Zahlen und Algorithmen schreiben kann, rechnet ihm Andrian Kreye in der SZ hoch an. Dass Buijsmann ihm dann auch noch in "Ada und die Algorithmen" (Bestellen) versichert, dass Künstliche Intelligenz immer nur Wahrscheinlichkeiten wird ausrechnen können, aber nie Bedeutungen herstellen, beruhigt den Rezensenten - halb. Der Report "Inside Facebook" (Bestellen) der beiden New-York-Times-Autorinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang ist schon vor der Veröffentlichung der Facebook Papers erschienen, überholt scheint er dadurch aber nicht. Denn Frenkel und Kang haben die Missstände und Probleme des Konzern (Manipulation, Agitation, Geldgier) hervorragend recherchiert, wie die Kritiker in FAZ, NZZ, SZ und DlfKultur versichern. Vor allem das Gebaren von Facebook-Chef Mark Zuckerberg zwischen römischem Imperator und Kriegs-CEO finden sie so informativ wie unterhaltsam dargestellt.