BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
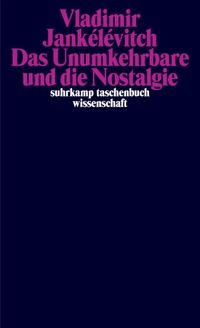
Vladimir Jankelevitch: Das Unumkehrbare und die Nostalgie
Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann. Was ist das Wesen der Nostalgie? Und wodurch entsteht sie? Das sind die Fragen, die Vladimir Jankélévitch in seinem großen Spätwerk…

Klaus Rennert: Richter, Gericht, Gerichtsbarkeit
Mit der Judikative, der rechtsprechenden Gewalt kommen viele Bürger nur sporadisch in Berührung: In der Schule im Zusammenhang mit der Gewaltenteilungslehre von Montesquieu,…

Hans Jürgen von der Wense: Routen II
Mit zahlreichen Abbildungen und zwei beigelegten Messtischblättern aus dem Nachlass. Der Privatgelehrte, Übersetzer, Komponist, Landschaftsforscher, Briefkünstler Hans Jürgen…

Sighard Neckel: Katastrophenzeit
In seinem neuen Buch analysiert der Soziologe Sighard Neckel das große Dilemma unserer Zeit: Während der Klimawandel auf eine ökologische Katastrophenzeit zuläuft, stellen…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier