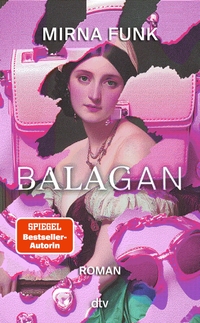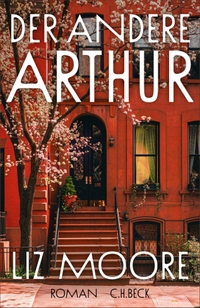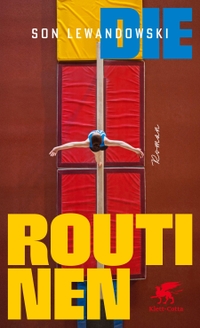Post aus London
We've got Goethe, we've got Schiller!
Von Henning Hoff
08.07.2003. "In jedem Deutschen steckt ein kleiner Mengele", meinte neulich der Kunstkritiker der Londoner Times, weil er ein paar deutsche Fotografen nicht gut fand. Die Deutschen versuchen unterdes, mit Hilfe britischer Agenturen ihr Image zu verbessern."In jedem Deutschen steckt ein kleiner Mengele", konnte man vor ein paar Wochen in der Sunday Times lesen, der auflagenstärksten der seriösen britischen Sonntagszeitungen. Dem Kunstkritiker des Blattes, Waldemar Januszczak, waren die Portraitbilder einiger deutscher Fotografen unangenehm aufgefallen, die derzeit bei der Ausstellung "Cruel and Tender" in der Tate Modern zu sehen sind. So schnell wird in Großbritannien aus Deutschland eine Nation kleiner KZ-"Ärzte".
Das zu lesen ist nicht schön. Die professionell für die Pflege der nicht immer einfachen deutsch-britischen Beziehungen Zuständigen werden durch die hartnäckigen Stereotypen und halb-ernsten, halb-ironischen Anspielungen auf die Nazi-Ära an den Rand der Verzweiflung gebracht. Der seit Juli 2002 amtierende deutsche Botschafter in London, Thomas Matussek, kritisierte bereits vergangenen Winter in einem Interview mit dem Guardian die Beschränkung des Geschichtsunterrichts an britischen Schulen auf Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und Holocaust. Das Echo war geteilt, aber zumindest die Guardian-Leitartikler pflichteten bei: Großbritannien sei es, das in der Vergangenheit gefangen sei - höchste Zeit für ein neues Deutschlandbild.
Aber das ist leicht gesagt, wenn sich gleichzeitig Zeitungen mit Schlagzeilen a la "Blitz Fritz" gut verkaufen. Und die Lust in den Medien steigert sich eher noch, wenn das Hantieren mit antideutschen Ressentiments zum Tabu-Bruch oder tapferen Anschreiben gegen "political correctness" stilisiert werden kann. Bemühungen in Sachen "politischer Öffentlichkeitsarbeit" um ein schönes Deutschland ohne Pickelhaube und Hakenkreuz laufen in Großbritannien seit vierzig Jahren: Schon 1960, als die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien kurzzeitig an einem Tiefpunkt angelangt waren, erhielt die Botschaft in London für PR-Zwecke weit mehr Geld als andere diplomatische Vertretungen in Europa.
Nicht ohne Wirkung. Der Befund ist alles andere als eindeutig. Nur eine kleine Minderheit hält die Deutschen nach wie vor für ein Volk unverbesserlicher, säbelrasselnder, nationalistischer Stechschrittmarschierern. Eine Umfrage von 2001 zeigte, dass lediglich 7 Prozent der befragten Britinnen und Briten "die Deutschen" überhaupt nicht leiden können, dagegen über 40 Prozent Deutschland "gut" oder "sehr gut" finden. Rund 50 Prozent erklärten allerdings, nicht genug zu wissen, um eine Aussage treffen zu können. Eine jüngst erarbeitete Studie, gemeinsam vom Goethe-Institut und dem British Council unter deutschen und britischen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren durchgeführt, kommt zu etwas alarmierenderen Resultaten: Für britische Jugendliche spielt Deutschland eine geringe Rolle als umgekehrt. 34 Prozent kennen Deutschland aus eigener Anschauung - umgekehrt haben 52 Prozent der deutschen Jugendlichen Großbritannien besucht. 64 Prozent der Briten konnten keinen berühmten Deutschen nennen, dagegen fiel nur 19 Prozent der deutschen Jugendlichen kein bekannter Brite ein. Das liegt nicht zuletzt an der Sprache: Nach Angaben des Goethe-Instituts lernt nur noch ein Prozent der britischen Schüler Deutsch im Schulunterricht.
Angeführt von Botschafter Matussek und dem Leiter des Londoner Goethe-Instituts, Ulrich Sacker, will man hierzulande stärker gegensteuern. Gemeinsam mit deutsch-britischen Organisation und Vertretern aus Wirtschaft, Kunst und Medien wurde vor ein paar Monaten eine "creative capital foundation" gegründet. Vergangene Woche ließ die Stiftung in London mit einem Medientreffen den ersten Versuchsballon steigen. Das Geheimrezept heißt: "Branding Germany".
Die Idee, ein Land ähnlich wie ein Markenprodukt zu inszenieren und zu "bewerben", ist nicht neu. Während Image-Kampagnen von Irland und Spanien als Erfolge gelten, hat gerade Großbritannien die Erfahrung gemacht, wie schnell solche Versuche nach hinten losgehen können. Die "Cool-Britannia"-Kampagne, die sich die 1997 gewählte Labour-Regierung von Tony Blair ans Revers stecken wollte, wurde durch die politische Vereinnahmung schnell diskreditiert und eignete sich bald nur noch als ironisches Zitat. Auch ein Nachfolge-Projekt "UK OK" - von der "British Tourism Authority" Anfang 2002 gestartet, um nach der Maul- und Klauenseuche und der Terrorangst wieder mehr Touristen ins Land zu locken - hat seine Kritiker. (Die Buchstabenkombination hat unter anderem den Nachteil, dass sie in "U KOK" umgemünzt werden kann.)
Beim Treffen in Goethe-Institut mit "Branding"- und Marketing-Experten und Medienleuten gab es schon keine Einigkeit, ob "nation branding" überhaupt funktioniert. Überzeugt und zuversichtlich gaben sich naturgemäß diejenigen, die bereits fertige "Deutschland"-Kampagnen in der Schublade haben und auf Großaufträge hoffen. Wally Olins, einer der führende Köpfe des "nation branding", erklärte dramatisch, seit der Wiedervereinigung habe Deutschland die einmalige Gelegenheit, sein Image zu ändern. Bislang sei diese Chance vertan worden, doch noch sei es nicht zu spät.
Die Agentur Wolff Olins arbeitet seit Mitte der 1990er Jahre an "national-branding"-Kampagnen. Ihre Ideen für eine "DE"-Marke ("DE" steht dabei für "Deutschland in Europe" - die Bezeichnung "Germany" soll möglichst verschwinden wie die Germanen) gab es bereits 1998 im ZDF zu sehen. Zu ihren Prämissen gehört, dass es dem häufig technisch geprägten deutschen Image (der Slogan der Automarke Audi, "Vorsprung durch Technik", ist ein klassisches Beispiel) an weiblichen Attributen fehlt. Passe ist das Schwarz-Rot-Gold der bürgerlich-nationalen Revolutionäre des 19. Jahrhundert: Deutschland im 21. Jahrhundert ist "blue-red-yellow". Elemente der Kampagne sind eine kaum bekleidete Claudia Schiffer, die sich als zeitgemäße Germania auf einer gestreiften Briefmarke räkelt, und eine farblich illuminierte Reichstagskuppel.
In Kooperation mit accenture und ECC Kohtes Klewes war man im vergangenen Jahr mit einem so genannten "Spielmacher"-Projekt auf Inhaltssuche. (Das neue Deutschland, so die Kernidee der Werbe-Strategen, will ein "Spielmacher" sein auf dem Fußballfeld der Nationen.) Den "deutschen Stärken" wie "hohe Qualität", "erstklassige Leistung" und "Verlässlichkeit" sollen "neue Werte" an die Seite gestellt werden, Eigenschaften wie "selbstsicher", "verantwortungsbewusst" und "risikobereit". Herauskommen soll am Ende ein selbstbewusstes "Machen wir! Deutschland". Bei der inhaltlichen Füllung zeigte sich jedoch noch eine Menge kreativer Verwendung weißer Fläche. Beim Stichwort "Kultur" lief es letztendlich auf "We've got Goethe, we've got Schiller!" hinaus.
Skeptischer gab sich Chris Powell, Chef von Großbritanniens zweitgrößter Agentur BMP DDP. Man könne Länder nicht "branden" wie eine Dosensuppe, da man weder das "Produkt" noch die weltweite Wahrnehmung kontrollieren könne. Möglich sei es, die "Reputation" eines Landes mit modernen Marketing-Methoden zu beeinflussen und negative Bilder zu korrigieren. Im Zuge der Globalisierung würden Nationen wieder wichtiger, und solche Formen von "public diplomacy" würde in spätestens zehn Jahren jeder Staat der Erde einsetzen. Auch Simon Anhalt, als Gründer von "World Writers" und nun Direktor von "Earthspeak" als "wiz kid" unter den "nation-branding"-Experten gehandelt, strich heraus, erfolgreiches "branding" benötige eine einfache Botschaft, die man bei einem solch komplexen Phänomen wie einer Nation nicht herstellen könne.
Als Beispiel dafür, dass das Ganze kleinteiliger funktionieren kann, wurde die "Learn-German"-Kampagne vorgestellt. Vor einigen Monaten sehr erfolgreich gestartet, hat sie mit selbstreflexiver Ironie einiges erreicht - unter anderem mit einem Plakat, das den schlichten Aufdruck "5:1" zeigte (Anhängern der deutschen Fußballnationalmannschaft auch als "Schande von München" bekannt, die allerdings Schotten, Waliser und Nordiren vollkommen kalt lässt). Die klein gedruckten Aufforderung "Learn German. You've got nothing to lose!" wird nun offenbar wieder stärker befolgt.
Ob deutsche Marken - sprich: Firmen wie Mercedes, BMW, Siemens usw. - sich in Sachen "branding Germany" engagieren sollten, blieb ebenso umstritten wie die Frage des Einsatzes von deutschen Stars als "kulturelle Botschafter". Zwar gilt es weithin als ausgemachte Sache, dass Boris Becker mit seinem Wimbledon-Sieg 1985 enorm viel für das deutsche Image getan hat - ob und wie sich dies für eine nationale "branding"-Kampagne einsetzen ließe, blieb offen. Letztlich sei es das Kosmopolitische und nicht das "Deutsche" von Berühmtheiten, das sie in anderen Ländern akzeptabel mache, warf beispielsweise Chris Rojek ein, Autor des Buches "Celebrities". Das "Supermodel" Nadja Auermann, als potenzielle "cultural ambassador" eingeladen, forderte später, die Deutschen müssten wieder stolz aufs Deutschsein werden und darüber reden.
Die abschließende Journalisten-Runde blieb eher skeptisch. Roger Boyes, der Deutschland-Korrespondent der Times, erklärte, "branding" sei keine Antwort auf das von "postkolonialer Arroganz" geprägte Deutschlandbild der Briten. Catherine Mayer, Korrespondentin des Focus und Vorsitzende der "Foreign Press Association", nannte anti-deutsche Ressentiments einen "tief sitzenden Reflex". Überambitionierte Versuche könnten in Großbritannien nur kontraproduktiv wirken.
Es ist tatsächlich fragwürdig - wie so vieles, nicht zuletzt, wer beispielsweise ein allumfassendes nationales Image bestimmen dürfte - , ob ein neu "ge-brand-etes" Deutschland beispielsweise Silvio Berlusconi beeindrucken würde - oder Kritiker wie Waldemar Januszczak: Vor ein paar Wochen musste er die Max-Beckmann-Austellung niederschreiben, und letzten Sonntag anlässlich der Werkschau von Ernst Ludwig Kirchner den deutschen Expressionismus ein für allemal erledigen. Bei so viel "deutscher" Kunst in London scheint der Beruf zur Qual zu werden.
Das zu lesen ist nicht schön. Die professionell für die Pflege der nicht immer einfachen deutsch-britischen Beziehungen Zuständigen werden durch die hartnäckigen Stereotypen und halb-ernsten, halb-ironischen Anspielungen auf die Nazi-Ära an den Rand der Verzweiflung gebracht. Der seit Juli 2002 amtierende deutsche Botschafter in London, Thomas Matussek, kritisierte bereits vergangenen Winter in einem Interview mit dem Guardian die Beschränkung des Geschichtsunterrichts an britischen Schulen auf Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und Holocaust. Das Echo war geteilt, aber zumindest die Guardian-Leitartikler pflichteten bei: Großbritannien sei es, das in der Vergangenheit gefangen sei - höchste Zeit für ein neues Deutschlandbild.
Aber das ist leicht gesagt, wenn sich gleichzeitig Zeitungen mit Schlagzeilen a la "Blitz Fritz" gut verkaufen. Und die Lust in den Medien steigert sich eher noch, wenn das Hantieren mit antideutschen Ressentiments zum Tabu-Bruch oder tapferen Anschreiben gegen "political correctness" stilisiert werden kann. Bemühungen in Sachen "politischer Öffentlichkeitsarbeit" um ein schönes Deutschland ohne Pickelhaube und Hakenkreuz laufen in Großbritannien seit vierzig Jahren: Schon 1960, als die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien kurzzeitig an einem Tiefpunkt angelangt waren, erhielt die Botschaft in London für PR-Zwecke weit mehr Geld als andere diplomatische Vertretungen in Europa.
Nicht ohne Wirkung. Der Befund ist alles andere als eindeutig. Nur eine kleine Minderheit hält die Deutschen nach wie vor für ein Volk unverbesserlicher, säbelrasselnder, nationalistischer Stechschrittmarschierern. Eine Umfrage von 2001 zeigte, dass lediglich 7 Prozent der befragten Britinnen und Briten "die Deutschen" überhaupt nicht leiden können, dagegen über 40 Prozent Deutschland "gut" oder "sehr gut" finden. Rund 50 Prozent erklärten allerdings, nicht genug zu wissen, um eine Aussage treffen zu können. Eine jüngst erarbeitete Studie, gemeinsam vom Goethe-Institut und dem British Council unter deutschen und britischen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren durchgeführt, kommt zu etwas alarmierenderen Resultaten: Für britische Jugendliche spielt Deutschland eine geringe Rolle als umgekehrt. 34 Prozent kennen Deutschland aus eigener Anschauung - umgekehrt haben 52 Prozent der deutschen Jugendlichen Großbritannien besucht. 64 Prozent der Briten konnten keinen berühmten Deutschen nennen, dagegen fiel nur 19 Prozent der deutschen Jugendlichen kein bekannter Brite ein. Das liegt nicht zuletzt an der Sprache: Nach Angaben des Goethe-Instituts lernt nur noch ein Prozent der britischen Schüler Deutsch im Schulunterricht.
Angeführt von Botschafter Matussek und dem Leiter des Londoner Goethe-Instituts, Ulrich Sacker, will man hierzulande stärker gegensteuern. Gemeinsam mit deutsch-britischen Organisation und Vertretern aus Wirtschaft, Kunst und Medien wurde vor ein paar Monaten eine "creative capital foundation" gegründet. Vergangene Woche ließ die Stiftung in London mit einem Medientreffen den ersten Versuchsballon steigen. Das Geheimrezept heißt: "Branding Germany".
Die Idee, ein Land ähnlich wie ein Markenprodukt zu inszenieren und zu "bewerben", ist nicht neu. Während Image-Kampagnen von Irland und Spanien als Erfolge gelten, hat gerade Großbritannien die Erfahrung gemacht, wie schnell solche Versuche nach hinten losgehen können. Die "Cool-Britannia"-Kampagne, die sich die 1997 gewählte Labour-Regierung von Tony Blair ans Revers stecken wollte, wurde durch die politische Vereinnahmung schnell diskreditiert und eignete sich bald nur noch als ironisches Zitat. Auch ein Nachfolge-Projekt "UK OK" - von der "British Tourism Authority" Anfang 2002 gestartet, um nach der Maul- und Klauenseuche und der Terrorangst wieder mehr Touristen ins Land zu locken - hat seine Kritiker. (Die Buchstabenkombination hat unter anderem den Nachteil, dass sie in "U KOK" umgemünzt werden kann.)
Beim Treffen in Goethe-Institut mit "Branding"- und Marketing-Experten und Medienleuten gab es schon keine Einigkeit, ob "nation branding" überhaupt funktioniert. Überzeugt und zuversichtlich gaben sich naturgemäß diejenigen, die bereits fertige "Deutschland"-Kampagnen in der Schublade haben und auf Großaufträge hoffen. Wally Olins, einer der führende Köpfe des "nation branding", erklärte dramatisch, seit der Wiedervereinigung habe Deutschland die einmalige Gelegenheit, sein Image zu ändern. Bislang sei diese Chance vertan worden, doch noch sei es nicht zu spät.
Die Agentur Wolff Olins arbeitet seit Mitte der 1990er Jahre an "national-branding"-Kampagnen. Ihre Ideen für eine "DE"-Marke ("DE" steht dabei für "Deutschland in Europe" - die Bezeichnung "Germany" soll möglichst verschwinden wie die Germanen) gab es bereits 1998 im ZDF zu sehen. Zu ihren Prämissen gehört, dass es dem häufig technisch geprägten deutschen Image (der Slogan der Automarke Audi, "Vorsprung durch Technik", ist ein klassisches Beispiel) an weiblichen Attributen fehlt. Passe ist das Schwarz-Rot-Gold der bürgerlich-nationalen Revolutionäre des 19. Jahrhundert: Deutschland im 21. Jahrhundert ist "blue-red-yellow". Elemente der Kampagne sind eine kaum bekleidete Claudia Schiffer, die sich als zeitgemäße Germania auf einer gestreiften Briefmarke räkelt, und eine farblich illuminierte Reichstagskuppel.
In Kooperation mit accenture und ECC Kohtes Klewes war man im vergangenen Jahr mit einem so genannten "Spielmacher"-Projekt auf Inhaltssuche. (Das neue Deutschland, so die Kernidee der Werbe-Strategen, will ein "Spielmacher" sein auf dem Fußballfeld der Nationen.) Den "deutschen Stärken" wie "hohe Qualität", "erstklassige Leistung" und "Verlässlichkeit" sollen "neue Werte" an die Seite gestellt werden, Eigenschaften wie "selbstsicher", "verantwortungsbewusst" und "risikobereit". Herauskommen soll am Ende ein selbstbewusstes "Machen wir! Deutschland". Bei der inhaltlichen Füllung zeigte sich jedoch noch eine Menge kreativer Verwendung weißer Fläche. Beim Stichwort "Kultur" lief es letztendlich auf "We've got Goethe, we've got Schiller!" hinaus.
Skeptischer gab sich Chris Powell, Chef von Großbritanniens zweitgrößter Agentur BMP DDP. Man könne Länder nicht "branden" wie eine Dosensuppe, da man weder das "Produkt" noch die weltweite Wahrnehmung kontrollieren könne. Möglich sei es, die "Reputation" eines Landes mit modernen Marketing-Methoden zu beeinflussen und negative Bilder zu korrigieren. Im Zuge der Globalisierung würden Nationen wieder wichtiger, und solche Formen von "public diplomacy" würde in spätestens zehn Jahren jeder Staat der Erde einsetzen. Auch Simon Anhalt, als Gründer von "World Writers" und nun Direktor von "Earthspeak" als "wiz kid" unter den "nation-branding"-Experten gehandelt, strich heraus, erfolgreiches "branding" benötige eine einfache Botschaft, die man bei einem solch komplexen Phänomen wie einer Nation nicht herstellen könne.
Als Beispiel dafür, dass das Ganze kleinteiliger funktionieren kann, wurde die "Learn-German"-Kampagne vorgestellt. Vor einigen Monaten sehr erfolgreich gestartet, hat sie mit selbstreflexiver Ironie einiges erreicht - unter anderem mit einem Plakat, das den schlichten Aufdruck "5:1" zeigte (Anhängern der deutschen Fußballnationalmannschaft auch als "Schande von München" bekannt, die allerdings Schotten, Waliser und Nordiren vollkommen kalt lässt). Die klein gedruckten Aufforderung "Learn German. You've got nothing to lose!" wird nun offenbar wieder stärker befolgt.
Ob deutsche Marken - sprich: Firmen wie Mercedes, BMW, Siemens usw. - sich in Sachen "branding Germany" engagieren sollten, blieb ebenso umstritten wie die Frage des Einsatzes von deutschen Stars als "kulturelle Botschafter". Zwar gilt es weithin als ausgemachte Sache, dass Boris Becker mit seinem Wimbledon-Sieg 1985 enorm viel für das deutsche Image getan hat - ob und wie sich dies für eine nationale "branding"-Kampagne einsetzen ließe, blieb offen. Letztlich sei es das Kosmopolitische und nicht das "Deutsche" von Berühmtheiten, das sie in anderen Ländern akzeptabel mache, warf beispielsweise Chris Rojek ein, Autor des Buches "Celebrities". Das "Supermodel" Nadja Auermann, als potenzielle "cultural ambassador" eingeladen, forderte später, die Deutschen müssten wieder stolz aufs Deutschsein werden und darüber reden.
Die abschließende Journalisten-Runde blieb eher skeptisch. Roger Boyes, der Deutschland-Korrespondent der Times, erklärte, "branding" sei keine Antwort auf das von "postkolonialer Arroganz" geprägte Deutschlandbild der Briten. Catherine Mayer, Korrespondentin des Focus und Vorsitzende der "Foreign Press Association", nannte anti-deutsche Ressentiments einen "tief sitzenden Reflex". Überambitionierte Versuche könnten in Großbritannien nur kontraproduktiv wirken.
Es ist tatsächlich fragwürdig - wie so vieles, nicht zuletzt, wer beispielsweise ein allumfassendes nationales Image bestimmen dürfte - , ob ein neu "ge-brand-etes" Deutschland beispielsweise Silvio Berlusconi beeindrucken würde - oder Kritiker wie Waldemar Januszczak: Vor ein paar Wochen musste er die Max-Beckmann-Austellung niederschreiben, und letzten Sonntag anlässlich der Werkschau von Ernst Ludwig Kirchner den deutschen Expressionismus ein für allemal erledigen. Bei so viel "deutscher" Kunst in London scheint der Beruf zur Qual zu werden.