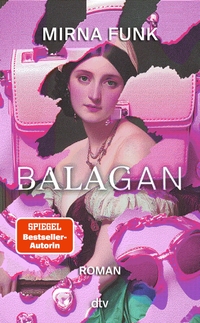Droht den Zeitungen eine Knebelung durch Amazon wie die Musikindustrie sie durch Apple hinnehmen musste? Ausgelöst durch die Horrormeldungen über bankrotte Zeitungen kochte in den USA in den letzten zwei Monaten die Debatte um die Zukunft des Journalismus hoch. Den Anfang machte Joel Brinkley von der Stanford University, der vorschlug, die Zeitungskonzerne sollten sich zusammenschließen und alle für ihre Inhalte Geld verlangen. Hier die wesentlichen Argumente und Vorschläge in der Debatte (eine detailliertere Zusammenfassung mit Links zu allen Artikeln findet man bei Printed Matters):
1. Walter Isaacson plädierte im Time Magazine für Micropayment.
Dagegen spricht:
- Ich zahle nicht im voraus für einen Artikel, denn ich weiß erst nach dem Lesen, ob er mir etwas wert ist
- Ich richte nicht dutzende verschiedene Micropayment-Accounts ein, für all die Quellen, die ich benutze
- Micro ist nur die Kaufsumme für einen Artikel. Ich habe keine Lust, jedesmal im Kopf zusammenzurechnen, wie macro die Gesamtsumme meiner Micropayments in diesem Monat schon ist
- Einen bezahlten Artikel kann ich nicht weitermailen an Freunde, die sich auch für das Thema interessieren.
- Einen kostenpflichtigen Artikel kann ich gar nicht bezahlen, weil ich nie von seiner Existenz erfahren werde, denn Google indexiert ihn nicht.
2. Steve Outing plädierte in Editor and Publisher für Kachingle: Der Leser entscheidet, ob er für einen Artikel zahlen will oder nicht
Dagegen spricht:
- Erfahrung. Die taz erzählt ihm bestimmt gern, wie gut das funktioniert.
- Ein Spendenmodell finanziert keine kontinuierliche Berichterstattung aus Gaza oder dem Irak.
3. David Carr plädierte in der NYT für ein iTunes Modell, gekoppelt an Lesegeräte wie dieses hier von Apple oder Amazons Kindle
Dagegen spricht:
- Alle Gründe, die gegen das Micropayment sprechen.
- Anders als bei Musik, die ich immer wieder höre, will ich einen Artikel nur sehr selten zweimal lesen.
- iTunes ist ein gefährliches Vorbild, denn es zeigt, wie Apple den Musikverkauf quasi monopolisieren und die Preise diktieren konnte. Will man das wirklich auch für den Journalismus oder Bücher?
Dass Amazon mit seinem Kindle auf dem besten Weg ist, sich zu einem Monopolisten für elektronische Inhalte zu entwickeln, der Verlage und Leser gleichermaßen beherrscht, beschreibt Farhad Manjoo in Slate: Lesestoff für den Kindle kann man nur bei Amazon kaufen. Zwar ist es möglich, mit dem Kindle im Netz zu surfen oder persönliche Word-Dokumente hochzuladen, aber das, so Manjoo, ist so langsam und unzuverlässig, dass die Funktionen praktisch nutzlos sind. "Um Blogs, Magazine, Zeitungen und Bücher lesen zu können, muss man wirklich erst durch den Amazon Store. Man kann sehen, wohin das führt: Kindlebesitzer kaufen eine Menge, und je mehr sie kaufen, desto sicherer ist es, dass sie auch in Zukunft bei ihrem Kindle bleiben werden, selbst wenn es einen besseren und offeneren E-Buch-Anbieter gibt. Damit wird Amazon für Buchhändler zum bevorzugten Markt. Wie könnten sie widerstehen, ihren gesamten Katalog einem Händler zur Verfügung zu stellen, der so viele begierige und gefangene Käufer anzieht? ... Alles zusammengenommen weisen diese Trends in eine Richtung: Amazon wird den Markt für E-Bücher beherrschen. Und als Meister des E-Buch-Universums wird Amazon die Preise, das Marketing, überhaupt alles festlegen können, dass mit dem neuen Medium verbunden ist."
Microsoft, Google, iTunes, der Kindle: Es ist doch seltsam, dass ausgerechnet Computer und Internet einerseits die Kommunikation unkomplizierter und freier gemacht haben als jemals zuvor und gleichzeitig in kürzester Zeit mehr Monopole hervorgebracht haben als jede andere Industrie.
1. Walter Isaacson plädierte im Time Magazine für Micropayment.
Dagegen spricht:
- Ich zahle nicht im voraus für einen Artikel, denn ich weiß erst nach dem Lesen, ob er mir etwas wert ist
- Ich richte nicht dutzende verschiedene Micropayment-Accounts ein, für all die Quellen, die ich benutze
- Micro ist nur die Kaufsumme für einen Artikel. Ich habe keine Lust, jedesmal im Kopf zusammenzurechnen, wie macro die Gesamtsumme meiner Micropayments in diesem Monat schon ist
- Einen bezahlten Artikel kann ich nicht weitermailen an Freunde, die sich auch für das Thema interessieren.
- Einen kostenpflichtigen Artikel kann ich gar nicht bezahlen, weil ich nie von seiner Existenz erfahren werde, denn Google indexiert ihn nicht.
2. Steve Outing plädierte in Editor and Publisher für Kachingle: Der Leser entscheidet, ob er für einen Artikel zahlen will oder nicht
Dagegen spricht:
- Erfahrung. Die taz erzählt ihm bestimmt gern, wie gut das funktioniert.
- Ein Spendenmodell finanziert keine kontinuierliche Berichterstattung aus Gaza oder dem Irak.
3. David Carr plädierte in der NYT für ein iTunes Modell, gekoppelt an Lesegeräte wie dieses hier von Apple oder Amazons Kindle
Dagegen spricht:
- Alle Gründe, die gegen das Micropayment sprechen.
- Anders als bei Musik, die ich immer wieder höre, will ich einen Artikel nur sehr selten zweimal lesen.
- iTunes ist ein gefährliches Vorbild, denn es zeigt, wie Apple den Musikverkauf quasi monopolisieren und die Preise diktieren konnte. Will man das wirklich auch für den Journalismus oder Bücher?
Dass Amazon mit seinem Kindle auf dem besten Weg ist, sich zu einem Monopolisten für elektronische Inhalte zu entwickeln, der Verlage und Leser gleichermaßen beherrscht, beschreibt Farhad Manjoo in Slate: Lesestoff für den Kindle kann man nur bei Amazon kaufen. Zwar ist es möglich, mit dem Kindle im Netz zu surfen oder persönliche Word-Dokumente hochzuladen, aber das, so Manjoo, ist so langsam und unzuverlässig, dass die Funktionen praktisch nutzlos sind. "Um Blogs, Magazine, Zeitungen und Bücher lesen zu können, muss man wirklich erst durch den Amazon Store. Man kann sehen, wohin das führt: Kindlebesitzer kaufen eine Menge, und je mehr sie kaufen, desto sicherer ist es, dass sie auch in Zukunft bei ihrem Kindle bleiben werden, selbst wenn es einen besseren und offeneren E-Buch-Anbieter gibt. Damit wird Amazon für Buchhändler zum bevorzugten Markt. Wie könnten sie widerstehen, ihren gesamten Katalog einem Händler zur Verfügung zu stellen, der so viele begierige und gefangene Käufer anzieht? ... Alles zusammengenommen weisen diese Trends in eine Richtung: Amazon wird den Markt für E-Bücher beherrschen. Und als Meister des E-Buch-Universums wird Amazon die Preise, das Marketing, überhaupt alles festlegen können, dass mit dem neuen Medium verbunden ist."
Microsoft, Google, iTunes, der Kindle: Es ist doch seltsam, dass ausgerechnet Computer und Internet einerseits die Kommunikation unkomplizierter und freier gemacht haben als jemals zuvor und gleichzeitig in kürzester Zeit mehr Monopole hervorgebracht haben als jede andere Industrie.
Kommentieren