 Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: SchleifenFranziska Denk wächst im Umfeld des Wiener Kreises auf und leidet als Kind an einer seltsamen Krankheit: Jedes Symptom, von dem sie hört oder liest, bekommt sie sofort. In…
 Beinahe wäre es an uns vorbeigegangen, dass Rumänien dieses Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse war, so wenig wurde die Werbetrommel für die rumänischen Autoren gerührt - obwohl natürlich einige Auserwählte die obligatorische Reise ins Gastland antreten durften. Einen umfassenden Einblick in die neue und nicht ganz so neue rumänische Literatur gibt Markus Bauer in der NZZ. Jan Böttcher, der sich bis in die Karpaten wagte, schickte eine schöne Reportage an die Zeit, in der man Anregungen zum Weitersuchen findet. Unter den besprochenen Büchern des Frühjahrs finden sich leider nur wenige rumänische, doch wurden sie immerhin sehr gut besprochen. Zum Beispiel Cǎtǎlin Mihuleac, der in seinem Roman "Oxenberg & Bernstein" das Grauen des Progroms von Iași im Juni 1941 mit der rumänischen Gegenwart und den 30er Jahren gegenschneidet. Damit sorgte er in Rumänien für Furore, erzählt Holger Heimann im Deutschlandfunk: "Über die Verstrickung von rumänischen Behörden und der Bevölkerung in den Holocaust wird offenbar bis heute ungern gesprochen. Nur so lassen sich wohl die heftigen Reaktionen ... erklären." Man darf sich nur nicht von der frivolen und flapsigen Sprache irritieren lassen, mit der Mihuleac das Vorkriegs- und Nachwende-Rumänien aufs Korn nimmt, warnt Katrin Hillgruber im Tagesspiegel. Andreas Platthaus stimmt dem in der FAZ zu: Überwindet man seinen inneren Widerstand dagegen, verspricht er, "erweist sich der Roman als eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, die man nicht vergessen wird".
Beinahe wäre es an uns vorbeigegangen, dass Rumänien dieses Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse war, so wenig wurde die Werbetrommel für die rumänischen Autoren gerührt - obwohl natürlich einige Auserwählte die obligatorische Reise ins Gastland antreten durften. Einen umfassenden Einblick in die neue und nicht ganz so neue rumänische Literatur gibt Markus Bauer in der NZZ. Jan Böttcher, der sich bis in die Karpaten wagte, schickte eine schöne Reportage an die Zeit, in der man Anregungen zum Weitersuchen findet. Unter den besprochenen Büchern des Frühjahrs finden sich leider nur wenige rumänische, doch wurden sie immerhin sehr gut besprochen. Zum Beispiel Cǎtǎlin Mihuleac, der in seinem Roman "Oxenberg & Bernstein" das Grauen des Progroms von Iași im Juni 1941 mit der rumänischen Gegenwart und den 30er Jahren gegenschneidet. Damit sorgte er in Rumänien für Furore, erzählt Holger Heimann im Deutschlandfunk: "Über die Verstrickung von rumänischen Behörden und der Bevölkerung in den Holocaust wird offenbar bis heute ungern gesprochen. Nur so lassen sich wohl die heftigen Reaktionen ... erklären." Man darf sich nur nicht von der frivolen und flapsigen Sprache irritieren lassen, mit der Mihuleac das Vorkriegs- und Nachwende-Rumänien aufs Korn nimmt, warnt Katrin Hillgruber im Tagesspiegel. Andreas Platthaus stimmt dem in der FAZ zu: Überwindet man seinen inneren Widerstand dagegen, verspricht er, "erweist sich der Roman als eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, die man nicht vergessen wird".  Die Autorin Lavinia Braniște fängt in ihrem preisgekrönten Romandebüt "Null Komma Irgendwas" wunderbar den rumänischen Alltag ein, "lakonisch und distanziert", lobt Mirko Schwanitz im NDR. Die 32-jährige Hauptfigur Cristina fristet ein tristes Leben als Übersetzerin im Baugewerbe, weil es für ihr eigentliches Berufsfeld, die Kulturbranche, kein Geld in Rumänien gibt. Birthe Mühlhoff hat den Roman für Zeit online gelesen und sich trotz der allgegenwärtigen Tristesse herrlich amüsiert: Die Strategien zum Zeittotschlagen, die Braniște hier präsentiert, findet sie wunderbar ironisch. Dass Cristina wie Braniște selbst von ihren Großeltern aufgezogen wurde, weil ihre Mutter in Spanien arbeitet, zeigt Mühlhoff, dass Migration auch eine "Form der Entwicklungshilfe" sein kann. Den Kontrast, den die Finanzspritzen aus dem Ausland zum Baugewerbe bilden, in dem die Gelder gerne versickern, hält die Rezensentin für ein besonders gelungenes Spiel mit den Klischees über Osteuropa. "Das ist stark erzählt", ruft Jan Böttcher in der Zeit.
Die Autorin Lavinia Braniște fängt in ihrem preisgekrönten Romandebüt "Null Komma Irgendwas" wunderbar den rumänischen Alltag ein, "lakonisch und distanziert", lobt Mirko Schwanitz im NDR. Die 32-jährige Hauptfigur Cristina fristet ein tristes Leben als Übersetzerin im Baugewerbe, weil es für ihr eigentliches Berufsfeld, die Kulturbranche, kein Geld in Rumänien gibt. Birthe Mühlhoff hat den Roman für Zeit online gelesen und sich trotz der allgegenwärtigen Tristesse herrlich amüsiert: Die Strategien zum Zeittotschlagen, die Braniște hier präsentiert, findet sie wunderbar ironisch. Dass Cristina wie Braniște selbst von ihren Großeltern aufgezogen wurde, weil ihre Mutter in Spanien arbeitet, zeigt Mühlhoff, dass Migration auch eine "Form der Entwicklungshilfe" sein kann. Den Kontrast, den die Finanzspritzen aus dem Ausland zum Baugewerbe bilden, in dem die Gelder gerne versickern, hält die Rezensentin für ein besonders gelungenes Spiel mit den Klischees über Osteuropa. "Das ist stark erzählt", ruft Jan Böttcher in der Zeit.
 Gut besprochen wurden auch Ion Luca Caragiales Sammlung von Kurzerzählungen "Humbug und Variationen" die Andreas Platthaus in der FAZ als große Autorenkunst preist, sowie Ilinca Florians Roman "Als wir das Lügen lernten" in dem die Autorin eine Sechsjährige von dem letzten Jahr erzählen lässt, bevor sie mit ihrer Familie Rumänien verlässt. Während die kleine Ich-Erzählerin nicht überschauen kann, wie ihre Eindrücke zusammenhängen, ergibt sich für den Leser ein Porträt des Lebens im sozialistischen Rumänien der letzten Regierungsmonate Ceaucescus', das den SZ-Kritiker Helmut Böttiger begeistert hat.
Gut besprochen wurden auch Ion Luca Caragiales Sammlung von Kurzerzählungen "Humbug und Variationen" die Andreas Platthaus in der FAZ als große Autorenkunst preist, sowie Ilinca Florians Roman "Als wir das Lügen lernten" in dem die Autorin eine Sechsjährige von dem letzten Jahr erzählen lässt, bevor sie mit ihrer Familie Rumänien verlässt. Während die kleine Ich-Erzählerin nicht überschauen kann, wie ihre Eindrücke zusammenhängen, ergibt sich für den Leser ein Porträt des Lebens im sozialistischen Rumänien der letzten Regierungsmonate Ceaucescus', das den SZ-Kritiker Helmut Böttiger begeistert hat. Die Schweizer Autorin Judith Keller legt mit den in ihrem Band "Die Fragwürdigen" versammelten Kürzestgeschichten ein grandioses Debüt vor, versichern die KritikerInnen. Amüsant und gehaltvoll nennt NZZ-Rezensent Sebastien Fanzun die Stories, die ihm ein Ensemble authentischer Figuren vorführen, die stets ihrer Würde bewahren - auch wenn andere über ihre abgedroschenen Phrasen lachen. Für Insa Wilke (SZ) ist das Buch ein "kleines sprachliches Wunderwerk", das ihr auf einer Fahrt in der Zürcher Straßenbahn ganz nebenbei einen eindringlichen Blick in eine Gesellschaft bietet, die den Wert von Menschen hauptsächlich an ihrer Brauchbarkeit bemisst. Großartig, wie bildgewaltig und human Keller auf demente Senioren, Arbeiter, sorgenvolle Familienväter und Arbeitslose blickt, meint sie.
Die Schweizer Autorin Judith Keller legt mit den in ihrem Band "Die Fragwürdigen" versammelten Kürzestgeschichten ein grandioses Debüt vor, versichern die KritikerInnen. Amüsant und gehaltvoll nennt NZZ-Rezensent Sebastien Fanzun die Stories, die ihm ein Ensemble authentischer Figuren vorführen, die stets ihrer Würde bewahren - auch wenn andere über ihre abgedroschenen Phrasen lachen. Für Insa Wilke (SZ) ist das Buch ein "kleines sprachliches Wunderwerk", das ihr auf einer Fahrt in der Zürcher Straßenbahn ganz nebenbei einen eindringlichen Blick in eine Gesellschaft bietet, die den Wert von Menschen hauptsächlich an ihrer Brauchbarkeit bemisst. Großartig, wie bildgewaltig und human Keller auf demente Senioren, Arbeiter, sorgenvolle Familienväter und Arbeitslose blickt, meint sie. 
 In die DDR der Siebziger, genauer in die Harzkäffer Elend und Sorge, führt "Die grüne Grenze" der Debütroman der amerikanischen Hilbig- und Fühmann-Übersetzerin Isabel Fargo Cole, der von einem ins Ländliche ausgewanderten Berliner Künstlerpaar erzählt, das kurz vor der Wende mit seiner verdrängten Vergangenheit konfrontiert wird. Christian Eger zeigt sich in der FR begeistert von der historischen, sozialen und kulturellen Genauigkeit der Details dieses Deutschlandromans, der es laut Kritiker sowohl zeitgeschichtlich als auch poetisch in sich hat. Und in der SZ staunt Hans-Peter Kunisch, wie die Autorin den klassisch deutschen Sound trifft. Außerdem gut besprochen wurde Emily Ruskovichs Debütroman "Idaho" der von der Witwe eines Demenzkranken erzählt, die versucht zu ergründen, weshalb dessen erste Frau in den Siebzigern die jüngste Tochter erschlug. Feinsinnig konstruiert, subtil und gleichzeitig sinnlich nennt Ulrich Baron in der SZ den Roman.
In die DDR der Siebziger, genauer in die Harzkäffer Elend und Sorge, führt "Die grüne Grenze" der Debütroman der amerikanischen Hilbig- und Fühmann-Übersetzerin Isabel Fargo Cole, der von einem ins Ländliche ausgewanderten Berliner Künstlerpaar erzählt, das kurz vor der Wende mit seiner verdrängten Vergangenheit konfrontiert wird. Christian Eger zeigt sich in der FR begeistert von der historischen, sozialen und kulturellen Genauigkeit der Details dieses Deutschlandromans, der es laut Kritiker sowohl zeitgeschichtlich als auch poetisch in sich hat. Und in der SZ staunt Hans-Peter Kunisch, wie die Autorin den klassisch deutschen Sound trifft. Außerdem gut besprochen wurde Emily Ruskovichs Debütroman "Idaho" der von der Witwe eines Demenzkranken erzählt, die versucht zu ergründen, weshalb dessen erste Frau in den Siebzigern die jüngste Tochter erschlug. Feinsinnig konstruiert, subtil und gleichzeitig sinnlich nennt Ulrich Baron in der SZ den Roman. Hölle! Apokalypse! Expressionistisch monumental! - So schallt es uns aus den Kritiken zu Serhji Zhadans neuem Roman "Internat" entgegen, die Autorin Katja Petrowskaja nennt Zhadan in der FAS gar einen lebenden Klassiker und ein "gefährliches Talent" zugleich. Der ukrainische Dichter und Musiker schickt hier den Lehrer Pascha auf einen Roadtrip durch den Krieg im Donbass, er soll seinen erkrankten Neffen aus dem Internat am anderen Ende der Stadt holen. Sein Weg führt durch die Kriegszone, in der sich Separatisten, Milizionäre und ukrainische Soldaten gegenseitig in Schach halten. SZ-Kritiker Felix Stephan folgt Zhadan durch ein "atemloses Lebensgefahr-Stakkato" und liest fasziniert, wie unaufhaltsam Pascha immer tiefer in die kriegerische "Welt nach der Zivilisation" gezogen wird. Der Krieg im Donbass erschließt sich ihm als "Beckett'sches Bedeutungsvakuum", in dem der Held dennoch eine Haltung und Moral entwickeln muss. In Dlf-Kultur lobt Maike Albath die "eigentümliche, hyperwache Stimmung" des Romans. In der FAZ liest Kerstin Holm den Roman als ein subtiles Drama vor allem der russischen Sprache, die hier in verschieden klingenden Akzenten ihren Auftritt hat, und die Juri Durkot und Sabine Stöhr "vorzüglich" übertragen haben. Die beiden wurden dann auch mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet.
Hölle! Apokalypse! Expressionistisch monumental! - So schallt es uns aus den Kritiken zu Serhji Zhadans neuem Roman "Internat" entgegen, die Autorin Katja Petrowskaja nennt Zhadan in der FAS gar einen lebenden Klassiker und ein "gefährliches Talent" zugleich. Der ukrainische Dichter und Musiker schickt hier den Lehrer Pascha auf einen Roadtrip durch den Krieg im Donbass, er soll seinen erkrankten Neffen aus dem Internat am anderen Ende der Stadt holen. Sein Weg führt durch die Kriegszone, in der sich Separatisten, Milizionäre und ukrainische Soldaten gegenseitig in Schach halten. SZ-Kritiker Felix Stephan folgt Zhadan durch ein "atemloses Lebensgefahr-Stakkato" und liest fasziniert, wie unaufhaltsam Pascha immer tiefer in die kriegerische "Welt nach der Zivilisation" gezogen wird. Der Krieg im Donbass erschließt sich ihm als "Beckett'sches Bedeutungsvakuum", in dem der Held dennoch eine Haltung und Moral entwickeln muss. In Dlf-Kultur lobt Maike Albath die "eigentümliche, hyperwache Stimmung" des Romans. In der FAZ liest Kerstin Holm den Roman als ein subtiles Drama vor allem der russischen Sprache, die hier in verschieden klingenden Akzenten ihren Auftritt hat, und die Juri Durkot und Sabine Stöhr "vorzüglich" übertragen haben. Die beiden wurden dann auch mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet. Der meist diskutierte deutsche Roman in dieser Saison war Monika Marons "Munin oder Chaos im Kopf" den wir schon im letzten Bücherbrief vorgestellt haben: Als Kiezroman, politischen Roman, Thesenroman, Stimmungsbild zur Lage der Nation versuchten die Kritiker das 224 Seiten schlanke Buch einzusortieren. Rainer Moritz führte in der NZZ den Kritikerreigen mit einem lautstarken Verriss an. Die Auseinandersetzungen der Ich-Erzählerin mit einer Krähe über tagespolitische Themen, die eingebettet sind in einen Streit der Nachbarn über eine unbelehrbare Sängerin auf dem Balkon gegenüber, empfand Moritz als "Kampfrhetorik" einer sich hinter ihrer Erzählerin versteckenden Autorin gegen Muslime. Andere Kritiker in Zeit und FAZ, FAS und FR, SZ und Welt wollten dem nicht folgen. In der Zeit erkennt Iris Radisch die Krähe als Korrektiv zu den ins Apokalyptische neigenden Überlegungen der Autorin. Welt-Kritiker Tilman Krause findet die Verwirrungen der Gegenwart assoziationsreich gedeutet. Und überhaupt ist Maron viel zu selbstironisch, präzise und elegant, um einen platten politschen Thesenroman abzuliefern - da sind sich die Kritiker mit Ausnahme von Moritz einig.
Der meist diskutierte deutsche Roman in dieser Saison war Monika Marons "Munin oder Chaos im Kopf" den wir schon im letzten Bücherbrief vorgestellt haben: Als Kiezroman, politischen Roman, Thesenroman, Stimmungsbild zur Lage der Nation versuchten die Kritiker das 224 Seiten schlanke Buch einzusortieren. Rainer Moritz führte in der NZZ den Kritikerreigen mit einem lautstarken Verriss an. Die Auseinandersetzungen der Ich-Erzählerin mit einer Krähe über tagespolitische Themen, die eingebettet sind in einen Streit der Nachbarn über eine unbelehrbare Sängerin auf dem Balkon gegenüber, empfand Moritz als "Kampfrhetorik" einer sich hinter ihrer Erzählerin versteckenden Autorin gegen Muslime. Andere Kritiker in Zeit und FAZ, FAS und FR, SZ und Welt wollten dem nicht folgen. In der Zeit erkennt Iris Radisch die Krähe als Korrektiv zu den ins Apokalyptische neigenden Überlegungen der Autorin. Welt-Kritiker Tilman Krause findet die Verwirrungen der Gegenwart assoziationsreich gedeutet. Und überhaupt ist Maron viel zu selbstironisch, präzise und elegant, um einen platten politschen Thesenroman abzuliefern - da sind sich die Kritiker mit Ausnahme von Moritz einig.
 Hingewiesen sei auch noch einmal auf Norbert Gstreins Roman "Die kommenden Jahre" der mit seiner Geschichte eines auseinander driftenden Ehepaares die Lebenslügen seiner Generation auf den Punkt bringt, und Joshua Cohens "Buch der Zahlen" das als eine Art "Zauberberg" des Internetzeitalters und der große Epochenroman der Zehner Jahre gefeiert wurde.
Hingewiesen sei auch noch einmal auf Norbert Gstreins Roman "Die kommenden Jahre" der mit seiner Geschichte eines auseinander driftenden Ehepaares die Lebenslügen seiner Generation auf den Punkt bringt, und Joshua Cohens "Buch der Zahlen" das als eine Art "Zauberberg" des Internetzeitalters und der große Epochenroman der Zehner Jahre gefeiert wurde.  Das Gröbste schon hinter sich, aber noch einiges vor haben die sechzehn ich-erzählenden Schüler in Julia Schochs neuem Roman "Schöne Seelen und Komplizen" die kurz nach der Wende an einem Elitegymnasium der ehemaligen DDR ihr Abitur absolvieren - und knapp 30 Jahre später darüber nachdenken, wie der historische Umbruch sie geprägt hat. So viel Inhalt, so viel Gefühl, so viel Vergangenheit und Gegenwart auf nur 300 Seiten, staunt Rezensent Hubert Winkels in der SZ. Für taz-Kritikerin Eva Behrendt klingen die sechzehn Stimmen zwar alle ähnlich, dass die Autorin das all ihren Figuren gemeine Verlustgefühl nicht einfach als Unbehagen an der westlichen Gesellschaft erklärt, findet sie allerdings stark.
Das Gröbste schon hinter sich, aber noch einiges vor haben die sechzehn ich-erzählenden Schüler in Julia Schochs neuem Roman "Schöne Seelen und Komplizen" die kurz nach der Wende an einem Elitegymnasium der ehemaligen DDR ihr Abitur absolvieren - und knapp 30 Jahre später darüber nachdenken, wie der historische Umbruch sie geprägt hat. So viel Inhalt, so viel Gefühl, so viel Vergangenheit und Gegenwart auf nur 300 Seiten, staunt Rezensent Hubert Winkels in der SZ. Für taz-Kritikerin Eva Behrendt klingen die sechzehn Stimmen zwar alle ähnlich, dass die Autorin das all ihren Figuren gemeine Verlustgefühl nicht einfach als Unbehagen an der westlichen Gesellschaft erklärt, findet sie allerdings stark. 
 Einen Aufbruch der anderen Art wagt indes die Ich-Erzählerin in Esther Kinskys mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichneten Geländeroman "Hain" "Traurig, kostbar und reich" zwischen Leben und Erinnerung hin- und herpendelnd, so Tilman Spreckelsen in der FAZ, leise bis zum Unsichtbaren, so Hubert Winkels in der SZ, nimmt uns Kinsky mit auf die Trauerreise einer jungen Witwe durch Italiens Herbstlandschaften und das Reich der Toten. Sehr lesenswert finden die Kritiker auch Jakob Heins neuen Roman "Die Orient-Mission des Leutnant Stern" der die Geschichte des jüdischen Leutnants Edgar Stern erzählt, der 1914 für Wilhelm II. den Dschihad organisieren sollte.
Einen Aufbruch der anderen Art wagt indes die Ich-Erzählerin in Esther Kinskys mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichneten Geländeroman "Hain" "Traurig, kostbar und reich" zwischen Leben und Erinnerung hin- und herpendelnd, so Tilman Spreckelsen in der FAZ, leise bis zum Unsichtbaren, so Hubert Winkels in der SZ, nimmt uns Kinsky mit auf die Trauerreise einer jungen Witwe durch Italiens Herbstlandschaften und das Reich der Toten. Sehr lesenswert finden die Kritiker auch Jakob Heins neuen Roman "Die Orient-Mission des Leutnant Stern" der die Geschichte des jüdischen Leutnants Edgar Stern erzählt, der 1914 für Wilhelm II. den Dschihad organisieren sollte. In zwei Punkten sind sich die KritikerInnen einig: Georg Kleins neuer Science-Fiction-Roman "Miakro" ist ein Meisterwerk - und einfach nicht zu fassen. Für FR-Kritikerin Judith von Sternburg ist der Roman das prächtigste und schaurigste Ding des Frühjahrs - wenngleich sie nur ahnen kann, wovon dieser in einem unterirdischen, lebendigen, gebärmutterartigen Gebäudekomplex spielende Roman, in dem die Wände Nahrung absondern, es keinen Sex und keinen Tod gibt und sich eine kleine Gruppe von Bewohnern auf den Weg macht, die Welt außerhalb dieses Kosmos' zu erkunden, eigentlich handelt. Klein ist halt der Meister des fantastischen Erzählens, versichert Philipp Theisson in der NZZ, kaum jemand könne Okkultes und Analyse so brillant verknüpfen. "Halluzinogene Prosa" vom Feinsten, findet er. Und erst dieser Sinn für Perspektivwechsel und Beklemmung - ganz ohne Psychologisierung und Erklärungen, schwärmt Sternburg. Das größte Abenteuer aber ist die Sprache, erklärt SZ-Rezensent Thomas Steinfeld: Ein Glücksfall, wie Klein mittels Dichtung eine neue Wirklichkeit schafft, meint er; überbordend an poetischer Kraft und Dynamik, schreibt Steffen Martus in der Zeit - oder ist das ganze etwa eine einzige Sprachkritik, fragt FAZ-Kritiker Jan Wiele, der während Lektüre eine ordentliche Portion Ekel runterschlucken musste. Hinter das Geheimnis seines Romans führt Klein im Dlf-Kultur-Gespräch mit Frank Meyer.
In zwei Punkten sind sich die KritikerInnen einig: Georg Kleins neuer Science-Fiction-Roman "Miakro" ist ein Meisterwerk - und einfach nicht zu fassen. Für FR-Kritikerin Judith von Sternburg ist der Roman das prächtigste und schaurigste Ding des Frühjahrs - wenngleich sie nur ahnen kann, wovon dieser in einem unterirdischen, lebendigen, gebärmutterartigen Gebäudekomplex spielende Roman, in dem die Wände Nahrung absondern, es keinen Sex und keinen Tod gibt und sich eine kleine Gruppe von Bewohnern auf den Weg macht, die Welt außerhalb dieses Kosmos' zu erkunden, eigentlich handelt. Klein ist halt der Meister des fantastischen Erzählens, versichert Philipp Theisson in der NZZ, kaum jemand könne Okkultes und Analyse so brillant verknüpfen. "Halluzinogene Prosa" vom Feinsten, findet er. Und erst dieser Sinn für Perspektivwechsel und Beklemmung - ganz ohne Psychologisierung und Erklärungen, schwärmt Sternburg. Das größte Abenteuer aber ist die Sprache, erklärt SZ-Rezensent Thomas Steinfeld: Ein Glücksfall, wie Klein mittels Dichtung eine neue Wirklichkeit schafft, meint er; überbordend an poetischer Kraft und Dynamik, schreibt Steffen Martus in der Zeit - oder ist das ganze etwa eine einzige Sprachkritik, fragt FAZ-Kritiker Jan Wiele, der während Lektüre eine ordentliche Portion Ekel runterschlucken musste. Hinter das Geheimnis seines Romans führt Klein im Dlf-Kultur-Gespräch mit Frank Meyer.
 Szenenwechsel von der Gebärmutter in einen Conbini - einen japanischen 24-Stunden-Supermarkt. Dorthin entführt uns Sayaka Murata mit ihrem in Japan zum Bestseller avancierten Roman "Die Ladenhüterin" der von der jungen Studentin Keiko erzählt, deren Welt gleich zweimal ins Wanken gerät: Irritiert von ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen, fängt sie als Aushilfe in einem Supermarkt an, verschmilzt ganz auf Funktion eingestellt mit dessen Ordnung und wird durch die seltsame Liebesgeschichte mit einem jungen, zynischen Mann wieder aus ihrem Mikrokosmos gerissen. Zeit-Kritiker Ronald Düker lässt sich fasziniert von der rätselhaften Sphäre des Romans aufsaugen, staunt wie feinsinnig Murata ihren "sozialen Alien" schildert und liest dieses "brillant kalte" Buch wie eine Fallstudie aus Kracauers "Soziologie des Angestellten". In der ZDF-Mediathek steht ein Aspekte-Beitrag zur Ladenhüterin online. Zurück zu einem mysteriösen Kindesmord im Japan der späten Achtziger, in die japanische Gesellschaft der Nuller Jahre und auf die verschlungenen Pfade eines (Polizei-)Verwaltungsapparats schickt uns Hideo Yokoyamas hochgelobter Thriller "64" : Wie der Autor den wegen eines Ermittlungsfehlers noch immer ungesühnten Mord an einem Mädchen wieder aufrollt, Tradition und Ehre, Bürokratie und Hierarchie, Empathie und Mitleid anhand seines Helden, eines skrupulösen Pressedirektors in einem zentraljapanischen Polizeipräsidium, verhandelt, lässt für Tobias Gohlis (Zeit) nur einen Schluss zu: Krimi-Nobelpreis, bitte!
Szenenwechsel von der Gebärmutter in einen Conbini - einen japanischen 24-Stunden-Supermarkt. Dorthin entführt uns Sayaka Murata mit ihrem in Japan zum Bestseller avancierten Roman "Die Ladenhüterin" der von der jungen Studentin Keiko erzählt, deren Welt gleich zweimal ins Wanken gerät: Irritiert von ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen, fängt sie als Aushilfe in einem Supermarkt an, verschmilzt ganz auf Funktion eingestellt mit dessen Ordnung und wird durch die seltsame Liebesgeschichte mit einem jungen, zynischen Mann wieder aus ihrem Mikrokosmos gerissen. Zeit-Kritiker Ronald Düker lässt sich fasziniert von der rätselhaften Sphäre des Romans aufsaugen, staunt wie feinsinnig Murata ihren "sozialen Alien" schildert und liest dieses "brillant kalte" Buch wie eine Fallstudie aus Kracauers "Soziologie des Angestellten". In der ZDF-Mediathek steht ein Aspekte-Beitrag zur Ladenhüterin online. Zurück zu einem mysteriösen Kindesmord im Japan der späten Achtziger, in die japanische Gesellschaft der Nuller Jahre und auf die verschlungenen Pfade eines (Polizei-)Verwaltungsapparats schickt uns Hideo Yokoyamas hochgelobter Thriller "64" : Wie der Autor den wegen eines Ermittlungsfehlers noch immer ungesühnten Mord an einem Mädchen wieder aufrollt, Tradition und Ehre, Bürokratie und Hierarchie, Empathie und Mitleid anhand seines Helden, eines skrupulösen Pressedirektors in einem zentraljapanischen Polizeipräsidium, verhandelt, lässt für Tobias Gohlis (Zeit) nur einen Schluss zu: Krimi-Nobelpreis, bitte! Auf dem Buchumschlag steht zwar Clemens Setz als "Autor" und "Bot" als Titel, aber das Buch ist entstanden aus Fragen der Herausgeberin Angelika Klammer an den Grazer Schriftsteller, der ihr sein computergespeichertes Notatgewimmel für Zufallsabfragen zur Verfügung gestellt hat, weiß taz-Kritiker Ekkehard Knörrer, der Setz' Vorbilder bis in den Surrealismus und die Romantik Jean Pauls zurückverfolgt. Insgesamt zeigen sich die Kritiker begeistert von dem dieses Mal offenbar auf die Spitze getriebenen Verwirrspiel des Autors: Setz kann wohl gar nicht anders als die Realität ins Luftige zu zerstäuben, meint FAZ-Kritiker Oliver Jungen und würdigt das Werk als "Psychogramm eines romantischen Geistes". In Dlf-Kultur staunt Verena Auffermann, wie Setz den im Buch Hiob, in der Barockliteratur, in Schriften des 18. Jahrhunderts oder in Gebrauchsanweisungen für Roboter entdeckten Antworten neuen Drive verleiht. SZ-Kritiker Lothar Müller hält sich während des wilden Lektüreritts am nerdigen, wachen Geist und dem Sprachgefühl des Autors fest. In der Zeit glaubt Hubert Winkels dank Setz wieder an die Literatur. Nur im Spiegel warnt Jerome Jaminet vor dem "Kommunikationsjazz" des Autors.
Auf dem Buchumschlag steht zwar Clemens Setz als "Autor" und "Bot" als Titel, aber das Buch ist entstanden aus Fragen der Herausgeberin Angelika Klammer an den Grazer Schriftsteller, der ihr sein computergespeichertes Notatgewimmel für Zufallsabfragen zur Verfügung gestellt hat, weiß taz-Kritiker Ekkehard Knörrer, der Setz' Vorbilder bis in den Surrealismus und die Romantik Jean Pauls zurückverfolgt. Insgesamt zeigen sich die Kritiker begeistert von dem dieses Mal offenbar auf die Spitze getriebenen Verwirrspiel des Autors: Setz kann wohl gar nicht anders als die Realität ins Luftige zu zerstäuben, meint FAZ-Kritiker Oliver Jungen und würdigt das Werk als "Psychogramm eines romantischen Geistes". In Dlf-Kultur staunt Verena Auffermann, wie Setz den im Buch Hiob, in der Barockliteratur, in Schriften des 18. Jahrhunderts oder in Gebrauchsanweisungen für Roboter entdeckten Antworten neuen Drive verleiht. SZ-Kritiker Lothar Müller hält sich während des wilden Lektüreritts am nerdigen, wachen Geist und dem Sprachgefühl des Autors fest. In der Zeit glaubt Hubert Winkels dank Setz wieder an die Literatur. Nur im Spiegel warnt Jerome Jaminet vor dem "Kommunikationsjazz" des Autors.
 Auch Matthias Senkels Roman "Dunkle Zahlen" mutet uns einiges zu: Hier schreibt ein Bot avant la lettre, genauer: eine sowjetische Literaturmaschine der Sechziger, ahnen die Kritiker, die sich bereitwillig auf Senkels irrwitziges Experiment eingelassen haben. "Wild und virtuos" nennt FAZ-Kritiker Jürgen Kaube dieses "karnevaleske" und mit etlichen Anekdoten gespickte Poem, in dem er als zentralen Handlungsstrang eine Computer-Spartakiade erkennt, zu der sich 1985 Informatiker, Nerds und KGB-Agenten in Moskau zusammenfinden. In der SZ freut sich Lothar Müller vor allem über den kleinen Spionagethriller, den Senkel in seinen Stoff um die späte Sowjetunion, um Datentechnologie, statistische Dunkelziffern und okkultes Wissen eingebaut hat. taz-Kritiker Jan Süselbeck hat trotz größerer Lektüremühen viel Vergnügen mit diesem "Avantgarde-Monstrum". Meike Fessmann (Tagesspiegel) lobt "Witz und Intelligenz" dieses "funkelnden Husarenstücks". Finster, aber unbedingt lesenswert fällt auch der Blick in die Vergangenheit aus: Ernst Lothars bereits 1949 erschienener und nun unter Mitarbeit von Doron Rabinovici neu editierter Roman "Die Rückkehr" der die Geschichte des jungen Großbürgers Felix erzählt, der aufgrund seiner anti-nazistischen Haltung nach New York flieht, in der Nachkriegszeit nach Wien zurückkehrt und vom Bürgertum geächtet wird, bietet laut SZ-Kritikerin Verena Mayer eine präzise Analyse der "Wiener Niedertracht".
Auch Matthias Senkels Roman "Dunkle Zahlen" mutet uns einiges zu: Hier schreibt ein Bot avant la lettre, genauer: eine sowjetische Literaturmaschine der Sechziger, ahnen die Kritiker, die sich bereitwillig auf Senkels irrwitziges Experiment eingelassen haben. "Wild und virtuos" nennt FAZ-Kritiker Jürgen Kaube dieses "karnevaleske" und mit etlichen Anekdoten gespickte Poem, in dem er als zentralen Handlungsstrang eine Computer-Spartakiade erkennt, zu der sich 1985 Informatiker, Nerds und KGB-Agenten in Moskau zusammenfinden. In der SZ freut sich Lothar Müller vor allem über den kleinen Spionagethriller, den Senkel in seinen Stoff um die späte Sowjetunion, um Datentechnologie, statistische Dunkelziffern und okkultes Wissen eingebaut hat. taz-Kritiker Jan Süselbeck hat trotz größerer Lektüremühen viel Vergnügen mit diesem "Avantgarde-Monstrum". Meike Fessmann (Tagesspiegel) lobt "Witz und Intelligenz" dieses "funkelnden Husarenstücks". Finster, aber unbedingt lesenswert fällt auch der Blick in die Vergangenheit aus: Ernst Lothars bereits 1949 erschienener und nun unter Mitarbeit von Doron Rabinovici neu editierter Roman "Die Rückkehr" der die Geschichte des jungen Großbürgers Felix erzählt, der aufgrund seiner anti-nazistischen Haltung nach New York flieht, in der Nachkriegszeit nach Wien zurückkehrt und vom Bürgertum geächtet wird, bietet laut SZ-Kritikerin Verena Mayer eine präzise Analyse der "Wiener Niedertracht". Die in "Keiner Menschenseele kann man noch trauen" versammelten Kurzgeschichten der amerikanischen Autorin Flannery O'Connor sind größtenteils 1965 entstanden - und doch brandaktuell, versichern die Kritikerinnen: O'Connor erzählt aus ihrer Heimat, jenem konservativen Kern der Südstaaten, wo ebenso selbstgerechte wie gottesfürchtige Provinzler ihre Existenz vor "Eindringlichen" zu schützen versuchen. Olaf Velte (FR) lässt sich von O'Connor immer wieder gern zu den "beschränkt fundamentalistischen" Figuren mitnehmen und staunt über die "alttestamentarische Wucht" und das "Gespür fürs Vulgäre", mit denen die Autorin den Rassismus im Bible Belt zerlegt. Dass O'Connor ihrer Zeit weit voraus war, merkt Welt-Kritiker Wieland Freund gleich beim ersten der messerschafen Texte, der ihm wie ein Film der Coen-Brüder vorkommt, wenn ein Killer eine Südstaatenoma im Straßengraben köpft. Viel Lob gibt es auch für die "glasklare" Übersetzung von Anna und Dietrich Leube, die Begriffe wie "nigger" nicht durch "Afroamerikaner" ersetzt haben. Weitere Hymnen finden sich in SZ, FAZ, Spiegel Online (O'Connor kippt "Säure auf Vom Winde verweht, meint Peter Hennig), Dlf-Kultur und im SWR.
Die in "Keiner Menschenseele kann man noch trauen" versammelten Kurzgeschichten der amerikanischen Autorin Flannery O'Connor sind größtenteils 1965 entstanden - und doch brandaktuell, versichern die Kritikerinnen: O'Connor erzählt aus ihrer Heimat, jenem konservativen Kern der Südstaaten, wo ebenso selbstgerechte wie gottesfürchtige Provinzler ihre Existenz vor "Eindringlichen" zu schützen versuchen. Olaf Velte (FR) lässt sich von O'Connor immer wieder gern zu den "beschränkt fundamentalistischen" Figuren mitnehmen und staunt über die "alttestamentarische Wucht" und das "Gespür fürs Vulgäre", mit denen die Autorin den Rassismus im Bible Belt zerlegt. Dass O'Connor ihrer Zeit weit voraus war, merkt Welt-Kritiker Wieland Freund gleich beim ersten der messerschafen Texte, der ihm wie ein Film der Coen-Brüder vorkommt, wenn ein Killer eine Südstaatenoma im Straßengraben köpft. Viel Lob gibt es auch für die "glasklare" Übersetzung von Anna und Dietrich Leube, die Begriffe wie "nigger" nicht durch "Afroamerikaner" ersetzt haben. Weitere Hymnen finden sich in SZ, FAZ, Spiegel Online (O'Connor kippt "Säure auf Vom Winde verweht, meint Peter Hennig), Dlf-Kultur und im SWR. 
 Bereits in den Fünfzigern erschienen und von den Kritikern ebenfalls als erschreckend aktuell gewürdigt, ist James Baldwins autobiografischer Roman "Von dieser Welt" Wir bleiben im streng gläubigen Milieu der USA, richten den Blick aber auf eine zerrissene schwarze Familie in den dreißiger Jahren. Gustav Seibt (SZ) hat selten ein derart eindringliches Stück religiöser Literatur gelesen, wie diese Geschichte des afroamerikanischen Gesellschaftskritikers Baldwin, der mit üppigen und lebendigen Bibel-Bezügen vom Aufwachsen als Sohn eines baptistischen Predigers erzählt. Dieser Roman, der "Gosse und Prophetie" brillant gegeneinander schneidet, ist ein Bild von "düster-grausamer Schönheit", lobt Seibt. Wie im Rausch liest die Dramatikerin Sasha Marianna Salzmann (FAZ) den die Seele seiner Figuren kompromisslos und beklemmend ausleuchtenden Text. Abgründe der anderen Art bietet Paul Theroux in seinem ebenfalls sehr gut besprochenen autobiografischen Familienroman "Mutterland" der davon erzählt, wie eine greisenhafte und manipulative Matriarchin ihre sieben inzwischen auch schon betagten und um ihre Gunst buhlenden Kinder tyrannisiert. SZ-Kritiker Ulrich Rüdenauer versteht spätestens nach der schwarzhumorigen Lektüre, weshalb Max Horkheimer die Familie als "Keimzelle des Faschismus" beschrieb. Als "Peinvoll ergreifend" beschreibt Sabine Vogel in der FR den Roman.
Bereits in den Fünfzigern erschienen und von den Kritikern ebenfalls als erschreckend aktuell gewürdigt, ist James Baldwins autobiografischer Roman "Von dieser Welt" Wir bleiben im streng gläubigen Milieu der USA, richten den Blick aber auf eine zerrissene schwarze Familie in den dreißiger Jahren. Gustav Seibt (SZ) hat selten ein derart eindringliches Stück religiöser Literatur gelesen, wie diese Geschichte des afroamerikanischen Gesellschaftskritikers Baldwin, der mit üppigen und lebendigen Bibel-Bezügen vom Aufwachsen als Sohn eines baptistischen Predigers erzählt. Dieser Roman, der "Gosse und Prophetie" brillant gegeneinander schneidet, ist ein Bild von "düster-grausamer Schönheit", lobt Seibt. Wie im Rausch liest die Dramatikerin Sasha Marianna Salzmann (FAZ) den die Seele seiner Figuren kompromisslos und beklemmend ausleuchtenden Text. Abgründe der anderen Art bietet Paul Theroux in seinem ebenfalls sehr gut besprochenen autobiografischen Familienroman "Mutterland" der davon erzählt, wie eine greisenhafte und manipulative Matriarchin ihre sieben inzwischen auch schon betagten und um ihre Gunst buhlenden Kinder tyrannisiert. SZ-Kritiker Ulrich Rüdenauer versteht spätestens nach der schwarzhumorigen Lektüre, weshalb Max Horkheimer die Familie als "Keimzelle des Faschismus" beschrieb. Als "Peinvoll ergreifend" beschreibt Sabine Vogel in der FR den Roman.
 Selten werden Liebhaber-Stücke so hochgejubelt wie diese mit äußerster Sorgfalt vom kleinen Galiani-Verlag in marmoriertem Einband editierte Laurence-Sterne-Werkausgabe Und dabei geht es den Kritikern nicht einmal um den hier natürlich enthaltenen "Tristram Shandy" oder "Die sentimentale Reise". Vor allem die Briefe haben es den Rezensenten angetan: Teils galant (in den Liebesbriefen), teils eher bodenständig von Gänsezucht und lokalpolitischen Kabalen im Pfarreileben in Yorkshire berichtend, bieten die Briefe aus den Jahren zwischen 1739 und 1768 laut FAZ-Kritiker Jürgen Kaube Gelegenheit, den Autor näher kennenzulernen. Werner Koppenfels (NZZ) entdeckt hier gar den "essentiellen" Sterne und Paul Ingendaay (FAS) Sternes poetisches Programm: "Freiheit, Lachen, Spinnerei". Großes Lob gibt es auch für Übersetzer Michael Walter, der in diesem Jahr mit dem Europäischen Übersetzerpreis ausgezeichnet wurde: Zeit-Kritiker Hans von Trotha, selbst Autor einer aktuellen bei Wagenbach erschienenen "Sentimental Journey" ist, wertet es als Glücksfall, dass Walter für diese Neuausgabe seine alten Übersetzungen überarbeitet und auch die Briefe und Fragmente übersetzt hat. Im Dlf-Kultur widmet Michael Langer Sterne einen ausführlichen Beitrag.
Selten werden Liebhaber-Stücke so hochgejubelt wie diese mit äußerster Sorgfalt vom kleinen Galiani-Verlag in marmoriertem Einband editierte Laurence-Sterne-Werkausgabe Und dabei geht es den Kritikern nicht einmal um den hier natürlich enthaltenen "Tristram Shandy" oder "Die sentimentale Reise". Vor allem die Briefe haben es den Rezensenten angetan: Teils galant (in den Liebesbriefen), teils eher bodenständig von Gänsezucht und lokalpolitischen Kabalen im Pfarreileben in Yorkshire berichtend, bieten die Briefe aus den Jahren zwischen 1739 und 1768 laut FAZ-Kritiker Jürgen Kaube Gelegenheit, den Autor näher kennenzulernen. Werner Koppenfels (NZZ) entdeckt hier gar den "essentiellen" Sterne und Paul Ingendaay (FAS) Sternes poetisches Programm: "Freiheit, Lachen, Spinnerei". Großes Lob gibt es auch für Übersetzer Michael Walter, der in diesem Jahr mit dem Europäischen Übersetzerpreis ausgezeichnet wurde: Zeit-Kritiker Hans von Trotha, selbst Autor einer aktuellen bei Wagenbach erschienenen "Sentimental Journey" ist, wertet es als Glücksfall, dass Walter für diese Neuausgabe seine alten Übersetzungen überarbeitet und auch die Briefe und Fragmente übersetzt hat. Im Dlf-Kultur widmet Michael Langer Sterne einen ausführlichen Beitrag.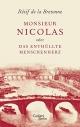
 Sehr gut besprochen wurde auch Retif de la Bretonnes erotische Biografie "Monsieur Nicolas oder das enthüllte Menschenherz" die uns von der bäuerlichen Herkunftswelt über die ersten schriftstellerischen Erfolge bis hin zur Armut nach der Revolution mitnimmt, vor allem aber die zahlreichen sexuellen Eskapaden Bretonnes schildert. Genauso viel Sinnlichkeit, Erfahrungs- und Abenteuerlust wie in Rousseaus "Confessions" findet SZ-Kritiker Fritz Göttler hier, in der Zeit schwärmt Durs Grünbein: So radikal authentisch wie Knausgard war schon das 18. Jahrhundert. Und die "glänzende" Übertragung von Reinhard Kaiser lasse gar die Pornofilmindustrie blass aussehen, jubelt er. Offenbar nicht ganz so sinnlich, aber ähnlich vergnüglich lesen sich Claude Debussys von Bernd Goetzke brillant ins Deutsche übertragene "Briefe an seine Verleger" beteuern die Kritiker: In der Zeit erschließen sich Volker Hagedorn in den Vertröstungs- und die Bettelbriefen ungeahnte Tiefen des Genies: Er erfährt hier allerhand über die Frauen, die Debussy reihenweise verließ, die ständige Geldnot und dessen Tiraden gegenüber Kollegen.
Sehr gut besprochen wurde auch Retif de la Bretonnes erotische Biografie "Monsieur Nicolas oder das enthüllte Menschenherz" die uns von der bäuerlichen Herkunftswelt über die ersten schriftstellerischen Erfolge bis hin zur Armut nach der Revolution mitnimmt, vor allem aber die zahlreichen sexuellen Eskapaden Bretonnes schildert. Genauso viel Sinnlichkeit, Erfahrungs- und Abenteuerlust wie in Rousseaus "Confessions" findet SZ-Kritiker Fritz Göttler hier, in der Zeit schwärmt Durs Grünbein: So radikal authentisch wie Knausgard war schon das 18. Jahrhundert. Und die "glänzende" Übertragung von Reinhard Kaiser lasse gar die Pornofilmindustrie blass aussehen, jubelt er. Offenbar nicht ganz so sinnlich, aber ähnlich vergnüglich lesen sich Claude Debussys von Bernd Goetzke brillant ins Deutsche übertragene "Briefe an seine Verleger" beteuern die Kritiker: In der Zeit erschließen sich Volker Hagedorn in den Vertröstungs- und die Bettelbriefen ungeahnte Tiefen des Genies: Er erfährt hier allerhand über die Frauen, die Debussy reihenweise verließ, die ständige Geldnot und dessen Tiraden gegenüber Kollegen. Last but not least ein Blick auf jene, die in verlässlicher Regelmäßigkeit abliefern - und natürlich ebenso verlässlich besprochen werden. Allen voran Martin Walser, dessen neuer Roman "Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte" von dem Weinstein-Wiedergänger und Trump-Sympathisanten - so Barbara Möller in der Welt - Justus Mall erzählt, der hier in wenigen Briefen seinen ganzen Missmut darüber ergießt, dass man es ihm nicht durchgehen lassen will, dass er einer Praktikantin an den Schenkel gegriffen hat. Unerhört, genau. Aber Vorsicht vor dem Autor: "Er legt den Köder aus, seinen Protagonisten, und wartet nun ab, ob wir uns empören oder ob wir die Chance nutzen, dass wir etwas beobachten können, das sich sonst nicht so zeigt: ein scheues Lebewesen in einem selten erreichten Stadium der Entpuppung", schreibt ein amüsierter Arno Widmann in seiner Kolumne "Vom Nachttisch geräumt". Mall ist nicht Walser, warnt auch Roman Bucheli in der NZZ. Als "boshaft-ironischen", "zwischen Lakonie und Larmoyanz tänzelnden" Beitrag zur #MeToo-Debatte liest Barbara Möller (Welt) das Buch. In der FAZ allerdings ruft Susanne Klingenstein Walsers Mall entgegen: Mir graut vor Ihnen!
Last but not least ein Blick auf jene, die in verlässlicher Regelmäßigkeit abliefern - und natürlich ebenso verlässlich besprochen werden. Allen voran Martin Walser, dessen neuer Roman "Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte" von dem Weinstein-Wiedergänger und Trump-Sympathisanten - so Barbara Möller in der Welt - Justus Mall erzählt, der hier in wenigen Briefen seinen ganzen Missmut darüber ergießt, dass man es ihm nicht durchgehen lassen will, dass er einer Praktikantin an den Schenkel gegriffen hat. Unerhört, genau. Aber Vorsicht vor dem Autor: "Er legt den Köder aus, seinen Protagonisten, und wartet nun ab, ob wir uns empören oder ob wir die Chance nutzen, dass wir etwas beobachten können, das sich sonst nicht so zeigt: ein scheues Lebewesen in einem selten erreichten Stadium der Entpuppung", schreibt ein amüsierter Arno Widmann in seiner Kolumne "Vom Nachttisch geräumt". Mall ist nicht Walser, warnt auch Roman Bucheli in der NZZ. Als "boshaft-ironischen", "zwischen Lakonie und Larmoyanz tänzelnden" Beitrag zur #MeToo-Debatte liest Barbara Möller (Welt) das Buch. In der FAZ allerdings ruft Susanne Klingenstein Walsers Mall entgegen: Mir graut vor Ihnen! 

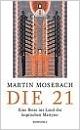 Viel Lob gab es für F.C. Delius autobiografischen Roman "Die Zukunft der Schönheit" der uns in einen New Yorker Jazzclub der Sechziger zu einem Konzert des Saxophonisten Albert Ayler entführt: Wie Delius archaische Wucht und Wildheit der Musik mit den Illusionen und Reflexionen des Erzählers über die eigene Mittelmäßigkeit gegeneinander schneidet, findet SZ-Kritiker Thomas Steinfeld herrlich "abgründig". Als "klassische Jazznummer in Prosa" beschreibt Andreas Kilb in der FAZ diese gekonnte assoziative Vermengung von Autobiografie und Historie. Durchwachsene Kritiken gab es für Botho Strauß' Notatsammlung "Der Fortführer" : SZ-Kritiker Christoph Bartmann nervt die "reaktionäre Agenda" - während Tilman Krause in der Welt Strauß noch viel zu "mimosenhaft" findet. Neugier und überraschende Skepsis attestiert hingegen in der FR Dirk Pilz dem Werk, und in der Zeit kann Ulrich Greiner gar nicht genug bekommen von den Aphorismen, Reflexionen und Skizzen, mit denen Strauß "den Zeitgeist-Pfeil" umdrehe. Hingewiesen sei auch noch einmal auf Martin Mosebachs Reportage über die "21" koptischen Märtyrer, die in Ägypten von IS-Terroristen ermordet worden waren.
Viel Lob gab es für F.C. Delius autobiografischen Roman "Die Zukunft der Schönheit" der uns in einen New Yorker Jazzclub der Sechziger zu einem Konzert des Saxophonisten Albert Ayler entführt: Wie Delius archaische Wucht und Wildheit der Musik mit den Illusionen und Reflexionen des Erzählers über die eigene Mittelmäßigkeit gegeneinander schneidet, findet SZ-Kritiker Thomas Steinfeld herrlich "abgründig". Als "klassische Jazznummer in Prosa" beschreibt Andreas Kilb in der FAZ diese gekonnte assoziative Vermengung von Autobiografie und Historie. Durchwachsene Kritiken gab es für Botho Strauß' Notatsammlung "Der Fortführer" : SZ-Kritiker Christoph Bartmann nervt die "reaktionäre Agenda" - während Tilman Krause in der Welt Strauß noch viel zu "mimosenhaft" findet. Neugier und überraschende Skepsis attestiert hingegen in der FR Dirk Pilz dem Werk, und in der Zeit kann Ulrich Greiner gar nicht genug bekommen von den Aphorismen, Reflexionen und Skizzen, mit denen Strauß "den Zeitgeist-Pfeil" umdrehe. Hingewiesen sei auch noch einmal auf Martin Mosebachs Reportage über die "21" koptischen Märtyrer, die in Ägypten von IS-Terroristen ermordet worden waren.