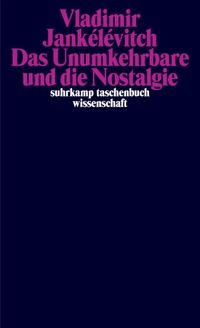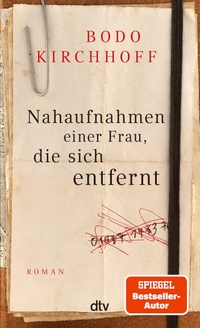Efeu - Die Kulturrundschau
Kinder, macht Neues
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
21.07.2023. Der Standard begibt sich bei den Bregenzer Festspielen mit Lotte de Beers Inszenierung von Verdis "Ernani" auf einen actionreichen Slalomkurs in einer Geisterbahn. Immer das gleiche Repertoire bei Opernfestspielen, gähnt indes die SZ. Die NZZ blickt mit Cindy Sherman in die Gesichtslandschaften von Elefantenfrauen. In der SZ erzählt der scheidende Beck-Lektor Martin Hielscher von seinem Kampf für anspruchsvolle Literatur. Und die Musikkritiker erfahren im neuen Album von Blur, wie es klingt, wenn Vöglein beim Anziehen helfen.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
21.07.2023
finden Sie hier
Bühne

Stephan Enders besuchte für den Standard bei den Bregenzer Festspielen die Premiere von Giuseppe Verdis "Ernani" und war von der klamaukigen Inszenierung Lotte de Beers durchaus angetan. Das passt auch historisch, meint er: "Das Opernpublikum der Romantik war süchtig nach komplett unglaubwürdigen, abnormalen Schauerstücken. Der Handlungsgang des Ernani-Librettos erinnert an einen Slalomkurs in einer Geisterbahn: reichlich überraschende Wendungen, jeder gruselige Schicksalsschlag eine Bodenwelle, auf der es die Protagonisten aushebt. Kein Wunder, dass Lotte de Beer in ihrer Inszenierung auf physische Wucht setzt: Die unter den Chor gemischten Mitglieder der Stunt-Factory rangeln als Räuberbande miteinander und vermöbeln als Ritter des Königs auch Don Ruy Gomez de Silva, den Onkel und Galan Elviras, filmreif und blutreich. Ernani wird so zur Splatteroper. Und Action!" In der nmz rümpft Wolf-Dieter Peter die Nase über übergroße Pappkronen und übertriebenes Bücken der Diener: "Dutzende Regieeinfälle von ähnlichem Nicht-Niveau, das eben nicht an Samuel Becketts oder Jean-Paul Sartres absurde Bitterkeiten heranreichte, wären aufzählbar - passend zu de Beers Äußerung, dass sie Verdis Musik 'geil' fände."
Verdi, Wagner, Mozart - in der SZ klagt Reinhard J. Brembeck über das immer gleiche Repertoire bei Opernfestspielen: "Neues ist in der Oper fast nur als Neuinterpretation zu haben: Ein neuer Sänger, Dirigent, Regisseur interpretieren bekannte Werke neu. Aber in dieser verbreiteten Praxis ist Augenwischerei dabei. Denn selbst ein radikal anders gesungener, dirigierter, inszenierter Beethoven-'Fidelio' bleibt letztlich nur eine Emanation dieses Stücks. Das Neue ist bei diesem allüberall praktizierten Verfahren ein Secondhand-Neues." Man könnte ja auch mal eine Uraufführung wagen, schlägt er vor.
Und weiter geht es mit den Festpielen: Theaterregisseur Jay Scheib steht mit seiner "Parsifal"-Inszenierung in Bayreuth in der Kritik: Es gibt zwei Fassungen, für eine braucht man AR-Brillen, von denen es aber nicht genügend für alle Zuschauer gibt. Scheib erklärt die Notwendigkeit der Brille in der FR so: "Sie erweitert das bestehende Konzept um eine weitere Ebene. Eigentlich gibt es zwei Konzepte, also wäre es im Grunde notwendig, dass man unseren 'Parsifal' zweimal erlebt. Durch die Brille wird eine Menge an Ideen und Einflüssen hinzugefügt, die man sonst nicht sieht. Wir hatten uns überlegt, ob wir manche Dinge davon in ein für alle sichtbares Video-Design einbauen, aber die Bühne war nicht dafür geplant, also existiert dieser 'Parsifal' damit in unterschiedlichen Versionen." Kritikern empfiehlt er: "Denken Sie an Richard Wagner: 'Kinder, macht Neues.' Ich könnte mir vorstellen, dass er mit diesem 'Parsifal' zufrieden gewesen wäre."
Weiteres: In der NZZ erinnert Dieter Borchmeyer an die Wirkung, die Goethes "Götz von Berlichingen" bei seiner Uraufführung hatte: Seitdem darf man auf der Bühne sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. In der FAZ porträtiert Claudius Seidl die Kabarettistin Monika Gruber, die beim Publikum mit populistisch konservativer Agenda punktet. Besprochen werden Choreografien beim Impulstanz in Wien ("radikale Selbstentblößung, um der Gegenwart an die Wäsche zu gehen", erlebte Welt-Kritiker Jakob Hayner
Literatur
"Ich habe mein Lektorenleben lang gekämpft, weil sich anspruchsvolle Literatur immer legitimieren musste", sagt Martin Hielscher, der zunächst bei Luchterhand als Lektor begann und nach einer Station bei Kiepenheuer & Witsch die vergangenen 22 Jahre das belletristische Programm des C.H. Beck Verlags aufgebaut hat, im Abschieds-Interview mit Marie Schmidt (SZ): "Wenn man nicht einfach nur ein kommerzielles Programm macht, sondern ein ästhetisches Konzept hat, muss man damit umgehen können. Auch mit Debatten, die sich in Autorenbiografien spiegeln. Da hast du verzweifelte Leute vor dir, die zum Beispiel fragen, was ist denn jetzt los, warum bespricht mich keiner mehr, warum bin ich plötzlich der alte weiße Mann, ich schreibe doch gute Bücher? Da muss man trösten, aber auch verstehen, dass lange Zeit etwas versäumt wurde im patriarchalen Diskurs und sich etwas ändert, auch wenn wir jetzt zu denen gehören, die das aushalten müssen. Mit dem Schreiben über Klassismus und dem Autofiktionalen kommt heute auch wieder eine Härte in die Literatur, die du denen erklären musst, die lieber etwas Schönes lesen wollen. Diese Legitimationsanstrengung darf man sich nicht ersparen."
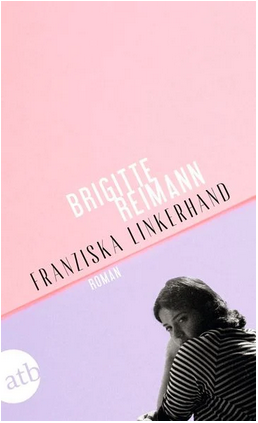 Heute wäre Brigitte Reimann neunzig Jahre alt geworden. In der SZ erinnert Danilo Scholz an die im Alter von 39 Jahren verstorbene Schriftstellerin und überzeugte Sozialistin, die zwar in jungen Jahren Stalin huldigte und sich von der Stasi anwerben ließ, sich dem Regime aber auch immer wieder widersetzte. Etwa in ihrem Roman "Franziska Linkerhand", der nicht nur die Wohnungsnot in der DDR anprangerte: "Reimann besaß ein Gespür für die unheilvolle Tektonik der ostdeutschen Platte. Die Titelheldin beobachtet in 'Franziska Linkerhand', wie es in den Wohnsilos der Hoyerswerda nachempfundenen fiktionalen Neustadt gärt. Eine 'Mischung aus Gleichgültigkeit und Aggressionslust' macht sich unter den in 'Komfortzellen' hausenden Bewohnern breit. Was sie wollen? 'Stören, etwas zerstören, Scheiben einschlagen'. So steht es in diesem 1974 posthum erschienenen Roman, der sich stellenweise wie ein Vorgriff auf die ausländerfeindlichen Ausschreitungen liest, die nach dem Mauerfall Hoyerswerda erschütterten."
Heute wäre Brigitte Reimann neunzig Jahre alt geworden. In der SZ erinnert Danilo Scholz an die im Alter von 39 Jahren verstorbene Schriftstellerin und überzeugte Sozialistin, die zwar in jungen Jahren Stalin huldigte und sich von der Stasi anwerben ließ, sich dem Regime aber auch immer wieder widersetzte. Etwa in ihrem Roman "Franziska Linkerhand", der nicht nur die Wohnungsnot in der DDR anprangerte: "Reimann besaß ein Gespür für die unheilvolle Tektonik der ostdeutschen Platte. Die Titelheldin beobachtet in 'Franziska Linkerhand', wie es in den Wohnsilos der Hoyerswerda nachempfundenen fiktionalen Neustadt gärt. Eine 'Mischung aus Gleichgültigkeit und Aggressionslust' macht sich unter den in 'Komfortzellen' hausenden Bewohnern breit. Was sie wollen? 'Stören, etwas zerstören, Scheiben einschlagen'. So steht es in diesem 1974 posthum erschienenen Roman, der sich stellenweise wie ein Vorgriff auf die ausländerfeindlichen Ausschreitungen liest, die nach dem Mauerfall Hoyerswerda erschütterten."
Weitere Artikel: In der NZZ schreibt Sergej Gerassimow weiter Kriegstagebuch aus Charkiw. Die Holocaust-Anthologie "Aber ich lebe" ist für den Eisner Award, die wichtigste Auszeichnung der US-Comicbranche, nominiert, meldet Lars von Törne im Tagesspiegel.
Besprochen werden unter anderem Morten Pauls "Suhrkamp Theorie" (FAZ), Auður Ava Ólafsdóttirs Roman "Hotel Silence" (NZZ), Garry Dishers Krimi "Funkloch" (FR) und Tess Guntys Roman "Kaninchenstall" (Dlf Kultur).
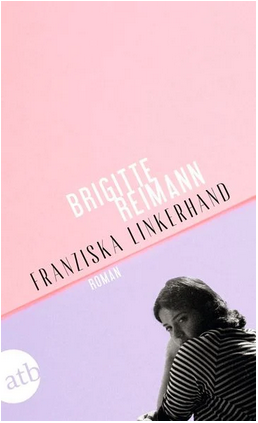 Heute wäre Brigitte Reimann neunzig Jahre alt geworden. In der SZ erinnert Danilo Scholz an die im Alter von 39 Jahren verstorbene Schriftstellerin und überzeugte Sozialistin, die zwar in jungen Jahren Stalin huldigte und sich von der Stasi anwerben ließ, sich dem Regime aber auch immer wieder widersetzte. Etwa in ihrem Roman "Franziska Linkerhand", der nicht nur die Wohnungsnot in der DDR anprangerte: "Reimann besaß ein Gespür für die unheilvolle Tektonik der ostdeutschen Platte. Die Titelheldin beobachtet in 'Franziska Linkerhand', wie es in den Wohnsilos der Hoyerswerda nachempfundenen fiktionalen Neustadt gärt. Eine 'Mischung aus Gleichgültigkeit und Aggressionslust' macht sich unter den in 'Komfortzellen' hausenden Bewohnern breit. Was sie wollen? 'Stören, etwas zerstören, Scheiben einschlagen'. So steht es in diesem 1974 posthum erschienenen Roman, der sich stellenweise wie ein Vorgriff auf die ausländerfeindlichen Ausschreitungen liest, die nach dem Mauerfall Hoyerswerda erschütterten."
Heute wäre Brigitte Reimann neunzig Jahre alt geworden. In der SZ erinnert Danilo Scholz an die im Alter von 39 Jahren verstorbene Schriftstellerin und überzeugte Sozialistin, die zwar in jungen Jahren Stalin huldigte und sich von der Stasi anwerben ließ, sich dem Regime aber auch immer wieder widersetzte. Etwa in ihrem Roman "Franziska Linkerhand", der nicht nur die Wohnungsnot in der DDR anprangerte: "Reimann besaß ein Gespür für die unheilvolle Tektonik der ostdeutschen Platte. Die Titelheldin beobachtet in 'Franziska Linkerhand', wie es in den Wohnsilos der Hoyerswerda nachempfundenen fiktionalen Neustadt gärt. Eine 'Mischung aus Gleichgültigkeit und Aggressionslust' macht sich unter den in 'Komfortzellen' hausenden Bewohnern breit. Was sie wollen? 'Stören, etwas zerstören, Scheiben einschlagen'. So steht es in diesem 1974 posthum erschienenen Roman, der sich stellenweise wie ein Vorgriff auf die ausländerfeindlichen Ausschreitungen liest, die nach dem Mauerfall Hoyerswerda erschütterten."Weitere Artikel: In der NZZ schreibt Sergej Gerassimow weiter Kriegstagebuch aus Charkiw. Die Holocaust-Anthologie "Aber ich lebe" ist für den Eisner Award, die wichtigste Auszeichnung der US-Comicbranche, nominiert, meldet Lars von Törne im Tagesspiegel.
Besprochen werden unter anderem Morten Pauls "Suhrkamp Theorie" (FAZ), Auður Ava Ólafsdóttirs Roman "Hotel Silence" (NZZ), Garry Dishers Krimi "Funkloch" (FR) und Tess Guntys Roman "Kaninchenstall" (Dlf Kultur).
Architektur

"Die universitäre Forschung im Fach Krankenhausbau hat jedenfalls aufregende Zeiten vor sich," urteilt Hannes Hintermeier in der FAZ nach seinem Besuch der Ausstellung "Das Kranke(n)haus. Wie Architektur heilen hilft" im Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne. Die Zukunft der Kliniken wird mit einigen Beispielbauten illustriert: "Dass unter den 13 vorgestellten vorbildlichen Krankenhäusern die derzeit entstehende Kinder- und Jugendklinik in Freiburg den Auftakt macht, für deren Raumkonzept und Innenarchitektur das Büro der Ko-Kuratorin Vollmer verantwortlich ist, muss man wohl unter den Üblichkeiten der Branche verbuchen. 'REN-Cluster' heißt das Zauberwort - kurz für 'Raum für Entwicklung und Normalität'. In dieser Versorgungseinheit, die als Bindeglied zwischen vier Stationen fungiert, werden die nichtklinischen Funktionen gebündelt, also Schule, Spielen, Essen, psychologische Begleitung. Die Idee eines entstressten Ankunftsortes und Überlebensraums inmitten hoch technisierter Schulmedizin könnte für künftige medizinische Zentren ein Ansatz sein."
In der Londoner Royal Academy of Arts zeigt eine Ausstellung die Arbeiten des Architekturbüros Herzog & de Meuron mit einem ungewöhnlichen Fokus, schreibt Marion Löhndorf in der NZZ: "Anstatt sich, wie es Usus ist, auf die fertigen Gebäude zu konzentrieren, geben drei Räume in der Londoner Academy Einblicke in die Arbeitsweise der Architekten und in die Einbindung der fertigen Gebäude in den Alltag. Ganz bewusst steht also nicht die Perfektion eines abgeschlossenen Baus im Mittelpunkt. Es geht um die Schöpfer und die Nutzer des Gebäudes und um jene, die ein Gebäude nur beiläufig im Vorübergehen oder -fahren wahrnehmen, die Passanten. Herzog & de Meuron wenden den Blick von der Architektur mit ihren in der Regel statischen Setzungen hin zur Bewegung, zur Dynamik des Entstehungsprozesses und zu den Menschen, die ihre Gebäude beleben."
Film
Für die Berliner Zeitung schaut Slavoj Zizek "Indiana Jones", "Barbie" und "Oppenheimer" und erkennt in allen Filmen "eine Flucht aus den Fantasien in die brutale Realität". Die NZZ bringt eine Bilderstrecke zum 50. Todestag von Bruce Lee. Besprochen werden Christopher Nolans "Oppenheimer" (für Fabian Tietke in der taz ein "etwas biederer, solider, sehr epischer und sehr vom Geniekult geprägter Film", ZeitOnline, artechock), die britische Serie "It's a Sin", derzeit in der ZDF-Mediathek (BlZ) und die Netflix-Mystery-Komödie "They Cloned Tyrone" (BlZ, Tsp).
Kunst

Gleich zwei aufsehenerregende Ausstellungen mit Fotografien von Cindy Sherman darf sich Jürg Zbinden für die NZZ anschauen: "Anti-Fashion" in der Staatsgalerie Stuttgart "richtet sich an alle, die sich für Mode und Anti-Mode und Cindy Shermans subversive Interpretation davon interessieren. Sie werden sehen, Queerness wurde nicht erst nach Corona erfunden," macht er klar. "Dass sich Sherman die sogenannt klassischen Modemarken mit besonderer Lust zur Sabotage und Demontage vorknöpft, versteht sich von selbst. Die Stuttgarter Schau richtet sich aber nicht gegen die Mode, sondern gegen deren Auswüchse, die sich durch Social Media ins Unendliche potenzieren." Die Zürcher Ausstellung bei Hauser und Wirth bezeugt für Zbinden vor allem die Radikalität der Künstlerin: "Hier ist nichts edel, durchgeistigt, schön, lieblich oder hold, noch nicht einmal blass oder fahl, nur fürchterlich zerfurcht. Das Horrorkabinett der Cindy Sherman ist eine Ansammlung digitaler Collagen, die Schwarz-Weiß- und Farbfotografie unter Zuhilfenahme von Theaterutensilien und -schminke zusammensetzen. Das Make-up scheint aus dem Betonmischer zu stammen, eine zementgraue Grundierung durchzieht die Gesichtslandschaften der Elefantenfrauen. Es sind Werke, wie sie sich Herr und Frau Schweizer kaum je an die Wand hängen würden. Sammler lagern Cindy Sherman einfach ein, bis sich der Weiterverkauf lohnt."
Weiteres: Stefan Trinks freut sich über einen Christus aus Wolkenschlaufen von Tilman Riemenschneider, den das Germanische Nationalmuseum erwerben konnte. Besprochen wird außerdem die Ausstellung "Spanische Dialoge" im Berliner Bode-Museum (BlZ).
Musik
Alle paar Jahre finden sich Blur wieder zusammen, die britische Band, über deren Leadsänger Damon Albarn Kollege James Blunt einst sagte, er klinge "als habe er einen ganzen Pflaumenhain im Mund und einen Silberlöffel im Arsch", erinnert auf ZeitOnline Julia Lorenz, die dem neuen, neunten Album weder den Silberlöffel noch Alterserscheinungen anmerkt: "Man kriegt es auf 'The Ballad of Darren' mit Männern zu tun, die weich geblieben oder geworden sind, biegsam im Kopf und in allen Gelenken. Blur haben sich sternenäugige Popsongs ausgedacht und Melodien, die klingen, als würden ihnen morgens die Vöglein beim Anziehen helfen. Es gibt elektronisches Flirren, das vertraute Hintergrundrauschen aus 'Aaaaaaaahs' und 'Uuuuuuuuhs'; Streicher, die sich nach goldener Zukunft anhören, und Texte, die darum wissen, dass ebendiese Zukunft nicht mehr unendlich ist. Dieses neue Album der Band erzählt davon, wie Berufsjugendliche in Würde älter werden können".
Keine Wut, kaum Innovation, sondern Sanftheit, Versöhnung, ja ein Bad im "Wohlklang" hört auch SZ-Kritiker Max Fellmann, etwa im Song "The Narcissist": "Wundervoll herbstsonniger Pop, erinnert an 'Coffee & TV'. Süße Melancholie, bleibt sofort tagelang im Ohr. Albarn singt eine der besten Zeilen des ganzen Albums: 'Looked in the mirror / So many people standing there'." Und im Tagesspiegel erkennt Gerrit Bartels an: "Bewusst unoriginell, dafür inspiriert von einer Reife, die ihresgleichen sucht."
"Otaku" ist eine - eher herabwürdigende - Bezeichnung für Menschen, die sich besessen mit japanischer Kultur beschäftigen. Als solcher gilt der britische Musiker und Musik-Archäologe Howard Williams, der sich gleich Japan Blues nennt und taz-Kritiker Lars Fleischmann auf seinem neuen Album "Japan Blues meets The Dengy Hundred" auf eine Reise nach Nippon mitnimmt. Anonym erhobene Vorwürfe der kulturellen Aneignung lässt Fleischmann nicht gelten: "Alt und neu, vergangen und zart futuristisch, schemenhaft wie feststofflich. Es gibt keine abgegrenzten Welten in dieser Musik, sondern das Gefundene wie das Genuine bedingen sich bis zuletzt. Denn nicht alles ist gesampelt, vieles basiert auf Aufnahmen, die Williams selbst 2018 mit den beiden Londoner Sängern Akari Mochizuki und Hibiki Ichikawa angefertigt hat. Hier wird also keine mitunter anonyme Kultur ausgebeutet und nichts 'zu Unrecht in Besitz' genommen, sondern Akteure aus Japan werden direkt eingebunden." Wir hören rein:
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Bravo-Starschnitte. Eine Sammlung von Legenden" in den Opelvillen Rüsselsheim (FR) und ein Konzert von Paavo Järvi mit dem Estonian Festival Orchestra beim Pärnu Music Festival (FAZ).
Keine Wut, kaum Innovation, sondern Sanftheit, Versöhnung, ja ein Bad im "Wohlklang" hört auch SZ-Kritiker Max Fellmann, etwa im Song "The Narcissist": "Wundervoll herbstsonniger Pop, erinnert an 'Coffee & TV'. Süße Melancholie, bleibt sofort tagelang im Ohr. Albarn singt eine der besten Zeilen des ganzen Albums: 'Looked in the mirror / So many people standing there'." Und im Tagesspiegel erkennt Gerrit Bartels an: "Bewusst unoriginell, dafür inspiriert von einer Reife, die ihresgleichen sucht."
"Otaku" ist eine - eher herabwürdigende - Bezeichnung für Menschen, die sich besessen mit japanischer Kultur beschäftigen. Als solcher gilt der britische Musiker und Musik-Archäologe Howard Williams, der sich gleich Japan Blues nennt und taz-Kritiker Lars Fleischmann auf seinem neuen Album "Japan Blues meets The Dengy Hundred" auf eine Reise nach Nippon mitnimmt. Anonym erhobene Vorwürfe der kulturellen Aneignung lässt Fleischmann nicht gelten: "Alt und neu, vergangen und zart futuristisch, schemenhaft wie feststofflich. Es gibt keine abgegrenzten Welten in dieser Musik, sondern das Gefundene wie das Genuine bedingen sich bis zuletzt. Denn nicht alles ist gesampelt, vieles basiert auf Aufnahmen, die Williams selbst 2018 mit den beiden Londoner Sängern Akari Mochizuki und Hibiki Ichikawa angefertigt hat. Hier wird also keine mitunter anonyme Kultur ausgebeutet und nichts 'zu Unrecht in Besitz' genommen, sondern Akteure aus Japan werden direkt eingebunden." Wir hören rein:
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Bravo-Starschnitte. Eine Sammlung von Legenden" in den Opelvillen Rüsselsheim (FR) und ein Konzert von Paavo Järvi mit dem Estonian Festival Orchestra beim Pärnu Music Festival (FAZ).
Kommentieren