Efeu - Die Kulturrundschau
Im Rhythmus der Stufen
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
09.03.2024. Der Standard bewundert in der Albertina die Selbstironie Roy Lichtensteins. Die Berliner Zeitung spürt in Lada Nakonechnas Werken den Brandgeruch des Krieges. Die SZ schreibt zur Eröffnung des Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam. Außerdem feiert sie schon mal die morgige Oscar-Nacht als eine der letzten Bastionen des kulturellen Universalismus. In der FAZ blickt der ukrainische Schriftsteller Andrij Ljubka auf zwei Jahre Krieg in seiner Heimat. Die nachtkritik denkt über zeitgenössische Klassiker-Überschreibungen nach.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
09.03.2024
finden Sie hier
Kunst



Weitere Artikel: Birgit Rieger unterhält sich für den Tagesspiegel mit Jenny Schlenzka, der neuen Direktorin des Berliner Gropiusbaus, über deren Programm, das weniger elitär werden soll: "In New York im MoMA, im PS1 und im traditionsreichen von ihr umbenannten Performance Space New York hat sich Schlenzka zur Spezialistin für Performancekunst und interdisziplinäre Praktiken entwickelt. Neben Ausstellungen sollen im Gropiusbau 'performative und interdisziplinäre Formate' eine Rolle spielen: Konzerte, Soundinstallationen, Tanz-Events, Tischtennis oder Boxkämpfe." Eva-Lena Lörzer besucht für die taz die israelische Künstlerin Varda Getzow, die heute in Berlin lebt.
Besprochen werden außerdem die Ausstellungen "Auf den Schultern von Riesinnen" im Wiener Künstlerhaus (Standard), "Miranda July: New Society" im Osservatorio Fondazione Prada in Mailand (FAZ) und "Echos der Bruderländer" im Berliner Haus der Kulturen der Welt (FR)
Film
Bekümmert stellt Claudius Seidl in der FAZ nach den Enthüllungen um Oliver Stone (unser Resümee) den Niedergang des Regisseurs in die Verbitterung und Käuflichkeit fest. "Spätestens seit 'Natural Born Killers' ist Oliver Stone ein Autokrat der Blicke und der Montage. Den freien Blick auf die Mehrdeutigkeiten einer Szene, die Offenheit der Bilder für widersprüchliche Deutungen, das alles schien ihn auf einmal nicht mehr zu interessieren." Und doch findet Seidl bemerkenswert, wie der Filmemacher in "The Putin Interviews" von 2017 "mit extravaganten Kamerapositionen und eigenwillig rhythmisierten Schnitten den monotonen Singsang Putins zum Tanzen zu bringen versuchte. Gerade deshalb wäre es jetzt hilfreich, wenn Amazon den Kasachstanfilm auch in Europa zugänglich machte. Dass propagandistische Absichten sich nicht so einfach in Filmszenen übersetzen lassen, weiß jeder Autokrat, der von den bewegten Bildern etwas versteht. Und wer weiß, womöglich hat die Kamera ja etwas gesehen, was Nasarbajew und seine Leute gar nicht zeigen wollten."
Hollywood ist zwar im Niedergang - selbst Filme mit Menschen in Strampelhosenkostümen entpuppen sich mehr und mehr als absolutes Senkblei an den Kassen. Dennoch behauptet sich die Oscarverleihung, die morgen Nacht ansteht, "als eine der wenigen verbliebenen Bastionen eines kulturellen Universalismus", schreibt Philipp Bovermann in der SZ und staunt über diesen Jahrgang: Die Academy feiert "relevante Bewegungen in der Filmbranche. Um das Bestehende zu bewahren, das wusste schon Franz Josef Strauß, muss man sich an die Spitze des Fortschritts stellen, sonst wird man davon überrollt. Der Akademie ist das gelungen." Das "Feld der nominierten Filme und Künstler enthält in diesem Jahrmit das Beste der gegenwärtigen Filmkunst. Und die findet eben, nicht zuletzt wegen der internationalen Plattformen der Streamer, längst auch außerhalb Hollywoods statt." Auch Edward Berger, Regisseur des im letzten Jahr mit Oscars überhäuften "Im Westen nichts Neues", schwärmt im Gespräch mit der Welt von diesem "wahnsinnig starken Jahrgang". Für den Standard porträtiert Valerie Dirk Sandra Hüller, die mit etwas Glück in der Sonntagnacht ihren aktuellen Run mit einem Goldjungen adeln kann.
Weitere Artikel: Der Filmdienst spricht mit Isabel Herguera über ihren Animationsfilm "Sultanas Traum". Werner Herzog spricht mit der Berliner Zeitung über das Wesen der Wahrheit, worüber er gerade auch ein Buch geschrieben hat. Sissy Rabl unterhält sich für die Presse mit dem österreichischen Kameramann Martin Gschlacht, der auf der Berlinale für seine Arbeit am Horrorfilm "Des Teufels Bad" (unser Resümee) mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.
Besprochen werden Michael Manns nur auf Amazon Prime statt im Kino gezeigtes Biopic "Ferrari" (FAZ, unsere Kritik hier), Ethan Coens "Drive-Away-Dolls" (FAZ, Standard, unsere Kritik), Mike Mitchells Animationsfilm "Kung Fu Panda 4" (taz), der auf Netflix gezeigte Science-Fiction-Film "Spaceman" mit Adam Sandler (Presse), Stephen Frears' Serie "The Regime" mit Kate Winslet (online nachgereicht vom TA für die SZ), Ulrike Koflers ARD-Serie "Sexuell Verfügbar" (FAZ), die ZDF-Serie "Pumpen" (FAZ) und die ZDF-Krankenhausserie "Push" (Presse).
Hollywood ist zwar im Niedergang - selbst Filme mit Menschen in Strampelhosenkostümen entpuppen sich mehr und mehr als absolutes Senkblei an den Kassen. Dennoch behauptet sich die Oscarverleihung, die morgen Nacht ansteht, "als eine der wenigen verbliebenen Bastionen eines kulturellen Universalismus", schreibt Philipp Bovermann in der SZ und staunt über diesen Jahrgang: Die Academy feiert "relevante Bewegungen in der Filmbranche. Um das Bestehende zu bewahren, das wusste schon Franz Josef Strauß, muss man sich an die Spitze des Fortschritts stellen, sonst wird man davon überrollt. Der Akademie ist das gelungen." Das "Feld der nominierten Filme und Künstler enthält in diesem Jahrmit das Beste der gegenwärtigen Filmkunst. Und die findet eben, nicht zuletzt wegen der internationalen Plattformen der Streamer, längst auch außerhalb Hollywoods statt." Auch Edward Berger, Regisseur des im letzten Jahr mit Oscars überhäuften "Im Westen nichts Neues", schwärmt im Gespräch mit der Welt von diesem "wahnsinnig starken Jahrgang". Für den Standard porträtiert Valerie Dirk Sandra Hüller, die mit etwas Glück in der Sonntagnacht ihren aktuellen Run mit einem Goldjungen adeln kann.
Weitere Artikel: Der Filmdienst spricht mit Isabel Herguera über ihren Animationsfilm "Sultanas Traum". Werner Herzog spricht mit der Berliner Zeitung über das Wesen der Wahrheit, worüber er gerade auch ein Buch geschrieben hat. Sissy Rabl unterhält sich für die Presse mit dem österreichischen Kameramann Martin Gschlacht, der auf der Berlinale für seine Arbeit am Horrorfilm "Des Teufels Bad" (unser Resümee) mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.
Besprochen werden Michael Manns nur auf Amazon Prime statt im Kino gezeigtes Biopic "Ferrari" (FAZ, unsere Kritik hier), Ethan Coens "Drive-Away-Dolls" (FAZ, Standard, unsere Kritik), Mike Mitchells Animationsfilm "Kung Fu Panda 4" (taz), der auf Netflix gezeigte Science-Fiction-Film "Spaceman" mit Adam Sandler (Presse), Stephen Frears' Serie "The Regime" mit Kate Winslet (online nachgereicht vom TA für die SZ), Ulrike Koflers ARD-Serie "Sexuell Verfügbar" (FAZ), die ZDF-Serie "Pumpen" (FAZ) und die ZDF-Krankenhausserie "Push" (Presse).
Literatur
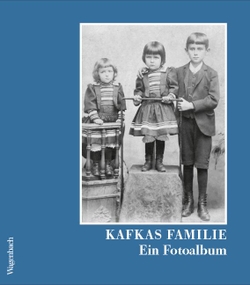
In "Bilder und Zeiten" der FAZ blickt der ukrainische Schriftsteller Andrij Ljubka auf zwei Jahre Krieg in seiner Heimat zurück: "Das ist die erschreckendste Veränderung, denn wir haben uns an etwas absolut Abnormales und Schreckliches angepasst. Wir haben gelernt, zu leben, ohne den Krieg zu beachten. ... Der Tod hat die Züge einer antiken griechischen Tragödie angenommen, in der er nun von Schicksal und Fügung bestimmt wird, du hast fast keinen Einfluss auf ihn. Es kann passieren, dass heute eine Rakete in dein Haus einschlägt, das Café trifft, in dem du gerade deinen Cappuccino bestellst, oder den Bahnhof zerstört, an dem du deine Freunde treffen wolltest. Es ist praktisch unmöglich, sich davor zu schützen, also müssen wir es als tägliche Wahrscheinlichkeit akzeptieren. 'Dein Wille geschehe', wie wir Atheisten sagen."
Weitere Artikel: Der Schriftsteller John Burnside erzählt in der NZZ von seinem Besuch am Grab von James Joyce. Außerdem berichtet Roman Bucheli in der NZZ von seiner Begegnung mit Burnside, der ihm von seinem Beinahe-Tod durch einen Herzstillstand erzählt. Für das "Literarische Leben" der FAZ war Andreas Platthaus bei dem Schriftsteller Gerhard Henschel in Bad Bevensen zu Gast, der von dort aus (und auf Grundlage eines riesigen Kellerarchivs) die eigene Lebens- und Familiengeschichte in einem mittlerweile zehn Romane umfassenden Zyklus verewigt. Stella Schuhmacher hat für den Standard die Schriftstellerin Lore Segal in New York besucht. Paul Jandl berichtet in der NZZ von Ferdinand von Schirachs Auftritten mit seinem Buch "Regen". Klaus Hillenbrand unterhält sich für die taz mit dem Edel-Antiquar Heribert Tenschert. Für die WamS schlendert Richard Kämmerlings mit dem bosnisch-amerikanischen Autor Aleksandar Hemon durch Berlin. Christian Thomas erinnert in der FR an den ukrainischen, im Gulag gestorbenen Schriftsteller Wassyl Stus. Axel Weidemann (FAZ) und Martina Knoben (SZ) schreiben Nachrufe auf den Mangazeichner Akira Toriyama.
Besprochen werden unter anderem Nicole Hennebergs Biografie über die Schriftstellerin Gabriele Tergit (online nachgereicht von der WamS), Barbi Markovićs "Minihorror" (taz), Teju Coles "Tremor" (vom TA online nachgereicht für die SZ), Barbara Köhlers Band "SCHRIFTSTELLEN" mit ausgewählten Gedichten (FR), Charles Linsmayers "19/21 Synchron Global" (FR), Kurt Drawerts Lang-Gedicht "Alles neigt sich zum Unverständlichen hin" (FAZ) und Didier Eribons "Eine Arbeiterin" (SZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.
Bühne


In der nachtkritik denkt Christine Wahl über zeitgenössische Klassiker-Überschreibungen nach, die noch jeden Helden zum Deppen macht: "Häufig geht es nicht mehr darum, den Kanon im engeren Sinne zu aktualisieren, sondern darum, ihn zu kritisieren und zu korrigieren, alte Narrative durch neue Gegen-Narrative zu ersetzen. Die dramatische Überschreibung ist, mit anderen Worten, ins Stadium der politischen Überschreibung eingetreten: ein Schritt, der sich besonders gut an den feministisch gelabelten Kanon-Revisionen beobachten lässt."
Besprochen werden Choreografien von Pina Bausch und Boris Charmatz mit dem Tanztheater Wuppertal im Haus der Berliner Festspiele (Tsp) sowie die Uraufführung von David Gieselmanns Stück "En woke" am Theater Bielefeld (nachtkritik).
Architektur

In "Bilder und Zeiten" (FAZ) erzählt Detlev Schöttker vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin die Geschichte des Berliner Fasanenplatzes.
Musik
Detlef Diederichsen mag in seiner taz-Kolumne nicht in den Chor der Apokalypse einstimmen, der sich zum angekündigten Ende des Onlinemagazins Pitchforks erhoben hat: Ärgerlich ist es allemal, dass diese Pop-Institution eingestellt wird, "das Ende des Musikjournalismus ist das aber nicht. Dazu hat dieser weise alte Mann zu oft selbiges Ende überlebt und kopfschüttelnd im Gewerk weitergewerkt. ... Lebbe geht weider." Denn "die interessanteren Auseinandersetzungen zu den Topics, denen sich Pitchfork widmete, finden sich als User-Generated Content in Threads auf Social Media, in Podcasts, Newslettern, wo sie sicher sind vor der permanenten Bedrohung durch Anzeigenkunden, Sponsoren oder verängstigte Gatekeeper. Was allerdings heißt: Geld ist damit nicht zu verdienen. Da geht es den Schreiberlingen allerdings nicht anders als den Musiker*innen oder Labelbetreiber*innen." Einige US-Autoren würden aber wohl widersprechen, dass sich mit Newslettern per se kein Geld verdienen lässt.
Außerdem: Sharon Su wirft für VAN einen kritischen Blick auf die mitunter schlecht edierten Notenausgaben der Musik von Florence Price. Karin Jirsak porträtiert für die taz Ulli Koch, die Putzkraft im Pudel Club auf St. Pauli.
Besprochen werden Hani Mojtahedys und Andi Thomas Album "HJirok" (taz), das Album "We'll Rise" des Anke Helfrich Trios (FR), ein Konzert des Arditti-Quartetts (Tsp), Ariana Grandes Album "Eternal Sunshine" (SZ) und das neue Album der Punkband Pissed Jeans, die Standard-Kritiker Karl Fluch mit ihrem "herrlich hinterwäldlerisch isolierten" Sound zuweilen an "Black Flag im Nahkampfmodus" erinnert. Wir hören vorsichtig rein:
Außerdem: Sharon Su wirft für VAN einen kritischen Blick auf die mitunter schlecht edierten Notenausgaben der Musik von Florence Price. Karin Jirsak porträtiert für die taz Ulli Koch, die Putzkraft im Pudel Club auf St. Pauli.
Besprochen werden Hani Mojtahedys und Andi Thomas Album "HJirok" (taz), das Album "We'll Rise" des Anke Helfrich Trios (FR), ein Konzert des Arditti-Quartetts (Tsp), Ariana Grandes Album "Eternal Sunshine" (SZ) und das neue Album der Punkband Pissed Jeans, die Standard-Kritiker Karl Fluch mit ihrem "herrlich hinterwäldlerisch isolierten" Sound zuweilen an "Black Flag im Nahkampfmodus" erinnert. Wir hören vorsichtig rein:
Kommentieren












