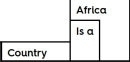
"In 'Die Verdammten der Erde' warnte der antikoloniale Theoretiker Frantz Fanon davor, dass die
postkoloniale Bourgeoisie Afrikas die Symbole der schwarzen Befreiung für ihre eigenen engstirnigen Ziele vereinnahmen und es ihr letztlich nicht gelingen würde, sowohl die psychologischen als auch die materiellen Ketten des Kolonialismus zu sprengen. Fanons Prophezeiung hat sich bewahrheitet: Afrikanische Politiker haben nicht nur die Macht ergriffen, um die
kolonialen Unterdrückungsstrukturen mittels Kapitalismus und Korruption zu reproduzieren, sondern fanden auch bereitwillige Kollaborateure unter der afrikanischen Diaspora-Elite, die panafrikanistische Ideale für ihren persönlichen Vorteil entstellten",
kritisiert Naila Aroni mit Blick auf schwarze Künstler und Prominente aus den USA oder UK wie
Chance the Rapper und
Meek Mill,
Naomi Campbell,
John Legend oder
Idris Elba, die Konzerte geben, Filme drehen, Land kaufen oder sich schenken lassen, ohne sich einen Deut um die politischen Hintergründe zu scheren. Die Sängerin
Kelis zum Beispiel hat eine
große Farm in Kenia erworben, ihrem "Paradies". Doch "die großflächige Landwirtschaft in Kenia ist nach wie vor weitgehend den weißen Siedlern und der kenianischen Elite vorbehalten, während die einheimischen Bauern in Kenia unverhältnismäßig stark von Dürren und Überschwemmungen betroffen sind, was zum Verlust von Ackerland für Vieh und Familie führt. ... In der Zwischenzeit ist die kenianische Regierung nach wie vor in Skandale verwickelt ... Noch besorgniserregender ist, dass Kenias derzeitige Regierung die wirtschaftlichen
Beziehungen zu repressiven Regimen zu vertiefen scheint. Vor kurzem empfing sie die sudanesischen Rapid Support Forces (RSF), dieselbe militärische Gruppe, die für
Kriegsverbrechen in einem der verheerendsten Bürgerkriege der jüngeren Geschichte verantwortlich ist, und erlaubte ihnen, Treffen zur Bildung einer Parallelregierung im
Sudan zu organisieren. Als Vergeltung verbot der Sudan die Einfuhr aller kenianischen Produkte, was den kenianischen Teehandel störte und die Wirtschaft weiter destabilisierte. Kenia als 'Paradies' zu bezeichnen, egal ob es sich um Ackerland handelt oder nicht, setzt eine
vorsätzliche Ignoranz der Umstände voraus, unter denen die Kenianer ums Überleben kämpfen."
Auch mit der
Demokratie in Südafrika steht es 31 Jahre nach dem Ende der Apartheid nicht zum Besten,
kritisiert Ali Ridha Khan. "Südafrikas Demokratie ist in vielerlei Hinsicht
würdelos geworden: Die Verwaltungssysteme lassen die Schwachen routinemäßig im Stich und verlangen von den Bürgern, endlos auf auf dem Papier
garantierte Rechte zu warten, während sich eine politische Elite und eine kleine neue Klasse von Nutznießern ungestraft an den staatlichen Ressourcen laben. Um diese Realität zu verstehen, muss man die Bedeutung von Verwaltungsjustiz, Würde und Geduld nachzeichnen, bevor man sich der Art und Weise zuwendet, wie sich die Südafrikaner in der Vergangenheit gegen politischen Verrat aufgelehnt haben. Es ist auch notwendig, das
Versagen der politischen Parteien in Bezug auf die Rechenschaftspflicht, die Dysfunktionalität der Verwaltung, die die Ungleichheit vertieft, und die emblematischen Fälle - Wohnungsbau, TRC-Wiedergutmachung, Militärveteranen und Landrückgabe - zu betrachten, die die Risse im Verfassungsversprechen offenlegen. Schließlich wird in diesem Aufsatz darüber nachgedacht, wie das
weiße Privileg, das von Gruppen wie AfriForum und internationalen Akteuren während und nach der Trump-Administration verstärkt wird, die Frustrationen im Inland verstärkt und einen alarmierenden
Rückgang der Wahlbeteiligung anheizt."