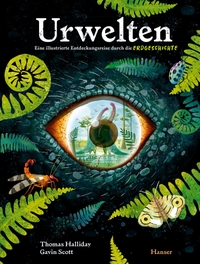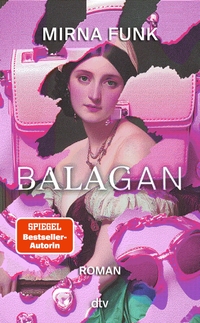Außer Atem: Das Berlinale Blog
Wir sind alle unglücklich
Von Thekla Dannenberg
05.03.2021. Mit dem Goldenen Bären für Radu Judes fiese Lockdown-Farce geht die digitale Geister-Berlinale zu Ende. In ihren besten Momente brachte sie wahren Kinozauber hervor, einfühlsame Dokumentationen und bewegendes Autorenkino. Aber auch: Jugend, Energie, Liebessehnsucht! Ein Überblick über Filme von Alexandre Koberidze, Ryusuke Hamaguchi, Maria Speth und Maryam Moghaddam.Dass diese Berlinale mit dem Goldenen Bären für Radu Judes fiese Farce "Bad Luck Banging or Loony Porn" zu Ende ging ist folgerichtig. (Alle Preise hier) Der Film spiegelt all die schlechte Laune, die Aggressionen und den Überdruss, die die Welt nach einem Jahr im Lockdown an den Tag legt - und die Filmkritik vom ersten Tag dieses Festivals. Payback! Es wäre aber falsch, in dieser Shitshow auch das Kondensat der diesjährigen Berlinale zu sehen, die unter extrem unglücklichen Vorzeichen und mit ihrer fragwürdigen Zweiteilung begann. (Mehr zu Radu Judes Film und der ersten Berlinale-Hälfte hier.)

Am Ende war es nämlich doch erstaunlich, wie viel Kinozauber der Wettbewerb in der zweiten Hälfte entfaltete. Und wie gut das tat! Das ist vor allem zwei Filmen zu verdanken, die bemerkenswert komplementär zueinander stehen. Alexandre Koberidzes "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" erzählt uns ein modernen Märchen aus der georgischen Stadt Kutaissi. Dort gibt es zwei Liebende, die durch einen bösen Fluch voneinander getrennt sind, einen wunderbar reißenden Fluss und ein kleines Café, in dem sich Lisa und Giorgi einfach nicht erkennen wollen, zumindest nicht ohne die Hilfe Kinos. Projekt: Verzauberung des Alltags. Der Film ist eine Reverenz an den Magischen Realismus und von einem etwas nostalgischen Glauben an die Macht des Kinos getragen. Aber er verfehlt seine Wirkung nicht. Zweieinhalb Stunden reinste Poesie.

Mit märchenhaften Elementen spielt auch Ryusuke Hamaguchis Episodenfilm "Wheel of Fortune and Fantasy". Er erzählt in drei unverbundenen Kurzgeschichten von den Liebesverwirrungen moderner Frauen unterschiedlichen Alters und erinnert ein bisschen an Sally Rooney oder Banana Yoshimoto. In der ersten Geschichte tratschen zwei Frauen vergnügt über den neuen Flirt der einen, über Romantik, Sex und Erotik, bis sich herausstellt, um wen es sich bei dem Typen handelt. In der zweiten versucht eine Studentin, ihren Literaturprofessor in eine Honigfalle zu locken, und in der dritten halten sich zwei Frauen irrtümlich aber zu ihrer beider Glück für ehemalige Schulfreundinnen. In jeder Episode wechselt Hamaguchi die Tonlage, Poppiges geht über ins Zartbittere und weiter in die sanfte Melancholie. Nach einem Jahr der erzwungenen Ruhe und Entspannung hauen einen die Jugend, Energie und Liebessehnsucht in diesem Film schier um. Er hat dafür sehr zu Recht einen Silbernen bekommen.
Die hervorragenden Filme von Hamaguchi und Koberidze zeigen sehr schön die beiden Richtungen, in die sich das internationale Kino mittlerweile bewegt: Hamaguchis mit einem starken Drehbuch, angesagten Themen, cleveren Plots und Pointen in Serie, Koberidse mit der Stimme des Filmemachers, einer unkonventionellen Bildsprache und dem Anspruch auf Weltgeltung aus der eigenen kulturellem Verwurzelung heraus. Das globale Kino und das Weltkino.
In einer ähnlichen Konstellation, aber deutlich ungleichgewichtiger finden sich die beiden Dokumentarfilme des Wettbewerbs. Alonso Ruizpalacios Netflix-Produktion "Una película de policías" zeigt den Alltag mexikanischer Polizisten, mit viel Blaulicht, klirrenden Handschellen und Einsätzen am Limit. Zum Sound cooler Siebzigerjahre-Musik setzt dieser pseudo-dokumentarische Reißer in geskripteter Realität ebenso auf die Verderbtheit korrupter Cops wie auf den Appeal der Uniform: "Mein Name ist Maria Teresa Hernandez Canas. Ich bin 34 Jahre alt und seit siebzehn Jahren bei der Truppe." Ein angeberischer Film.

In jeder Hinsicht das Gegenstück dazu ist Maria Speths dreieinhalbstündige Dokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse", ein fantastisches Werk der genauen, einfühlsamen Beobachtung, das mit dreieinhalb Stunden vielleicht etwas überdehnt ist, aber auch von Stunde zu Stunde in immer tiefere Schichten vordringt. Auch sie hat einen Silbernen Bären absolut verdient, wenn nicht mehr. Bachmann ist Lehrer an einer Schule im hessischen Stadtallendorf. Typ: echt unspießiger Vertrauenslehrer, ein alter Rock'n'Roller, der nicht Respektsperson sein will, sondern der lässigste Kerl im Raum, der sich aber so behutsam wie beharrlich den Zugang zu all seinen Schülerinnen und Schülern erarbeitet: zu Ayman, lknur, Ferhan, Hasan, Cengiz, Samy und Stefi, die sich in ihrer neuen deutschen Heimat so fremd, orientierungslos und zweitklassig fühlen. Die spüren, dass Türken in der Türkei irgendwie toller sind als Türken in Deutschland. Die davon träumen, Ärztin oder Sängerin zu werden, oder Friseur, damit sie drinnen arbeiten können, wenn es kalt wird. Auf der Weihnachtsfeier spielt die Klassenband "Knocking on Heaven's Door", die marokkanische Mutter bringt Süßigkeiten mit, und alle filmen sich mit dem Handy. Aber soll niemand glauben, sie machen hier nur Musik. Es gibt auch Deutsch und natürlich Mathe: Als Bachmann den Unterschied von Glück und Wahrscheinlichkeit erklären will, ziehen alle Jungs zufällig Nieten. Die Sache mit der Chance verstehen sie falsch und irgendwie dennoch richtig: "Wir sind alle unglücklich." Ein großartiger Film über einen großartigen Lehrer, der sehr genau weiß, was seine Aufgabe ist, und ein Gegengift zu allen hysterisierten Schuldiskussionen. Ach, und erst mal diese liebenswerte Kinder!

Und natürlich gehen dem iranischen Kino nicht die tragischen Geschichten aus. Leider, möchte man fast sagen. Bereits im vorigen Jahr hat Mohammad Rasoulof mit seinem bewegenden Film "There is no Evil" den Goldenen Bären gewonnen. Nun erzählen Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha in ihrer "Ballade von der weißen Kuh" die Geschichte einer Frau, deren Mann wegen Mordes zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Unschuldig, wie sich herausstellt. Obwohl sich Mina, gespielt von Maryam Moghaddam selbst, allein mit ihrer taubstummen Tochter mehr schlecht als recht durchschlägt, nimmt sie den Kampf gegen die Behörden um Wiedergutmachung auf, bis einer der Richter unerkannt in ihr Leben tritt. Es ist eine tieftraurige, ausweglose Geschichte, der Film fasst sie mit ruhiger Kamera, verhaltenen Bewegungen und zarten Gesten und natürlich, wie stets im Iran, in geschlossenen Räumen. Aber "Die Ballade von der weißen Kuh" ist auch ein Lehrstück über Verbrechen und Strafe, Wahrheit und Wiedergutmachung: Dem Film voran gestellt ist ein Vers aus der Sure von der Kuh, der Al-Baqarah. Moses sagt darin zu seinem Volk: "Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten!" Und es antwortet: "Machst du dich über uns lustig?"
Der Silberne Bär für die beste Nebendarstellung geht an die ungarische Schauspielerin Lilla Kizlinger, die in Bence Fliegaufs Psychodrama "Forest - I See You Everywhere" ein junges Mädchen spielt, das ihrem Vater die Schuld am Tod der Mutter gibt. Fast eine halbe Stunde hält ihr Gesicht die Kamera in ihrem Bann. Der Preis fürs beste Schauspiel hätte gut an Tom Schilling in Dominik Grafs überwältigendem "Fabian" gehen können, aber da stand wahrscheinlich die neue Gender-Ordnung vor. Er ging an Maren Eggert für ihre Rolle in Maria Schraders "Ich bin Dein Mensch". Schwer zu sagen, was sich die sechsköpfige Jury aus Ildikó Enyedi, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Mohammad Rasoulof, Gianfranco Rosi und Jasmila Zbanic beim Silbernen Bären für Dénes Nagys in dunklen Farben dräuendes Kriegsdrama "Natural Light" gedacht hat. Nagy zeigt einen Trupp ungarischer Soldaten, die im Verbund mit der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion eingefallen sind. An deren Beispiel ein moralische Dilemma des Mannes im Krieg aufzeigen zu wollen, ist schon ein bisschen heikel.
Mit dieser starken Präsenz des deutschen Kinos, vielen osteuropäischen Filmemachern und bewegendem Stoff aus dem Iran ist es nicht leicht, diese zweite Berlinale mit Carlo Chatrian als künstlerischem Leiter von einer unter Dieter Kosslick zu unterscheiden. Es gab vielfältiges und solides AutorInnenkino, aber keine großen Sensationen, keine künstlerische Flamboyanz und vielleicht etwas wenig kosmopolitisches Flair. Filme aus Italien und Spanien, Südamerika, Afrika und Südostasien fehlten ganz, auch das amerikanische Independent-Kino, das bei Chatrians voriger Berlinale Furore machte.
Das Forum hat sich, wie ergänzt werden kann, in diesem Jahr auf fünfzehn Filme beschränkt. Mit einem Schwerpunkt auf Debüts und essayistischem Filmemachen hat sich Sektionsleiterin Cristina Nord um ein konsistentes Programm bemüht, das vielleicht mitunter ins Filmhochschulhafte abglitt. Aber Vincent Meessens Jean-Luc Godard verpflichtete Hommage auf den senegalesischen Intellektuellen Omar Blondin Diop, der in Godards "Chinoise" in der Rolle des schwarzen Revolutionärs auftritt, zeigte sehr eindrucksvoll, wie intellektuelles und auch visuell reflektiertes Filmemachen auf der Höhe der Zeit aussehen kann. Auch Moumouni Sanous dokumentarischer Film "Garderie nocturne" über eine Gruppe von burkinischen Prostituierten und ihren Kindern, was sehr schön, intim und traurig zugleich.
Chatrians zweiter Wettbewerb "Encounters" ist in diesem Jahr allerdings untergegangen. Die Preise für Alice Diops etwas müden Parisfilm "Nous" und Le Baos hochstilisierte Meditation "Taste" und "Das Mädchen und die Spinne" von Ramon & Silvan Zürcher machen diese zweite Reihe nicht unbedingt zwingend. Aber welche Entscheidungen sind der Pandemie geschuldet, welche sind Setzungen? Ein wenig wirkt es, als hätte der Apparat in der Krise verlässlich weitergearbeitet. Die Maschinerie hat einige sehr sehenswerte Filme ans Licht gebracht. Jetzt müssen sie nur noch in offene Kinos kommen können.

Am Ende war es nämlich doch erstaunlich, wie viel Kinozauber der Wettbewerb in der zweiten Hälfte entfaltete. Und wie gut das tat! Das ist vor allem zwei Filmen zu verdanken, die bemerkenswert komplementär zueinander stehen. Alexandre Koberidzes "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" erzählt uns ein modernen Märchen aus der georgischen Stadt Kutaissi. Dort gibt es zwei Liebende, die durch einen bösen Fluch voneinander getrennt sind, einen wunderbar reißenden Fluss und ein kleines Café, in dem sich Lisa und Giorgi einfach nicht erkennen wollen, zumindest nicht ohne die Hilfe Kinos. Projekt: Verzauberung des Alltags. Der Film ist eine Reverenz an den Magischen Realismus und von einem etwas nostalgischen Glauben an die Macht des Kinos getragen. Aber er verfehlt seine Wirkung nicht. Zweieinhalb Stunden reinste Poesie.

Mit märchenhaften Elementen spielt auch Ryusuke Hamaguchis Episodenfilm "Wheel of Fortune and Fantasy". Er erzählt in drei unverbundenen Kurzgeschichten von den Liebesverwirrungen moderner Frauen unterschiedlichen Alters und erinnert ein bisschen an Sally Rooney oder Banana Yoshimoto. In der ersten Geschichte tratschen zwei Frauen vergnügt über den neuen Flirt der einen, über Romantik, Sex und Erotik, bis sich herausstellt, um wen es sich bei dem Typen handelt. In der zweiten versucht eine Studentin, ihren Literaturprofessor in eine Honigfalle zu locken, und in der dritten halten sich zwei Frauen irrtümlich aber zu ihrer beider Glück für ehemalige Schulfreundinnen. In jeder Episode wechselt Hamaguchi die Tonlage, Poppiges geht über ins Zartbittere und weiter in die sanfte Melancholie. Nach einem Jahr der erzwungenen Ruhe und Entspannung hauen einen die Jugend, Energie und Liebessehnsucht in diesem Film schier um. Er hat dafür sehr zu Recht einen Silbernen bekommen.
Die hervorragenden Filme von Hamaguchi und Koberidze zeigen sehr schön die beiden Richtungen, in die sich das internationale Kino mittlerweile bewegt: Hamaguchis mit einem starken Drehbuch, angesagten Themen, cleveren Plots und Pointen in Serie, Koberidse mit der Stimme des Filmemachers, einer unkonventionellen Bildsprache und dem Anspruch auf Weltgeltung aus der eigenen kulturellem Verwurzelung heraus. Das globale Kino und das Weltkino.
In einer ähnlichen Konstellation, aber deutlich ungleichgewichtiger finden sich die beiden Dokumentarfilme des Wettbewerbs. Alonso Ruizpalacios Netflix-Produktion "Una película de policías" zeigt den Alltag mexikanischer Polizisten, mit viel Blaulicht, klirrenden Handschellen und Einsätzen am Limit. Zum Sound cooler Siebzigerjahre-Musik setzt dieser pseudo-dokumentarische Reißer in geskripteter Realität ebenso auf die Verderbtheit korrupter Cops wie auf den Appeal der Uniform: "Mein Name ist Maria Teresa Hernandez Canas. Ich bin 34 Jahre alt und seit siebzehn Jahren bei der Truppe." Ein angeberischer Film.

In jeder Hinsicht das Gegenstück dazu ist Maria Speths dreieinhalbstündige Dokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse", ein fantastisches Werk der genauen, einfühlsamen Beobachtung, das mit dreieinhalb Stunden vielleicht etwas überdehnt ist, aber auch von Stunde zu Stunde in immer tiefere Schichten vordringt. Auch sie hat einen Silbernen Bären absolut verdient, wenn nicht mehr. Bachmann ist Lehrer an einer Schule im hessischen Stadtallendorf. Typ: echt unspießiger Vertrauenslehrer, ein alter Rock'n'Roller, der nicht Respektsperson sein will, sondern der lässigste Kerl im Raum, der sich aber so behutsam wie beharrlich den Zugang zu all seinen Schülerinnen und Schülern erarbeitet: zu Ayman, lknur, Ferhan, Hasan, Cengiz, Samy und Stefi, die sich in ihrer neuen deutschen Heimat so fremd, orientierungslos und zweitklassig fühlen. Die spüren, dass Türken in der Türkei irgendwie toller sind als Türken in Deutschland. Die davon träumen, Ärztin oder Sängerin zu werden, oder Friseur, damit sie drinnen arbeiten können, wenn es kalt wird. Auf der Weihnachtsfeier spielt die Klassenband "Knocking on Heaven's Door", die marokkanische Mutter bringt Süßigkeiten mit, und alle filmen sich mit dem Handy. Aber soll niemand glauben, sie machen hier nur Musik. Es gibt auch Deutsch und natürlich Mathe: Als Bachmann den Unterschied von Glück und Wahrscheinlichkeit erklären will, ziehen alle Jungs zufällig Nieten. Die Sache mit der Chance verstehen sie falsch und irgendwie dennoch richtig: "Wir sind alle unglücklich." Ein großartiger Film über einen großartigen Lehrer, der sehr genau weiß, was seine Aufgabe ist, und ein Gegengift zu allen hysterisierten Schuldiskussionen. Ach, und erst mal diese liebenswerte Kinder!

Und natürlich gehen dem iranischen Kino nicht die tragischen Geschichten aus. Leider, möchte man fast sagen. Bereits im vorigen Jahr hat Mohammad Rasoulof mit seinem bewegenden Film "There is no Evil" den Goldenen Bären gewonnen. Nun erzählen Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha in ihrer "Ballade von der weißen Kuh" die Geschichte einer Frau, deren Mann wegen Mordes zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Unschuldig, wie sich herausstellt. Obwohl sich Mina, gespielt von Maryam Moghaddam selbst, allein mit ihrer taubstummen Tochter mehr schlecht als recht durchschlägt, nimmt sie den Kampf gegen die Behörden um Wiedergutmachung auf, bis einer der Richter unerkannt in ihr Leben tritt. Es ist eine tieftraurige, ausweglose Geschichte, der Film fasst sie mit ruhiger Kamera, verhaltenen Bewegungen und zarten Gesten und natürlich, wie stets im Iran, in geschlossenen Räumen. Aber "Die Ballade von der weißen Kuh" ist auch ein Lehrstück über Verbrechen und Strafe, Wahrheit und Wiedergutmachung: Dem Film voran gestellt ist ein Vers aus der Sure von der Kuh, der Al-Baqarah. Moses sagt darin zu seinem Volk: "Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten!" Und es antwortet: "Machst du dich über uns lustig?"
Der Silberne Bär für die beste Nebendarstellung geht an die ungarische Schauspielerin Lilla Kizlinger, die in Bence Fliegaufs Psychodrama "Forest - I See You Everywhere" ein junges Mädchen spielt, das ihrem Vater die Schuld am Tod der Mutter gibt. Fast eine halbe Stunde hält ihr Gesicht die Kamera in ihrem Bann. Der Preis fürs beste Schauspiel hätte gut an Tom Schilling in Dominik Grafs überwältigendem "Fabian" gehen können, aber da stand wahrscheinlich die neue Gender-Ordnung vor. Er ging an Maren Eggert für ihre Rolle in Maria Schraders "Ich bin Dein Mensch". Schwer zu sagen, was sich die sechsköpfige Jury aus Ildikó Enyedi, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Mohammad Rasoulof, Gianfranco Rosi und Jasmila Zbanic beim Silbernen Bären für Dénes Nagys in dunklen Farben dräuendes Kriegsdrama "Natural Light" gedacht hat. Nagy zeigt einen Trupp ungarischer Soldaten, die im Verbund mit der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion eingefallen sind. An deren Beispiel ein moralische Dilemma des Mannes im Krieg aufzeigen zu wollen, ist schon ein bisschen heikel.
Mit dieser starken Präsenz des deutschen Kinos, vielen osteuropäischen Filmemachern und bewegendem Stoff aus dem Iran ist es nicht leicht, diese zweite Berlinale mit Carlo Chatrian als künstlerischem Leiter von einer unter Dieter Kosslick zu unterscheiden. Es gab vielfältiges und solides AutorInnenkino, aber keine großen Sensationen, keine künstlerische Flamboyanz und vielleicht etwas wenig kosmopolitisches Flair. Filme aus Italien und Spanien, Südamerika, Afrika und Südostasien fehlten ganz, auch das amerikanische Independent-Kino, das bei Chatrians voriger Berlinale Furore machte.
Das Forum hat sich, wie ergänzt werden kann, in diesem Jahr auf fünfzehn Filme beschränkt. Mit einem Schwerpunkt auf Debüts und essayistischem Filmemachen hat sich Sektionsleiterin Cristina Nord um ein konsistentes Programm bemüht, das vielleicht mitunter ins Filmhochschulhafte abglitt. Aber Vincent Meessens Jean-Luc Godard verpflichtete Hommage auf den senegalesischen Intellektuellen Omar Blondin Diop, der in Godards "Chinoise" in der Rolle des schwarzen Revolutionärs auftritt, zeigte sehr eindrucksvoll, wie intellektuelles und auch visuell reflektiertes Filmemachen auf der Höhe der Zeit aussehen kann. Auch Moumouni Sanous dokumentarischer Film "Garderie nocturne" über eine Gruppe von burkinischen Prostituierten und ihren Kindern, was sehr schön, intim und traurig zugleich.
Chatrians zweiter Wettbewerb "Encounters" ist in diesem Jahr allerdings untergegangen. Die Preise für Alice Diops etwas müden Parisfilm "Nous" und Le Baos hochstilisierte Meditation "Taste" und "Das Mädchen und die Spinne" von Ramon & Silvan Zürcher machen diese zweite Reihe nicht unbedingt zwingend. Aber welche Entscheidungen sind der Pandemie geschuldet, welche sind Setzungen? Ein wenig wirkt es, als hätte der Apparat in der Krise verlässlich weitergearbeitet. Die Maschinerie hat einige sehr sehenswerte Filme ans Licht gebracht. Jetzt müssen sie nur noch in offene Kinos kommen können.
Kommentieren