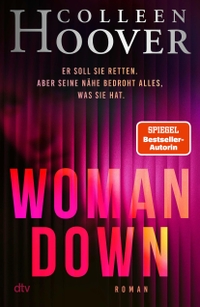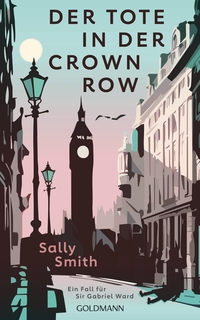Am Ende durfte auf einem dichtbesetzten Podium kurz auch mal die Dame von Google sprechen. Sie sehe gar nicht, wo das Problem sei, sagte Anabella Weisl, die bei Google Deutschland für die Buchsuche zuständig ist: Zwischen den Interessen von Google und den Interessen der Unterzeichner des Heidelberger Appells bestehe doch gar kein Widerspruch. Herzliches Gelächter.
Weisl hatte es wirklich nicht leicht. Das Kräfteverhältnis von Befürwortern des Appells zu Google war auf dieser Veranstaltung ungefähr so ungleich wie das Kräfteverhältnis von Google zu den Appellierenden im Internet. Ausgerichtet war sie ja gerade von den Initiatoren des Appells. Das Frankfurter Literaturhaus hatte seine Räume geboten. Die Schirmherrschaft (und auch das viel zu knapp bemessene Büffet?) hatte ausgerechnet die Frankfurter Allgemeine Zeitung übernommen. Frank Schirrmacher höchstselbst hatte die Einführungsworte sprechen sollen hielt sich aber interessanter Weise fern - vielleicht möchte er nicht, wie jüngst Hubert Burda, den Zorn der doch konsistenter werdenden Blogosphäre auf sich ziehen? Statt dessen schickte er Hannes Hintermeier an die Front.
Hintermeier ist zuständig für die Berichterstattung über den Buchmarkt im FAZ-Feuilleton und bekräftigte die Position seiner Zeitung, die fest an der Seite der Urheber steht, sofern es die eigene Vertragsfreiheit nicht berührt. Auf den umstrittenen Umgang der FAZ mit den Rechten der Autoren ging er nicht ein, betonte aber, dass sich die FAZ nicht auf das Niveau von Lobbyisten hinabziehen lassen wolle und bezichtigte Google der Piraterie. "Im Grunde geht es um die Aushöhlung und Abschaffung des Urheberrechts."
Es war die Stunde Roland Reuß', dessen verbliebene Haarpracht den Kahlkopf umkränzt, als sei sie aus Lorbeer geflochten. Das passte zur Feierlichkeit seines Diskurses. Reuß ist Erfinder des Heidelberger Appells. Von "Hingabe" war die Rede, von "Sorge", "Verantwortung" und "Werkherrschaft". Reuß ist Editionswissenschaftler, Herausgeber der penibelst möglichen Kafka-Ausgabe, darum aber rhetorisch nicht untalentiert. Bestimmte Wörter wie "Blogs", "Community", "Geschäftsmodell" packte er in die stachligsten Anführungszeichen, die sein Philologenköfferchen bereit hielt. Es hörte sich ein bisschen an wie ein live vorgetragener Manufactumkatalog, der Kampf der Wählscheibe gegen das Tastentelefon.
Reuß betonte zu Beginn seines Vortrags, dass es ihm ausschließlich um die persönlichkeitsrechtlichen, keineswegs die vermögensrechtlichen Aspekte des Themas gehe, nämlich um sein verbrieftes Recht als Autor zu bestimmen, in welcher Form seine Werke publiziert werden. Und dies auch gegen die "allgemeine Respektlosigkeit der sogenannten Konsumenten". Es herrsche im Internet ein "hedonistischer und antiindividualistischer Furor, der leicht ins Kannibalistische abgleiten kann". Gegen die "populistischen Diskurse" derer, die "alles gleich und umsonst haben wollen" brachte er das "geistige und sittliche Band zwischen Autor und Werk" in Anschlag. Er sei wie der Vater seiner Werke. Der von ihm beschworene Zwang zu Open Access und Googles Bemächtigung erschienen wie eine Entführung seiner Kinder in ein Stadion, wo sie dann ohne weitere Aufsicht einem entfesselten Mob ausgeliefert wären.
Denn auch gegen "Open Access", nicht nur gegen die Digitalisierung seiner Werke durch Google, führte er seine "Autorschaft als Werkherrschaft in digitaler Zeit" (so der Titel der Veranstaltung) ins Feld. Er beklagte einen sanften oder direkten Zwang zur Publikation im Netz, der durch die Wissenschaftsorganisationen ausgeübt werde und malte aus, was alles mit seinem Werk im Netz passieren könnte: Leute könnten es ändern, es könnte in Zusammenhängen stehen, die ihm nicht behagen. "Ein Autor kann etwas dagegen haben, sein Werk auf einer von Werbeeinnahmen finanzierten Plattform wiederzufinden." Das ziehe ihn auf ein Niveau herab, auf dem er sich nicht heimisch fühle, es beschädige die Integrität seines Werks, mehr, es taste es innerlich an, mache etwas anderes, von ihm nicht Gewolltes aus dem Werk.
Reuß prangerte auch Fehler an, die bei der Digitalisierung von Bücher passieren. "Dass ich als Autor für eine Textgestalt haftbar gemacht werde, die ich niemals autorisiert habe", beklagte Reuß - alles in allem eine "Straftat gigantischen Ausmaßes".
Das Publikum sah sich außerdem der Erkenntnis konfrontiert, dass Google und andere mit der Digitalisierung von Reuß' Kafka-Kommentaren "krude ökonomische Interessen" verfolgten. So etwas wie "Fair use", ein Interesse der Allgemeinheit an der Verfügbarkeit des Weltwissens sprach er nicht an. Eine Sozialbindung seines geistigen Eigentums erkannte er ausdrücklich nicht an.
Seine Gegner machte Reuß nicht namhaft, sprach nur von "Plagiatori im Internet" und "Geschäftmodelljodlern, die mit den Stimmen von Eunuchen sprechen, welche, selbst unfruchtbar, mit der Arbeit anderer Geld verdienen wollen".
Am Ende seiner Rede wurde er konkret: "Das Zivilrecht reicht nicht aus." Reuß forderte ein selbsttätiges Eingreifen der Staatsanwaltschaft. Dafür müssten Urheberrechtsverstöße zur Straftat erklärt werden. Und dies möglichst auf europäischer Ebene. Das aufgewühlte Publikum entließ er in die Kaffeepause.
Eine ähnlich extreme Position vertrat in etwas brachialer, aber unterhaltsamer Rhetorik danach nur der Heidelberger Arbeitsrechtler Volker Rieble, der aber betonte, nicht als Juraprofessor, sondern in seiner Eigenschaft als Autor zu sprechen. Er bestand sozusagen auf der totalen Publikationsfreiheit als Wissenschaftler. Auch Förderung durch Steuerzahler und sein Status als von der Öffentlichkeit alimentierter Kopf, der der Allgemeinheit in irgendeiner Weise nützlich sein sollte, dürfe keinen Einfluss auf sein Publizieren haben. Er sah sich zum Beispiel als Teil einer Elite und möchte bestimmte seiner Werke nicht ohne seine Zustimmung einem von ihm als unqualifiziert angesehenen Netzpublikum zugeführt sehen. Bei späterer Gelegenheit wird er sicherlich erklären, wie er den Zugang zu Bibliotheken zu regulieren gedenkt.
Danach wurde die Diskussion dann doch gelassener. Wenn Verleger wie zum Beispiel Hans Dieter Beck, der Chef der juristischen Abteilung des Beck-Verlags sprechen, wird deutlich, dass es eben tatsächliche Sorgen um ein seit Jahrhunderten bestehendes Geschäftsmodell gibt. Und dass "Geschäftsmodell", nebenbei bemerkt, kein unanständiges Wort ist. Beck legte dar, dass konkurrierende Kommentare zu bestimmten Rechtsgebieten nur durch eine Konkurrenz der Verlage entstehen könnten. Glitten juristische Publikationen zum größten Teil ins Open Access, so würde auch diese Vielfalt schrumpfen, gab er zu bedenken. Ähnlich argumentierte übrigens der Wissenschaftsverleger Matthias Ulmer, der beklagte, dass in kleineren Wissenschaftsgebieten, in denen er auf Verkäufe an Bibliotheken und Institute angewiesen ist, durch die digitale Weitergabe von Büchern praktisch keine Produktion von Lehrbüchern mehr möglich ist. Es könnte also sein, dass die Produktion von Wissen auf bestimmten Gebieten in kommerziellen Modellen unmöglich wird.
Beck, Ulmer und später auch Jonathan Landgrebe, kaufmännischer Geschäftsführer des Suhrkamp Verlags legten trotzdem Zuversicht an den Tag. Landgrebe machte keinen Hehl daraus, dass er den dunkel dröhnenden Heidelberger Appell vor allem als Instrument zur Klärung von Interessen ansieht und kritisierte weniger die Google Buchsuche an sich als die Gefahr, dass Google in diesem Feld zum Monopolisten werden könnte. Alle drei Verleger sahen ihren Trumpf vor allem in der verlegerischen Kompetenz, die nicht so leicht durch alternative Publikationsformen im Netz ausgespielt werden kann. Verlage selektieren, sie kennen den Markt, sie finden die Autoren, sie kriegen es hin, dass diese Autoren tatsächlich schreiben, sie lektorieren ihre Manuskripte und bringen die Bücher an den Käufer. Das alles lässt sich nicht durch Open Access oder eine Blogsoftware erledigen. Als Anabella Weisl zu bedenken gab, dass durch die Google Buchsuche vergriffene Bücher, die wirtschaftlich längst Leichen waren, wieder zu einem Einnahmefaktor werden, dürften manchem Verleger im Publikum das Wasser im Munde zusammengelaufen sein. Zumindest für die Publikumsverlage dürfte die Digitalisierung auch eine Menge Chancen bieten.
Auch beim Google Book Settlement ist noch nicht alles verloren, rief Burkhard Hess, noch ein Juraprofessor, noch mal aus Heidelberg, der in diesem überaus kniffligen juristischen Vorgang Chancen der Bundesregierung sah einzugreifen, und zwar durch einen "Beitritt als Amicus curiae", wodurch die Bundesregierung - wenn man das als Nichtjurist überhaupt einigermaßen treffend wiedergeben kann - Einfluss auf die endgültige Ausgestaltung des Arrangements nehmen kann. Prompt meldete sich eine Dame aus dem Bundesjustizministerium und gab bekannt, dass die Bundesregierung tatsächlich gedenke, in diesem Sinn aktiv zu werden.
Ob nach all dem die Urheber selbst profitieren werden, die von den verschiedenen Interessensvertretern gerne vorgeschickt werden, weil "Urheberrecht" edler klingt als "Verwerterinteresse", bezweifelte der Juraprofessor Alexander Peukert von der Uni Frankfurt, der beim Book Settlement alles in allem einen abweichenden Standpunkt vertrat, in der Frage der Google Buchsuche nicht dramatisieren wollte und rundheraus bestritt, dass es irgendwo tatsächlich einen "Publikationszwang" im Namen von Open Access gebe. Er schien das für einen Popanz zu halten, hinter dem sich die besagten Interessen verschiedener Akteure verbargen. Peukert sprach auch als einziger den Ruf der Medienkonzerne nach einem Leistungsschutzrecht an und zog damit die Proteste des Börsenvereins auf sich, der beteuerte, anders als die Zeitungskonzerne keine derartigen Rechte einführen zu wollen. Den totalen Eigentumsanspruch der Autoren Reuß und Rieple wehrte Peukert mit einem Spruch des Bundesverfassungsgerichts ab: "Werke gehen in das Allgemeingut ein."
Aber profitieren, so Peukert, werden die Autoren bei dem, was aus diesem "Meinungskampf um die Kontrolle der wirtschaftlichen Früchte aus dem Internet" herauskommt, nicht. Die Diskussion nach seinem Vortrag machte das deutlich. Er war nach dem Google Book Settlement davon ausgegangen, dass Google 37 Prozent der Einnahmen aus der kontextsensitiven Werbung in der Nähe digitalisierter Bücher bekommt und der Autor 63 Prozent. Nein, korrigierte Christian Sprang vom Börsenverein mit gespitzten Lippen. Es heißt "bis zu" 63 Prozent. Der Rest geht je nach Vertrag an die Verlage - und bei künftigen Verträgen dürfte dieser Rest genau hundert Prozent von 63 Prozent groß sein.
Am Ende stand also wie immer bei den leidenschaftlichsten deutschen Debatten die Frage: Wer kriegt wie viel Prozent wovon?
Weisl hatte es wirklich nicht leicht. Das Kräfteverhältnis von Befürwortern des Appells zu Google war auf dieser Veranstaltung ungefähr so ungleich wie das Kräfteverhältnis von Google zu den Appellierenden im Internet. Ausgerichtet war sie ja gerade von den Initiatoren des Appells. Das Frankfurter Literaturhaus hatte seine Räume geboten. Die Schirmherrschaft (und auch das viel zu knapp bemessene Büffet?) hatte ausgerechnet die Frankfurter Allgemeine Zeitung übernommen. Frank Schirrmacher höchstselbst hatte die Einführungsworte sprechen sollen hielt sich aber interessanter Weise fern - vielleicht möchte er nicht, wie jüngst Hubert Burda, den Zorn der doch konsistenter werdenden Blogosphäre auf sich ziehen? Statt dessen schickte er Hannes Hintermeier an die Front.
Hintermeier ist zuständig für die Berichterstattung über den Buchmarkt im FAZ-Feuilleton und bekräftigte die Position seiner Zeitung, die fest an der Seite der Urheber steht, sofern es die eigene Vertragsfreiheit nicht berührt. Auf den umstrittenen Umgang der FAZ mit den Rechten der Autoren ging er nicht ein, betonte aber, dass sich die FAZ nicht auf das Niveau von Lobbyisten hinabziehen lassen wolle und bezichtigte Google der Piraterie. "Im Grunde geht es um die Aushöhlung und Abschaffung des Urheberrechts."
Es war die Stunde Roland Reuß', dessen verbliebene Haarpracht den Kahlkopf umkränzt, als sei sie aus Lorbeer geflochten. Das passte zur Feierlichkeit seines Diskurses. Reuß ist Erfinder des Heidelberger Appells. Von "Hingabe" war die Rede, von "Sorge", "Verantwortung" und "Werkherrschaft". Reuß ist Editionswissenschaftler, Herausgeber der penibelst möglichen Kafka-Ausgabe, darum aber rhetorisch nicht untalentiert. Bestimmte Wörter wie "Blogs", "Community", "Geschäftsmodell" packte er in die stachligsten Anführungszeichen, die sein Philologenköfferchen bereit hielt. Es hörte sich ein bisschen an wie ein live vorgetragener Manufactumkatalog, der Kampf der Wählscheibe gegen das Tastentelefon.
Reuß betonte zu Beginn seines Vortrags, dass es ihm ausschließlich um die persönlichkeitsrechtlichen, keineswegs die vermögensrechtlichen Aspekte des Themas gehe, nämlich um sein verbrieftes Recht als Autor zu bestimmen, in welcher Form seine Werke publiziert werden. Und dies auch gegen die "allgemeine Respektlosigkeit der sogenannten Konsumenten". Es herrsche im Internet ein "hedonistischer und antiindividualistischer Furor, der leicht ins Kannibalistische abgleiten kann". Gegen die "populistischen Diskurse" derer, die "alles gleich und umsonst haben wollen" brachte er das "geistige und sittliche Band zwischen Autor und Werk" in Anschlag. Er sei wie der Vater seiner Werke. Der von ihm beschworene Zwang zu Open Access und Googles Bemächtigung erschienen wie eine Entführung seiner Kinder in ein Stadion, wo sie dann ohne weitere Aufsicht einem entfesselten Mob ausgeliefert wären.
Denn auch gegen "Open Access", nicht nur gegen die Digitalisierung seiner Werke durch Google, führte er seine "Autorschaft als Werkherrschaft in digitaler Zeit" (so der Titel der Veranstaltung) ins Feld. Er beklagte einen sanften oder direkten Zwang zur Publikation im Netz, der durch die Wissenschaftsorganisationen ausgeübt werde und malte aus, was alles mit seinem Werk im Netz passieren könnte: Leute könnten es ändern, es könnte in Zusammenhängen stehen, die ihm nicht behagen. "Ein Autor kann etwas dagegen haben, sein Werk auf einer von Werbeeinnahmen finanzierten Plattform wiederzufinden." Das ziehe ihn auf ein Niveau herab, auf dem er sich nicht heimisch fühle, es beschädige die Integrität seines Werks, mehr, es taste es innerlich an, mache etwas anderes, von ihm nicht Gewolltes aus dem Werk.
Reuß prangerte auch Fehler an, die bei der Digitalisierung von Bücher passieren. "Dass ich als Autor für eine Textgestalt haftbar gemacht werde, die ich niemals autorisiert habe", beklagte Reuß - alles in allem eine "Straftat gigantischen Ausmaßes".
Das Publikum sah sich außerdem der Erkenntnis konfrontiert, dass Google und andere mit der Digitalisierung von Reuß' Kafka-Kommentaren "krude ökonomische Interessen" verfolgten. So etwas wie "Fair use", ein Interesse der Allgemeinheit an der Verfügbarkeit des Weltwissens sprach er nicht an. Eine Sozialbindung seines geistigen Eigentums erkannte er ausdrücklich nicht an.
Seine Gegner machte Reuß nicht namhaft, sprach nur von "Plagiatori im Internet" und "Geschäftmodelljodlern, die mit den Stimmen von Eunuchen sprechen, welche, selbst unfruchtbar, mit der Arbeit anderer Geld verdienen wollen".
Am Ende seiner Rede wurde er konkret: "Das Zivilrecht reicht nicht aus." Reuß forderte ein selbsttätiges Eingreifen der Staatsanwaltschaft. Dafür müssten Urheberrechtsverstöße zur Straftat erklärt werden. Und dies möglichst auf europäischer Ebene. Das aufgewühlte Publikum entließ er in die Kaffeepause.
Eine ähnlich extreme Position vertrat in etwas brachialer, aber unterhaltsamer Rhetorik danach nur der Heidelberger Arbeitsrechtler Volker Rieble, der aber betonte, nicht als Juraprofessor, sondern in seiner Eigenschaft als Autor zu sprechen. Er bestand sozusagen auf der totalen Publikationsfreiheit als Wissenschaftler. Auch Förderung durch Steuerzahler und sein Status als von der Öffentlichkeit alimentierter Kopf, der der Allgemeinheit in irgendeiner Weise nützlich sein sollte, dürfe keinen Einfluss auf sein Publizieren haben. Er sah sich zum Beispiel als Teil einer Elite und möchte bestimmte seiner Werke nicht ohne seine Zustimmung einem von ihm als unqualifiziert angesehenen Netzpublikum zugeführt sehen. Bei späterer Gelegenheit wird er sicherlich erklären, wie er den Zugang zu Bibliotheken zu regulieren gedenkt.
Danach wurde die Diskussion dann doch gelassener. Wenn Verleger wie zum Beispiel Hans Dieter Beck, der Chef der juristischen Abteilung des Beck-Verlags sprechen, wird deutlich, dass es eben tatsächliche Sorgen um ein seit Jahrhunderten bestehendes Geschäftsmodell gibt. Und dass "Geschäftsmodell", nebenbei bemerkt, kein unanständiges Wort ist. Beck legte dar, dass konkurrierende Kommentare zu bestimmten Rechtsgebieten nur durch eine Konkurrenz der Verlage entstehen könnten. Glitten juristische Publikationen zum größten Teil ins Open Access, so würde auch diese Vielfalt schrumpfen, gab er zu bedenken. Ähnlich argumentierte übrigens der Wissenschaftsverleger Matthias Ulmer, der beklagte, dass in kleineren Wissenschaftsgebieten, in denen er auf Verkäufe an Bibliotheken und Institute angewiesen ist, durch die digitale Weitergabe von Büchern praktisch keine Produktion von Lehrbüchern mehr möglich ist. Es könnte also sein, dass die Produktion von Wissen auf bestimmten Gebieten in kommerziellen Modellen unmöglich wird.
Beck, Ulmer und später auch Jonathan Landgrebe, kaufmännischer Geschäftsführer des Suhrkamp Verlags legten trotzdem Zuversicht an den Tag. Landgrebe machte keinen Hehl daraus, dass er den dunkel dröhnenden Heidelberger Appell vor allem als Instrument zur Klärung von Interessen ansieht und kritisierte weniger die Google Buchsuche an sich als die Gefahr, dass Google in diesem Feld zum Monopolisten werden könnte. Alle drei Verleger sahen ihren Trumpf vor allem in der verlegerischen Kompetenz, die nicht so leicht durch alternative Publikationsformen im Netz ausgespielt werden kann. Verlage selektieren, sie kennen den Markt, sie finden die Autoren, sie kriegen es hin, dass diese Autoren tatsächlich schreiben, sie lektorieren ihre Manuskripte und bringen die Bücher an den Käufer. Das alles lässt sich nicht durch Open Access oder eine Blogsoftware erledigen. Als Anabella Weisl zu bedenken gab, dass durch die Google Buchsuche vergriffene Bücher, die wirtschaftlich längst Leichen waren, wieder zu einem Einnahmefaktor werden, dürften manchem Verleger im Publikum das Wasser im Munde zusammengelaufen sein. Zumindest für die Publikumsverlage dürfte die Digitalisierung auch eine Menge Chancen bieten.
Auch beim Google Book Settlement ist noch nicht alles verloren, rief Burkhard Hess, noch ein Juraprofessor, noch mal aus Heidelberg, der in diesem überaus kniffligen juristischen Vorgang Chancen der Bundesregierung sah einzugreifen, und zwar durch einen "Beitritt als Amicus curiae", wodurch die Bundesregierung - wenn man das als Nichtjurist überhaupt einigermaßen treffend wiedergeben kann - Einfluss auf die endgültige Ausgestaltung des Arrangements nehmen kann. Prompt meldete sich eine Dame aus dem Bundesjustizministerium und gab bekannt, dass die Bundesregierung tatsächlich gedenke, in diesem Sinn aktiv zu werden.
Ob nach all dem die Urheber selbst profitieren werden, die von den verschiedenen Interessensvertretern gerne vorgeschickt werden, weil "Urheberrecht" edler klingt als "Verwerterinteresse", bezweifelte der Juraprofessor Alexander Peukert von der Uni Frankfurt, der beim Book Settlement alles in allem einen abweichenden Standpunkt vertrat, in der Frage der Google Buchsuche nicht dramatisieren wollte und rundheraus bestritt, dass es irgendwo tatsächlich einen "Publikationszwang" im Namen von Open Access gebe. Er schien das für einen Popanz zu halten, hinter dem sich die besagten Interessen verschiedener Akteure verbargen. Peukert sprach auch als einziger den Ruf der Medienkonzerne nach einem Leistungsschutzrecht an und zog damit die Proteste des Börsenvereins auf sich, der beteuerte, anders als die Zeitungskonzerne keine derartigen Rechte einführen zu wollen. Den totalen Eigentumsanspruch der Autoren Reuß und Rieple wehrte Peukert mit einem Spruch des Bundesverfassungsgerichts ab: "Werke gehen in das Allgemeingut ein."
Aber profitieren, so Peukert, werden die Autoren bei dem, was aus diesem "Meinungskampf um die Kontrolle der wirtschaftlichen Früchte aus dem Internet" herauskommt, nicht. Die Diskussion nach seinem Vortrag machte das deutlich. Er war nach dem Google Book Settlement davon ausgegangen, dass Google 37 Prozent der Einnahmen aus der kontextsensitiven Werbung in der Nähe digitalisierter Bücher bekommt und der Autor 63 Prozent. Nein, korrigierte Christian Sprang vom Börsenverein mit gespitzten Lippen. Es heißt "bis zu" 63 Prozent. Der Rest geht je nach Vertrag an die Verlage - und bei künftigen Verträgen dürfte dieser Rest genau hundert Prozent von 63 Prozent groß sein.
Am Ende stand also wie immer bei den leidenschaftlichsten deutschen Debatten die Frage: Wer kriegt wie viel Prozent wovon?
Kommentieren