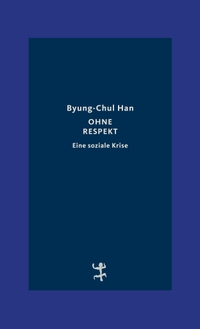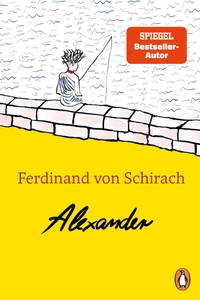Virtualienmarkt
Die wilde Online-Kultur und die ordentliche Bundestagswahl
Von Rüdiger Wischenbart
30.08.2002. Politiker und Kulturindustrie versuchen Regeln einzuhalten, die das Publikum gar nicht interessieren - und nebenbei boomt das Internet, auch wenn's keiner merkt. Das Erstaunliche am "Duell" Schröder Stoiber waren nicht die grotesken vorab verhandelten Spielregeln, die eine aufregende Debatte erst gar nicht vorstellbar machten. Verblüffend war viel mehr - wie einem aufmerksamen Kommentator auffiel -, dass sich die beiden Kandidaten auch noch dran hielten.
Nun bin ich zusehends skeptisch, ob diese seltsame Ordnungsliebe tatsächlich am überzeugendsten mit den angeblich typisch deutschen Sekundärtugenden erklärbar ist. In jedem Fall widerspricht sie ganz und gar den immer launischeren Eigenarten des (Fernseh-) Publikums, das da vor der Glotze eine heile Regelwelt vorgeführt bekam, die es im richtigen Leben wohl kaum noch irgendwo gibt.
Was Schröder&Stoiber beziehungsweise ihre Strategen da ausgeheckt hatten, erinnert mich an die ebenso irrealen Verwirrspiele, die etwa die Musikindustrie regelmäßig aufführen lässt, wenn sie, wie unlängst auf der Popkomm in Köln, mit großem PR- und Lobbyistengetöse beklagt, dass das selbe Publikum Musik kreuz und quer über Internet tauscht ohne dafür zu bezahlen und damit, so die Stimmführer der Musikkonzerne, unartig deren Wachstumsstrategien durchkreuzt.
Vielleicht fällt es, erst einmal, leichter, das Dilemma am Beispiel der Musik zu beschreiben.
Mit schöner Regelmäßigkeit wird da nämlich die Klage angestimmt, wonach Musikkultur und kulturelle Vielfalt bedroht würden, wenn man nicht seine CDs gegen Bares bezieht, sondern über Tauschbörsen aus dem Internet. "The talent and diversity of European artists is the driving force behind one of the most dynamic industries in Europe." (So der Branchenverband IFPI in einer seiner zahllosen Aussendungen.) Die Alarmglocke wird besonders heftig geschlagen, seit nicht nur der jährliche Umsatz wie auch die Zahl der verkauften Titel zurückgehen, sondern auch jährlich mehr CD-Rohlinge als bespielte Scheiben in Kundenhände geraten.
Unvoreingenommene Beobachter sehen das aus einem etwas anderen Blickwinkel. So befragte Forrester Research kürzlich Konsumenten und fand "no evidence of decreased CD buying among frequent digital music consumers". Hingegen gebe es jedoch durchaus neue Konkurrenzen, die insgesamt auf den Absatz drücken, nicht zuletzt andere Medien, Konsolenspiele und Music- wie auch Film-DVDs, und vor allem wollten die Musikkonsumenten, so die Umfrageergebnisse, mehr "Kontrolle" über die erworbene Musik. Sie wollen sie auf unterschiedlichen Geräten abspielen, und sie wollen nicht ein ganzes Album kaufen müssen, wenn sie nur ein Hit-Titel interessiert.
Kurzum, das werte Publikum sieht immer seltener ein, weshalb es Spielregeln befolgen soll, die sich die großen Konzerne untereinander zu ihrem Vorteil und nicht dem der Konsumenten ausgedacht haben.
Die Musikindustrie hat in den vergangenen ein, zwei Jahrzehnten überdies einen geradezu gespenstischen Konzentrations- und Industrialisierungsprozess durchlaufen, an dessen vorläufigen Endpunkt heute fünf "Majors" gleich Dinosauriern mit gewaltigen Marketingetats die Landschaft beherrschen, jedoch immer ununterscheidbarer und damit auch "immer unattraktiver" werden, so der Einmann-Plattenverleger Thomas Morr, der zudem glaubt herausgefunden zu haben: "Bei Majorfirmen, die man ja so auch nicht als Label wahrnimmt, ist der Hang zu kopieren einfach größer." (FAS vom 11.8.2002, Nr. 32, S.17)
Nun muss man darin nicht gleich ein geheimes Gesetz ausgleichender Gerechtigkeit vermuten. Es genügt, sich an die Anfänge der Internet-Kultur zu erinnern.
Das Internet ist nun einmal ein unordentliches Medium, das offenbar geradezu einlädt, aufgestellte Spielregeln gleich wieder zu unterlaufen und neues auszuprobieren. Vor allem aber, wusste jemand wie Howard Rheingold schon 1993 zu berichten, das Internet ist ein tolles Instrument, um Gemeinschaften - "Virtual Communities", so Rheingolds legendärer Buchtitel - zu formieren, lose Gemeinschaften, die, wie sie es benötigen, immer neue Regeln für ihr Zusammenspiel definieren.
Die Musikliebhaber, die die Tauschbörsen beleben, sind die zur Zeit zahlenmäßig wohl größte, noch dazu sehr lose, offene Community. All die Täuschler, die ihr halbes (Einkaufs-) Leben über eBay organisieren, sind ein weiteres Beispiel.
Was bei Rheingold wie bei Musikbörsen oder eBay zudem auffällt, ist ein stark pragmatisch-utilitaristischer Hang der Teilnehmer, die sich zusammentun, weil ihnen dies schlicht praktische Vorteile bringt.
Wir lesen nahezu täglich, dass die "Internet Economy" wie eine Blase geplatzt sei. Das ist angesichts der Vielzahl von Pleiten schon korrekt. Zugleich aber ist auch das Gegenteil wahr. Das Internet hat mit manchen seiner unordentlichen ökonomischen Praktiken längst weite Bereiche des Alltags durchzogen und dort die Regeln verändert, wo es einem Publikum nützlich ist, das bemerkenswert schnell gelernt hat, wählerischer, launischer und unberechenbarer zu werden, weil es plötzlich versucht, die Kontrolle über mehr und mehr Dinge direkt zu erobern.
"Rund 30 Prozent aller Gebrauchtwagen werden über das Internet verkauft", mit dieser verblüffenden Meldung überschrieb die FAZ dieser Tage eine ganze Seite voller Berichte über aktuelles Wachstum im Online-Handel insgesamt. Wiederum ist es solch eine etwas eigenwillige Gruppe, die "Gebrauchtwagenfahrer", die früher am Wochenende über Gebrauchtwagenmärkte zog und sich nun aufs Internet verlegt. Umgekehrt werden drei gewiss klug kalkulierende, dominante Verlagsgruppen - Springer, Holtzbrinck und WAZ - ihr Kleinanzeigen-Portal Versum.de wegen Unrentabilität schließen. Keiner wollte es.
Was lernen wir aus all dem über den vermutlichen Ausgang der Bundestagswahl? Vermutlich wenig. Eine ganze Menge jedoch über Verlagerungen des politischen Weichbildes bei den Wählern, über Politikverdrossenheit und die Ursachen für den stetigen Zulauf, den Gruppen wie attac verzeichnen, die außerhalb der etablierten Parteien Politik machen. Das Publikum hält sich, anders als die Politiker im Fernsehen, an keine Spielregeln mehr.
Nun bin ich zusehends skeptisch, ob diese seltsame Ordnungsliebe tatsächlich am überzeugendsten mit den angeblich typisch deutschen Sekundärtugenden erklärbar ist. In jedem Fall widerspricht sie ganz und gar den immer launischeren Eigenarten des (Fernseh-) Publikums, das da vor der Glotze eine heile Regelwelt vorgeführt bekam, die es im richtigen Leben wohl kaum noch irgendwo gibt.
Was Schröder&Stoiber beziehungsweise ihre Strategen da ausgeheckt hatten, erinnert mich an die ebenso irrealen Verwirrspiele, die etwa die Musikindustrie regelmäßig aufführen lässt, wenn sie, wie unlängst auf der Popkomm in Köln, mit großem PR- und Lobbyistengetöse beklagt, dass das selbe Publikum Musik kreuz und quer über Internet tauscht ohne dafür zu bezahlen und damit, so die Stimmführer der Musikkonzerne, unartig deren Wachstumsstrategien durchkreuzt.
Vielleicht fällt es, erst einmal, leichter, das Dilemma am Beispiel der Musik zu beschreiben.
Mit schöner Regelmäßigkeit wird da nämlich die Klage angestimmt, wonach Musikkultur und kulturelle Vielfalt bedroht würden, wenn man nicht seine CDs gegen Bares bezieht, sondern über Tauschbörsen aus dem Internet. "The talent and diversity of European artists is the driving force behind one of the most dynamic industries in Europe." (So der Branchenverband IFPI in einer seiner zahllosen Aussendungen.) Die Alarmglocke wird besonders heftig geschlagen, seit nicht nur der jährliche Umsatz wie auch die Zahl der verkauften Titel zurückgehen, sondern auch jährlich mehr CD-Rohlinge als bespielte Scheiben in Kundenhände geraten.
Unvoreingenommene Beobachter sehen das aus einem etwas anderen Blickwinkel. So befragte Forrester Research kürzlich Konsumenten und fand "no evidence of decreased CD buying among frequent digital music consumers". Hingegen gebe es jedoch durchaus neue Konkurrenzen, die insgesamt auf den Absatz drücken, nicht zuletzt andere Medien, Konsolenspiele und Music- wie auch Film-DVDs, und vor allem wollten die Musikkonsumenten, so die Umfrageergebnisse, mehr "Kontrolle" über die erworbene Musik. Sie wollen sie auf unterschiedlichen Geräten abspielen, und sie wollen nicht ein ganzes Album kaufen müssen, wenn sie nur ein Hit-Titel interessiert.
Kurzum, das werte Publikum sieht immer seltener ein, weshalb es Spielregeln befolgen soll, die sich die großen Konzerne untereinander zu ihrem Vorteil und nicht dem der Konsumenten ausgedacht haben.
Die Musikindustrie hat in den vergangenen ein, zwei Jahrzehnten überdies einen geradezu gespenstischen Konzentrations- und Industrialisierungsprozess durchlaufen, an dessen vorläufigen Endpunkt heute fünf "Majors" gleich Dinosauriern mit gewaltigen Marketingetats die Landschaft beherrschen, jedoch immer ununterscheidbarer und damit auch "immer unattraktiver" werden, so der Einmann-Plattenverleger Thomas Morr, der zudem glaubt herausgefunden zu haben: "Bei Majorfirmen, die man ja so auch nicht als Label wahrnimmt, ist der Hang zu kopieren einfach größer." (FAS vom 11.8.2002, Nr. 32, S.17)
Nun muss man darin nicht gleich ein geheimes Gesetz ausgleichender Gerechtigkeit vermuten. Es genügt, sich an die Anfänge der Internet-Kultur zu erinnern.
Das Internet ist nun einmal ein unordentliches Medium, das offenbar geradezu einlädt, aufgestellte Spielregeln gleich wieder zu unterlaufen und neues auszuprobieren. Vor allem aber, wusste jemand wie Howard Rheingold schon 1993 zu berichten, das Internet ist ein tolles Instrument, um Gemeinschaften - "Virtual Communities", so Rheingolds legendärer Buchtitel - zu formieren, lose Gemeinschaften, die, wie sie es benötigen, immer neue Regeln für ihr Zusammenspiel definieren.
Die Musikliebhaber, die die Tauschbörsen beleben, sind die zur Zeit zahlenmäßig wohl größte, noch dazu sehr lose, offene Community. All die Täuschler, die ihr halbes (Einkaufs-) Leben über eBay organisieren, sind ein weiteres Beispiel.
Was bei Rheingold wie bei Musikbörsen oder eBay zudem auffällt, ist ein stark pragmatisch-utilitaristischer Hang der Teilnehmer, die sich zusammentun, weil ihnen dies schlicht praktische Vorteile bringt.
Wir lesen nahezu täglich, dass die "Internet Economy" wie eine Blase geplatzt sei. Das ist angesichts der Vielzahl von Pleiten schon korrekt. Zugleich aber ist auch das Gegenteil wahr. Das Internet hat mit manchen seiner unordentlichen ökonomischen Praktiken längst weite Bereiche des Alltags durchzogen und dort die Regeln verändert, wo es einem Publikum nützlich ist, das bemerkenswert schnell gelernt hat, wählerischer, launischer und unberechenbarer zu werden, weil es plötzlich versucht, die Kontrolle über mehr und mehr Dinge direkt zu erobern.
"Rund 30 Prozent aller Gebrauchtwagen werden über das Internet verkauft", mit dieser verblüffenden Meldung überschrieb die FAZ dieser Tage eine ganze Seite voller Berichte über aktuelles Wachstum im Online-Handel insgesamt. Wiederum ist es solch eine etwas eigenwillige Gruppe, die "Gebrauchtwagenfahrer", die früher am Wochenende über Gebrauchtwagenmärkte zog und sich nun aufs Internet verlegt. Umgekehrt werden drei gewiss klug kalkulierende, dominante Verlagsgruppen - Springer, Holtzbrinck und WAZ - ihr Kleinanzeigen-Portal Versum.de wegen Unrentabilität schließen. Keiner wollte es.
Was lernen wir aus all dem über den vermutlichen Ausgang der Bundestagswahl? Vermutlich wenig. Eine ganze Menge jedoch über Verlagerungen des politischen Weichbildes bei den Wählern, über Politikverdrossenheit und die Ursachen für den stetigen Zulauf, den Gruppen wie attac verzeichnen, die außerhalb der etablierten Parteien Politik machen. Das Publikum hält sich, anders als die Politiker im Fernsehen, an keine Spielregeln mehr.
Kommentieren