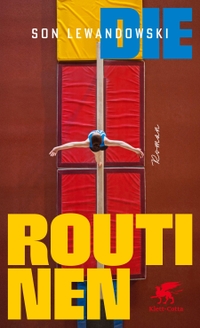Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 4. Tag
Von Ekkehard Knörer
09.02.2003. Die Filmkritik maulte: Steven Soderberghs Lem-Verfilmung "Solaris" hat sie überanstrengt. Die haben wahrscheinlich Spike Jonzes "Adaptation" nicht gesehen. Erlesenes Kunsthandwerk bot dafür Stephen Daldrys "The Hours".Erlesenes Kunsthandwerk: Stephen Daldrys "The Hours" (Wettbewerb)
 Mit großer Kunstfertigkeit bindet Regisseur Stephen Daldry in den ersten Minuten die drei Geschichten zusammen, die "The Hours" erzählen wird. Er schneidet zwischen drei Welten hin und her, dem Los Angeles des Jahres 1951, dem New York der Gegenwart und dem Jahr 1942, in dem Virginia Woolf Selbstmord begeht. Dreimal ein Blumenkauf, dreimal dieselbe Bewegung, mit der im schnellen Hintereinander filmischer Beinahe-Gleichzeitigkeit Blumen in eine Vase gestellt werden. Äußerst durchlässig sind die Membranen zwischen den Welten, die Kamera, der Blick des Betrachters gleiten hinüber von der einen Seite zur anderen, schwerelos, famos unterstützt noch vom verlässlichsten Schmiermittel, das an zeitgenössischer Soundtrack-Musik zu haben ist, den hypnotischen Minimalklängen von Philip Glass, sehr klavierlastig diesmal, aber erfolgreich in der Produktion einer Atmosphäre, die durch alle drei ineinander geschalteten Teile von "The Hours" hindurchweht.
Mit großer Kunstfertigkeit bindet Regisseur Stephen Daldry in den ersten Minuten die drei Geschichten zusammen, die "The Hours" erzählen wird. Er schneidet zwischen drei Welten hin und her, dem Los Angeles des Jahres 1951, dem New York der Gegenwart und dem Jahr 1942, in dem Virginia Woolf Selbstmord begeht. Dreimal ein Blumenkauf, dreimal dieselbe Bewegung, mit der im schnellen Hintereinander filmischer Beinahe-Gleichzeitigkeit Blumen in eine Vase gestellt werden. Äußerst durchlässig sind die Membranen zwischen den Welten, die Kamera, der Blick des Betrachters gleiten hinüber von der einen Seite zur anderen, schwerelos, famos unterstützt noch vom verlässlichsten Schmiermittel, das an zeitgenössischer Soundtrack-Musik zu haben ist, den hypnotischen Minimalklängen von Philip Glass, sehr klavierlastig diesmal, aber erfolgreich in der Produktion einer Atmosphäre, die durch alle drei ineinander geschalteten Teile von "The Hours" hindurchweht.
 Wehen aber ist das falsche Wort, denn im Grunde steht die Luft, bei Virginia Woolf in England, im Leben der Laura Brown an der amerikanischen West- und in dem Clarissa Vaughns an der Ostküste. Erzählt wird, nach dem Vorbild von Woolfs Roman "Mrs. Dalloway" (ursprünglich geplanter Titel: "The Hours") nur ein Tag aus dem Leben der drei Frauen, an diesem einen Tag jedoch, der Film zitiert es wörtlich, ein ganzes Leben. Sehr treu folgt Regisseur Daldry da seiner Vorlage, Michael Cunninghams Roman "The Hours", der mit Variationen und Übernahmen Virginia Woolfs Roman in einem cleveren Pastiche umspielt - und dafür den Pulitzer-Preis erhielt. Clarissa Vaughn (im Film: Meryl Streep) verliert den schwulen Dichter, die Liebe ihres Lebens. Laura Brown (Julianne Moore) entschließt sich eines Nachmittags, ihr Leben, ihre Familie für immer zu verlassen, um nicht im kleinbürgerlichen Alltag zu ersticken. Und Virginia Woolf (Nicole Kidman) schreibt an "Mrs. Dalloway", geplagt von ihren inneren Dämonen. Es ist im Grunde weniger ein Roman als eine Kollektion dreier motivisch verknüpfter Kurzgeschichten, eine Auswahl prägnanter Ausschnitte aus dem Leben der Hauptfigur an einem Wendepunkt ihres Schicksals.
Wehen aber ist das falsche Wort, denn im Grunde steht die Luft, bei Virginia Woolf in England, im Leben der Laura Brown an der amerikanischen West- und in dem Clarissa Vaughns an der Ostküste. Erzählt wird, nach dem Vorbild von Woolfs Roman "Mrs. Dalloway" (ursprünglich geplanter Titel: "The Hours") nur ein Tag aus dem Leben der drei Frauen, an diesem einen Tag jedoch, der Film zitiert es wörtlich, ein ganzes Leben. Sehr treu folgt Regisseur Daldry da seiner Vorlage, Michael Cunninghams Roman "The Hours", der mit Variationen und Übernahmen Virginia Woolfs Roman in einem cleveren Pastiche umspielt - und dafür den Pulitzer-Preis erhielt. Clarissa Vaughn (im Film: Meryl Streep) verliert den schwulen Dichter, die Liebe ihres Lebens. Laura Brown (Julianne Moore) entschließt sich eines Nachmittags, ihr Leben, ihre Familie für immer zu verlassen, um nicht im kleinbürgerlichen Alltag zu ersticken. Und Virginia Woolf (Nicole Kidman) schreibt an "Mrs. Dalloway", geplagt von ihren inneren Dämonen. Es ist im Grunde weniger ein Roman als eine Kollektion dreier motivisch verknüpfter Kurzgeschichten, eine Auswahl prägnanter Ausschnitte aus dem Leben der Hauptfigur an einem Wendepunkt ihres Schicksals.
 So wenig man dem Buch von Michael Cunningham die schiere technische Raffinesse absprechen konnte - so geschmäcklerisch war das Ergebnis. Die Porzellanfiguren, die Charaktere darstellen sollten, waren mit sprachlichem Woolf-Imitat geschmückt, mit allerhand Motivmaterial aus der Vorlage behängt und in ihrem jeweiligen Habitat ausgesetzt. Die Gefühle, die Motive, die Schicksalsmomente: wie in Seidenpapier eingeschlagen, raschelnd, niemals rührend, scheinhaft belebt, aber nicht lebendig. Eine problematische Vorgabe also, und leider ist Daldry eine ganz und gar kongeniale Verfilmung gelungen. "The Hours" ist in Ausstattung und Inszenierung, im Spiel der Darsteller allerbeste Qualitätsarbeit.
So wenig man dem Buch von Michael Cunningham die schiere technische Raffinesse absprechen konnte - so geschmäcklerisch war das Ergebnis. Die Porzellanfiguren, die Charaktere darstellen sollten, waren mit sprachlichem Woolf-Imitat geschmückt, mit allerhand Motivmaterial aus der Vorlage behängt und in ihrem jeweiligen Habitat ausgesetzt. Die Gefühle, die Motive, die Schicksalsmomente: wie in Seidenpapier eingeschlagen, raschelnd, niemals rührend, scheinhaft belebt, aber nicht lebendig. Eine problematische Vorgabe also, und leider ist Daldry eine ganz und gar kongeniale Verfilmung gelungen. "The Hours" ist in Ausstattung und Inszenierung, im Spiel der Darsteller allerbeste Qualitätsarbeit.
Das Ergebnis aber ist nicht Kunst, sondern lediglich erlesenes Kunsthandwerk. Alles wirkt hier wie aus zweiter Hand, Imitat eines Originals, das mit höchst liebevoll angefertigten Figurinen nachgestellt wird. Figurinen aber bleiben sie und je größer die Gefühle sein sollen, die aus den Konstellationen entspringen, desto deutlicher wird klar, dass ausschließlich Abziehbilder agieren, die zu der Wirklichkeit, in der der Film sie mit Kostüm und Interieur zu verorten sucht, nicht die mindeste Verbindung haben. Die Gefühle bleiben in den Mund gelegt und ins Zittern der Mundwinkel von Meryl Streep. Sie kommen nicht aus dem Inneren, sondern sind auf die Darsteller eines Schicksalsballetts aufgeschminkt, das mit mechanischer Präzision abläuft. Es fehlt dem ganzen nur eine weniges: Lebendigkeit, ein Hauch nur, der aus den Menschendarstellern Menschen gemacht hätte.
Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"The Hours", von Stephen Daldry. Mit Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, John C. Reilly, Ed Harris u.a., Großbritannien 2002, 110 Minuten
Termine.
Wie "Letztes Jahr in Marienbad" im Weltraum: Steven Soderberghs "Solaris" (Wettbewerb)
 "Solaris", der Roman von Stanislaw Lem, die erste Verfilmung von Andrej Tarkowskij und nun auch Steven Soderberghs Version, ist philosophische Science-Fiction. Das Interesse gilt nicht der Zukunft, nicht den Möglichkeiten des technischen oder gesellschaftlichen Fort- oder Rückschritts. "Solaris" ist weder Utopie noch Dystopie - nein, es geht darin allein um ein Gedankenspiel, für dessen Inszenierung die Kulisse der Science-Fiction benutzt wird. Und Soderbergh tut kaum mehr als das nötigste, um diese Kulisse einzurichten. Wie hingetupfte Zeichen funktionieren der ferne Planet, die Hilfsmission, die Raumstation. Der Psychologe Chris Kelvin (George Clooney), so zunächst der reine Plot, wird per Videobotschaft zu Hilfe gerufen. Ein Raumschiff, das in der Umlaufbahn des Planeten Solaris liegt, ist in Schwierigkeiten geraten, welcher Art sie sind, erfahren wir zunächst nicht. Wir sehen nicht mehr als einige statische Einstellungen, sehr bewusst Kubricks "2001" zitierend, des schwerelos treibenden Raumschiffs, der Raumstation vor dem von rötlich-lila-gelben Lichtstreifen umgürteten Planeten. Dann ist Kelvin an Bord.
"Solaris", der Roman von Stanislaw Lem, die erste Verfilmung von Andrej Tarkowskij und nun auch Steven Soderberghs Version, ist philosophische Science-Fiction. Das Interesse gilt nicht der Zukunft, nicht den Möglichkeiten des technischen oder gesellschaftlichen Fort- oder Rückschritts. "Solaris" ist weder Utopie noch Dystopie - nein, es geht darin allein um ein Gedankenspiel, für dessen Inszenierung die Kulisse der Science-Fiction benutzt wird. Und Soderbergh tut kaum mehr als das nötigste, um diese Kulisse einzurichten. Wie hingetupfte Zeichen funktionieren der ferne Planet, die Hilfsmission, die Raumstation. Der Psychologe Chris Kelvin (George Clooney), so zunächst der reine Plot, wird per Videobotschaft zu Hilfe gerufen. Ein Raumschiff, das in der Umlaufbahn des Planeten Solaris liegt, ist in Schwierigkeiten geraten, welcher Art sie sind, erfahren wir zunächst nicht. Wir sehen nicht mehr als einige statische Einstellungen, sehr bewusst Kubricks "2001" zitierend, des schwerelos treibenden Raumschiffs, der Raumstation vor dem von rötlich-lila-gelben Lichtstreifen umgürteten Planeten. Dann ist Kelvin an Bord.
 In der Raumstation sind die Farben bleich. Keine Musik zunächst, sondern die bedrohlich rauschenden, brummenden Eigengeräusche der Station. Kelvin stößt auf Spuren von Blut, trifft im Kühlraum auf Leichen - darunter die von Gibarian (Ulrich Tukur), des Mannes, der ihn zu Hilfe gerufen hatte. Auf zwei Überlebende stößt Kelvin, ihr Verhalten ist merkwürdig, in Andeutungen sprechen sie von dem Geheimnis, das hinter den seltsamen Vorgängen im Innere der Raumstation lauert. Kelvin legt sich schlafen. Soderberghs Kamera (wie fast stets ist Soderbergh, unter Pseudonym, sein eigener Kameramann) wählt einen eigenartigen verkanteten Winkel zum Blick auf Kelvins Kopf und seinen Oberkörper; in dieser fast unscheinbaren Einstellung liegt die ganze Intelligenz und Präzision des Regisseurs Soderbergh. Ins Bild gesetzt wird ein Charakter, dessen Welt aus den Fugen geraten wird. Es ist, als entspränge der schrägen Perspektive alles Folgende. Im Schlaf und doch nicht im Schlaf, in einem Zwischenreich, das evoziert, nie aber definiert wird, erscheint Kelvin seine Frau Rheya (Natasha McElhone), die vor Jahren Selbstmord begangen hat. Plötzlich, unerklärlich, aus dem Nichts ist sie da - keine Vision, kein Traum, sondern fassbare, greifbare Realität. Kelvin reagiert panisch, lockt den Geist, für den er die Erscheinung zunächst hält, in den Schleusenraum und stößt ihn hinaus in die Weiten des Alls.
In der Raumstation sind die Farben bleich. Keine Musik zunächst, sondern die bedrohlich rauschenden, brummenden Eigengeräusche der Station. Kelvin stößt auf Spuren von Blut, trifft im Kühlraum auf Leichen - darunter die von Gibarian (Ulrich Tukur), des Mannes, der ihn zu Hilfe gerufen hatte. Auf zwei Überlebende stößt Kelvin, ihr Verhalten ist merkwürdig, in Andeutungen sprechen sie von dem Geheimnis, das hinter den seltsamen Vorgängen im Innere der Raumstation lauert. Kelvin legt sich schlafen. Soderberghs Kamera (wie fast stets ist Soderbergh, unter Pseudonym, sein eigener Kameramann) wählt einen eigenartigen verkanteten Winkel zum Blick auf Kelvins Kopf und seinen Oberkörper; in dieser fast unscheinbaren Einstellung liegt die ganze Intelligenz und Präzision des Regisseurs Soderbergh. Ins Bild gesetzt wird ein Charakter, dessen Welt aus den Fugen geraten wird. Es ist, als entspränge der schrägen Perspektive alles Folgende. Im Schlaf und doch nicht im Schlaf, in einem Zwischenreich, das evoziert, nie aber definiert wird, erscheint Kelvin seine Frau Rheya (Natasha McElhone), die vor Jahren Selbstmord begangen hat. Plötzlich, unerklärlich, aus dem Nichts ist sie da - keine Vision, kein Traum, sondern fassbare, greifbare Realität. Kelvin reagiert panisch, lockt den Geist, für den er die Erscheinung zunächst hält, in den Schleusenraum und stößt ihn hinaus in die Weiten des Alls.
 Rheya jedoch kehrt wieder, mit der Insistenz eines Gespensts. Mit der Insistenz auch einer Sehnsucht, von der man nicht lassen kann. Und als Verkörperung der Unfähigkeit, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man geliebt hat (eine Szene der Trauerarbeit nach Art der anonymen Alkoholiker gibt es ganz am Anfang zu sehen). Soderbergs "Solaris" konzentriert sich fortan auf den fantastischen - oder phantasmagorischen - Zwischenraum dieser unerklärlichen Wiederkehr, des erneuten Miteinander mit dem Anschein einer zweiten Chance, das vielfach gefährdet ist: durch die Crew des Schiffs zum einen, Gordon, die Astronautin, besteht darauf, dass die "Besucher" (deren Anwesenheit ist das Geheimnis von Kelvins Auftrag) getötet werden müssen. Die Gefährdung kommt aber auch aus dem Inneren dieser Wiederkehr. Rheya ist mehr als bloße Projektion Kelvins, ein eigenständiges Wesen, ein Mensch aber ist sie nicht. In meditativen Bildern, untermalt von hypnotischer, repetitiver, pulsierender Musik entfalten sich Szenen einer Ehe.
Rheya jedoch kehrt wieder, mit der Insistenz eines Gespensts. Mit der Insistenz auch einer Sehnsucht, von der man nicht lassen kann. Und als Verkörperung der Unfähigkeit, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man geliebt hat (eine Szene der Trauerarbeit nach Art der anonymen Alkoholiker gibt es ganz am Anfang zu sehen). Soderbergs "Solaris" konzentriert sich fortan auf den fantastischen - oder phantasmagorischen - Zwischenraum dieser unerklärlichen Wiederkehr, des erneuten Miteinander mit dem Anschein einer zweiten Chance, das vielfach gefährdet ist: durch die Crew des Schiffs zum einen, Gordon, die Astronautin, besteht darauf, dass die "Besucher" (deren Anwesenheit ist das Geheimnis von Kelvins Auftrag) getötet werden müssen. Die Gefährdung kommt aber auch aus dem Inneren dieser Wiederkehr. Rheya ist mehr als bloße Projektion Kelvins, ein eigenständiges Wesen, ein Mensch aber ist sie nicht. In meditativen Bildern, untermalt von hypnotischer, repetitiver, pulsierender Musik entfalten sich Szenen einer Ehe.
Rheya, auf der Suche nach sich selbst und ihrer Identität, erinnert sich an das Leben auf der Erde, das erste Kennenlernen, die junge Liebe zu Kelvin, aber auch an Probleme des Zusammenlebens. Die Bilder dieser Erinnerung (in wärmeren Farben, Brauntönen) schneidet Soderbergh in ihre Gegenwart hinein. Es handelt sich, technisch gesehen, um Rückblenden, die aber weit mehr sind als das. Im nicht-linearen Schnitt, der unheimliche Doppelungen und Parallelisierungen von Vergangenem und Gegenwart herstellt, treibt "Solaris" die Erinnerung an die Grenze ihrer Ununterscheidbarkeit von der bloßen Einbildung. In der fast unmerklichen Parallelmontage von Erinnerung und Wirklichkeit findet dieses Stilmittel, das Soderbergh schon in seinen letzten Filmen zum Markenzeichen entwickelt hat, seinen philosophischen Gehalt. Die Objektivität des Bilds löst sich auf. Und diese Auflösung setzt Soderbergh im Schnitt ins Bild. Das Psychodrama von "Solaris" ist ein Drama der Gegenwart materialisierter Erinnerung, an der in jedem Moment alles falsch sein kann. Nur zu konsequent ist das Ende des Films. Hier nämlich löst sich noch der letzte Halt auf, die Wirklichkeit der Gegenwart des scheinbar objektiven Bildes.
 Diesseits dieser komplexen Sachverhalte ist Soderberghs "Solaris" nicht zu haben. Jede nur psychologische Lektüre wird auf eine kalte und glatte Oberfläche stoßen, ohne deren mit technischen Mitteln erzeugte Faltung in den Blick zu bekommen. Es ist kein Wunder, dass Soderbergh bei den Dreharbeiten immer wieder Filme von Alain Resnais vorgeführt hat. Sein "Solaris" ist "Letztes Jahr in Marienbad" im Weltraum. Ein Film über das Trügen des Scheins der Filmbilder, nicht weniger. Eine philosophische Meditation über Liebe und den Verlust eines geliebten Menschen ebenso wie über das Medium Film. Auf der Pressekonferenz hatte ein Journalist nichts weiter zu sagen, als dass er "Solaris" langweilig finde. George Clooney, der sich zuvor charmant, geistreich, witzig und verbindlich zeigte, war kurz davor auszurasten. "What a jerk!" (freundlich übersetzt: "Welch ein Idiot"), beschimpfte er den Mann - und meinte wohl auch die Reaktionen der weithin ähnlich gestimmten Filmkritik. "Solaris" ist eine Herausforderung. Mal sehen, ob die Jury unter dem Vorsitz des Kino-Intellektuellen Atom Egoyan sie annehmen wird.
Diesseits dieser komplexen Sachverhalte ist Soderberghs "Solaris" nicht zu haben. Jede nur psychologische Lektüre wird auf eine kalte und glatte Oberfläche stoßen, ohne deren mit technischen Mitteln erzeugte Faltung in den Blick zu bekommen. Es ist kein Wunder, dass Soderbergh bei den Dreharbeiten immer wieder Filme von Alain Resnais vorgeführt hat. Sein "Solaris" ist "Letztes Jahr in Marienbad" im Weltraum. Ein Film über das Trügen des Scheins der Filmbilder, nicht weniger. Eine philosophische Meditation über Liebe und den Verlust eines geliebten Menschen ebenso wie über das Medium Film. Auf der Pressekonferenz hatte ein Journalist nichts weiter zu sagen, als dass er "Solaris" langweilig finde. George Clooney, der sich zuvor charmant, geistreich, witzig und verbindlich zeigte, war kurz davor auszurasten. "What a jerk!" (freundlich übersetzt: "Welch ein Idiot"), beschimpfte er den Mann - und meinte wohl auch die Reaktionen der weithin ähnlich gestimmten Filmkritik. "Solaris" ist eine Herausforderung. Mal sehen, ob die Jury unter dem Vorsitz des Kino-Intellektuellen Atom Egoyan sie annehmen wird.
Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"Solaris", von Steven Soderbergh. Mit George Clooney, Natascha McElhone, Jeremy Davies, Ulrich Tukur u.a., USA 2002, 98 Minuten
Termine.
Dekonstruktivistisches Kuddelmuddel: "Adaptation" (Wettbewerb)
Susan Orlean, Journalistin beim New Yorker, hat ein Buch über Orchideen geschrieben. Charles Kaufman, Drehbuchautor, berühmt für sein Skript zu "Being John Malkovich", bekommt den Auftrag, es fürs Kino zu adaptieren. Ihm fällt nichts ein. Was tun? Ein Drehbuch schreiben, in dem es um den Drehbuchautor Charles Kaufman (aufgedunsen, neurosengeplagt: Nicolas Cage) geht, dem zur Verfilmung von "The Orchid Thief" nichts einfällt. Abgeschmackte Idee. Was tun? Ins Drehbuch einen Zwillingsbruder schreiben, Donald (dynamischer Playboy: Nicolas Cage), mit dem man über das Drehbuchschreiben diskutieren, ja, in Konkurrenz treten kann. Man nennt das selbstreflexiv und kann eine ganze Menge Gags draus ziehen, einen Besuch im Seminar eines Drehbuchgurus zum Beispiel, der - ohne alle Selbstreflexivität, versteht sich - genau die Prinzipien vertritt, die uns die stromlinienförmigen Höllenprodukte bescheren, die einem Hollywood sonst so präsentiert.
 "Adaptation" ist anders, so viel steht fest. Kein Spannungsbogen, keine vernünftige Drei- oder Sonstwas-Aktigkeit, statt dessen ein wildes Durcheinander von erzählter Geschichte, Schreiben an der Geschichte und Diskussion über das Schreiben. Am Ende werden dann, wie sich das für den postmodernen Ansatz gehört, die Diskussion und das Schreiben in die Ausgangsgeschichte zurückgefädelt. Mit Drogen, Waffen, Krokodilen. Donald Kaufman style. Man kann sich, das ist der große Vorteil des Kaufmanschen Ansatzes, so manches erlauben, so lange klar ist, dass alles Zitat bleiben wird - und sei es das Zitat eines Verlangens nach Einmaligkeit und Leidenschaft. Irony is over? Von wegen - aber das Problem hat die Stufe erreicht, auf der die Unfähigkeit, nicht ironisch zu sein, zum Problem wird. Ironisch abgehandelt, natürlich.
"Adaptation" ist anders, so viel steht fest. Kein Spannungsbogen, keine vernünftige Drei- oder Sonstwas-Aktigkeit, statt dessen ein wildes Durcheinander von erzählter Geschichte, Schreiben an der Geschichte und Diskussion über das Schreiben. Am Ende werden dann, wie sich das für den postmodernen Ansatz gehört, die Diskussion und das Schreiben in die Ausgangsgeschichte zurückgefädelt. Mit Drogen, Waffen, Krokodilen. Donald Kaufman style. Man kann sich, das ist der große Vorteil des Kaufmanschen Ansatzes, so manches erlauben, so lange klar ist, dass alles Zitat bleiben wird - und sei es das Zitat eines Verlangens nach Einmaligkeit und Leidenschaft. Irony is over? Von wegen - aber das Problem hat die Stufe erreicht, auf der die Unfähigkeit, nicht ironisch zu sein, zum Problem wird. Ironisch abgehandelt, natürlich.
Doppeldeutig ist der Titel, er bezieht sich auf die Drehbuch-Adaption, aber auch auf Darwin. Das kommt, ein wenig, von der Orchideen-Geschichte, mehr aber von Charlie Kaufmans zuletzt in seinem Buch zu Michel Gondrys "Human Nature" demonstrierten philosophischen Interesse an der Evolutionstheorie. Spike Jonze, Bruder im so ironischen wie cleveren Geiste, illustriert das gerne mal mit einem Videoclip: Vom Anfang der Welt bis Charlie Kaufman in einer Minute. Auf diese leicht postpubertäre Art stellt sich hier die Sinnfrage. Wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Kaufmans Drehbücher geben keine Antworten auf diese - im Grunde seines Herzens - ernst gemeinte Frage, sondern Ausflüchte und immer neue Abwege, die so durchgeknallt nur im Kontext Hollywood sind.
 An Hollywood aber arbeitet sich Kaufman ab, als gelte es sein Leben (der wahre Kaufmann, aber auch der so romantische wie lebensunfähige Künstler, als den er sein filmisches Alter Ego angelegt hat). Er kann so wenig vom Feindbild absehen - dem klar strukturierten Drehbuch nach Schema-F-Erfolgsrezepten -, dass er es hineinschreiben muss ins eigene, dass er sich hier, aber nicht im Ernst, mit Waffen, Drogen, Krokodilen am Thriller versucht. Aus diesem Kuddelmuddel, das als Dekonstruktion des Hollywoodfilms zu bezeichnen nicht einmal verkehrt ist (auch dazu natürlich ein Scherz im Film), führt kein Weg mehr hinaus, auch nicht für den Kritiker. Irgendwie steht der auch schon mit drin im Buch. Wenn er dann sagt: das überzeugt mich nicht, es bleibt zu viel Beliebigkeit, mancher Scherz ist doch vorhersehbar, ruft Charlie Kaufman: ick bün allhier. Sitzt da bei der Pressekonferenz, ein schüchterner Kerl mit Bart und ohne Haarausfall (ganz im Unterschied zum Film), und macht den Eindruck, als sei ihm all das, die Ironie, die Evolution, die Adaption, die Selbstreflexivität und die Sehnsucht nach der einen großen Leidenschaft, bitter Ernst. Der Kritiker ist auch nur Mensch: Vor "Adaptation" streckt er die Waffen.
An Hollywood aber arbeitet sich Kaufman ab, als gelte es sein Leben (der wahre Kaufmann, aber auch der so romantische wie lebensunfähige Künstler, als den er sein filmisches Alter Ego angelegt hat). Er kann so wenig vom Feindbild absehen - dem klar strukturierten Drehbuch nach Schema-F-Erfolgsrezepten -, dass er es hineinschreiben muss ins eigene, dass er sich hier, aber nicht im Ernst, mit Waffen, Drogen, Krokodilen am Thriller versucht. Aus diesem Kuddelmuddel, das als Dekonstruktion des Hollywoodfilms zu bezeichnen nicht einmal verkehrt ist (auch dazu natürlich ein Scherz im Film), führt kein Weg mehr hinaus, auch nicht für den Kritiker. Irgendwie steht der auch schon mit drin im Buch. Wenn er dann sagt: das überzeugt mich nicht, es bleibt zu viel Beliebigkeit, mancher Scherz ist doch vorhersehbar, ruft Charlie Kaufman: ick bün allhier. Sitzt da bei der Pressekonferenz, ein schüchterner Kerl mit Bart und ohne Haarausfall (ganz im Unterschied zum Film), und macht den Eindruck, als sei ihm all das, die Ironie, die Evolution, die Adaption, die Selbstreflexivität und die Sehnsucht nach der einen großen Leidenschaft, bitter Ernst. Der Kritiker ist auch nur Mensch: Vor "Adaptation" streckt er die Waffen.
Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"Adaption", Spike Jonze. Mit Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Clara Seymour u.a., USA, Großbritannien 2002, 117 Minuten
Termine.
Drollig, aber falsch: Junji Sakamotos "Bokunchi - Mein Haus" (Panorama)
Ein heruntergewirtschaftetes Dorf auf einer gottverlassenen Insel. Zwei Jungs, allein, die wir kennenlernen, als ihre Mutter nach Jahren zurückkehrt, mit dabei eine junge Frau, die sie den Kindern als Schwester vorstellt. Rekonfiguration einer dysfunktionalen Familie, die ganze Wahrheit ist es nicht und die Mutter verschwindet sogleich wieder. Das Setting erinnert an die Kindheitsfilme von Hou Hsiao-hsien, der Ton aber so wenig wie der Blick auf diese Welt. Sakamoto nämlich nimmt das Dorf, die Kinder, die anderen Bewohner immer nur zum Anlass: statt subtilen Humors gibt es schräge Scherze und statt auf die distanzierte Beobachtung von Gefühlen setzt er auf Kindergesichter in Großaufnahme, Klaviergeklimper im Hintergrund.
 Das Episodische seines Erzählens ist nicht Verzicht auf Dramaturgie, sondern dient der Reihung von voneinander abgekoppelten Szenen, denen Skurrilität abgepresst wird. Skurril auch das Personal, das durchs Bild läuft, mehr nicht. Eine alte irre Lady mit einer Menge Katzen, bei deren Beerdigung aus dem Nichts eine Unzahl Kinder und Schwiegerkinder auftauchen und tanzen. Typisch wieder der Blick auf den Tanz: keinerlei Interesse am Ritual in seiner Seltsamkeit, nur an der Seltsamkeit, als die es dargestellt wird. Dann eine junge Frau vor dem chinesischen Restaurant, stumm, immerzu ihr Haar bearbeitend. Ein Mann mit seinen Kindern, erbärmlich in einem von einer Plastikplane notdürftig gedeckten Gewächshaus lebend, wird nur gebraucht, um für die eine oder andere Pointe ausgenutzt zu werden. Drangeklatscht ein Schmetterling: das Schöne im Ärmlichen, von einem Klischee fällt der Film ins andere.
Das Episodische seines Erzählens ist nicht Verzicht auf Dramaturgie, sondern dient der Reihung von voneinander abgekoppelten Szenen, denen Skurrilität abgepresst wird. Skurril auch das Personal, das durchs Bild läuft, mehr nicht. Eine alte irre Lady mit einer Menge Katzen, bei deren Beerdigung aus dem Nichts eine Unzahl Kinder und Schwiegerkinder auftauchen und tanzen. Typisch wieder der Blick auf den Tanz: keinerlei Interesse am Ritual in seiner Seltsamkeit, nur an der Seltsamkeit, als die es dargestellt wird. Dann eine junge Frau vor dem chinesischen Restaurant, stumm, immerzu ihr Haar bearbeitend. Ein Mann mit seinen Kindern, erbärmlich in einem von einer Plastikplane notdürftig gedeckten Gewächshaus lebend, wird nur gebraucht, um für die eine oder andere Pointe ausgenutzt zu werden. Drangeklatscht ein Schmetterling: das Schöne im Ärmlichen, von einem Klischee fällt der Film ins andere.
 Erzählen will Bokunchi eigentlich von Beziehungen: Zwischen Itta, dem größeren Jungen, und dem Kleinkriminellen, dem er sich andient. Zwischen Nita und seiner Schwester, die ihr Geld im Bordell verdient hat und wieder verdient. Und zwischen Mutter und Tochter, die am Ende zueinander finden, indem sie die beiden Jungs aufgeben. Das alles bleibt bloße Behauptung, weil der Film selbst beziehungsunfähig ist. Er giert nach Pointen und verschenkt an sie seine Figuren. Alle Gefühle sind so aus zweiter Hand, abgepresst der abgedroschenen filmsprachlichen Grammatik, dem abgeschmacktesten Zueinander von Bild und Ton. Sakamoto strebt, scheint es, nach dem Bittersüßen der Filme Kaurismäkis, ohne im mindesten zu verstehen, dass die Poesie und die Pointen sich aus der Liebe und der Genauigkeit ergeben, mit denen Kaurismäki die Menschen beobachtet und ihre Welt. In Bokunchi regiert von Anfang an die Drolligkeit. Das ist ein Problem der Form im engsten Sinne. Die Bilder, die Gefühle, die Figuren, alles ist hier falsch.
Erzählen will Bokunchi eigentlich von Beziehungen: Zwischen Itta, dem größeren Jungen, und dem Kleinkriminellen, dem er sich andient. Zwischen Nita und seiner Schwester, die ihr Geld im Bordell verdient hat und wieder verdient. Und zwischen Mutter und Tochter, die am Ende zueinander finden, indem sie die beiden Jungs aufgeben. Das alles bleibt bloße Behauptung, weil der Film selbst beziehungsunfähig ist. Er giert nach Pointen und verschenkt an sie seine Figuren. Alle Gefühle sind so aus zweiter Hand, abgepresst der abgedroschenen filmsprachlichen Grammatik, dem abgeschmacktesten Zueinander von Bild und Ton. Sakamoto strebt, scheint es, nach dem Bittersüßen der Filme Kaurismäkis, ohne im mindesten zu verstehen, dass die Poesie und die Pointen sich aus der Liebe und der Genauigkeit ergeben, mit denen Kaurismäki die Menschen beobachtet und ihre Welt. In Bokunchi regiert von Anfang an die Drolligkeit. Das ist ein Problem der Form im engsten Sinne. Die Bilder, die Gefühle, die Figuren, alles ist hier falsch.
Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"Bokunchi - Mein Haus", Junji Sakamoto. Mit Alisa Mizuki, Yuma Yamoto, Yuki Tanaka, Claude Maki, Ran Ohtori u.a., Japan 2002, 116 Minuten
Termine.
 Mit großer Kunstfertigkeit bindet Regisseur Stephen Daldry in den ersten Minuten die drei Geschichten zusammen, die "The Hours" erzählen wird. Er schneidet zwischen drei Welten hin und her, dem Los Angeles des Jahres 1951, dem New York der Gegenwart und dem Jahr 1942, in dem Virginia Woolf Selbstmord begeht. Dreimal ein Blumenkauf, dreimal dieselbe Bewegung, mit der im schnellen Hintereinander filmischer Beinahe-Gleichzeitigkeit Blumen in eine Vase gestellt werden. Äußerst durchlässig sind die Membranen zwischen den Welten, die Kamera, der Blick des Betrachters gleiten hinüber von der einen Seite zur anderen, schwerelos, famos unterstützt noch vom verlässlichsten Schmiermittel, das an zeitgenössischer Soundtrack-Musik zu haben ist, den hypnotischen Minimalklängen von Philip Glass, sehr klavierlastig diesmal, aber erfolgreich in der Produktion einer Atmosphäre, die durch alle drei ineinander geschalteten Teile von "The Hours" hindurchweht.
Mit großer Kunstfertigkeit bindet Regisseur Stephen Daldry in den ersten Minuten die drei Geschichten zusammen, die "The Hours" erzählen wird. Er schneidet zwischen drei Welten hin und her, dem Los Angeles des Jahres 1951, dem New York der Gegenwart und dem Jahr 1942, in dem Virginia Woolf Selbstmord begeht. Dreimal ein Blumenkauf, dreimal dieselbe Bewegung, mit der im schnellen Hintereinander filmischer Beinahe-Gleichzeitigkeit Blumen in eine Vase gestellt werden. Äußerst durchlässig sind die Membranen zwischen den Welten, die Kamera, der Blick des Betrachters gleiten hinüber von der einen Seite zur anderen, schwerelos, famos unterstützt noch vom verlässlichsten Schmiermittel, das an zeitgenössischer Soundtrack-Musik zu haben ist, den hypnotischen Minimalklängen von Philip Glass, sehr klavierlastig diesmal, aber erfolgreich in der Produktion einer Atmosphäre, die durch alle drei ineinander geschalteten Teile von "The Hours" hindurchweht.  Wehen aber ist das falsche Wort, denn im Grunde steht die Luft, bei Virginia Woolf in England, im Leben der Laura Brown an der amerikanischen West- und in dem Clarissa Vaughns an der Ostküste. Erzählt wird, nach dem Vorbild von Woolfs Roman "Mrs. Dalloway" (ursprünglich geplanter Titel: "The Hours") nur ein Tag aus dem Leben der drei Frauen, an diesem einen Tag jedoch, der Film zitiert es wörtlich, ein ganzes Leben. Sehr treu folgt Regisseur Daldry da seiner Vorlage, Michael Cunninghams Roman "The Hours", der mit Variationen und Übernahmen Virginia Woolfs Roman in einem cleveren Pastiche umspielt - und dafür den Pulitzer-Preis erhielt. Clarissa Vaughn (im Film: Meryl Streep) verliert den schwulen Dichter, die Liebe ihres Lebens. Laura Brown (Julianne Moore) entschließt sich eines Nachmittags, ihr Leben, ihre Familie für immer zu verlassen, um nicht im kleinbürgerlichen Alltag zu ersticken. Und Virginia Woolf (Nicole Kidman) schreibt an "Mrs. Dalloway", geplagt von ihren inneren Dämonen. Es ist im Grunde weniger ein Roman als eine Kollektion dreier motivisch verknüpfter Kurzgeschichten, eine Auswahl prägnanter Ausschnitte aus dem Leben der Hauptfigur an einem Wendepunkt ihres Schicksals.
Wehen aber ist das falsche Wort, denn im Grunde steht die Luft, bei Virginia Woolf in England, im Leben der Laura Brown an der amerikanischen West- und in dem Clarissa Vaughns an der Ostküste. Erzählt wird, nach dem Vorbild von Woolfs Roman "Mrs. Dalloway" (ursprünglich geplanter Titel: "The Hours") nur ein Tag aus dem Leben der drei Frauen, an diesem einen Tag jedoch, der Film zitiert es wörtlich, ein ganzes Leben. Sehr treu folgt Regisseur Daldry da seiner Vorlage, Michael Cunninghams Roman "The Hours", der mit Variationen und Übernahmen Virginia Woolfs Roman in einem cleveren Pastiche umspielt - und dafür den Pulitzer-Preis erhielt. Clarissa Vaughn (im Film: Meryl Streep) verliert den schwulen Dichter, die Liebe ihres Lebens. Laura Brown (Julianne Moore) entschließt sich eines Nachmittags, ihr Leben, ihre Familie für immer zu verlassen, um nicht im kleinbürgerlichen Alltag zu ersticken. Und Virginia Woolf (Nicole Kidman) schreibt an "Mrs. Dalloway", geplagt von ihren inneren Dämonen. Es ist im Grunde weniger ein Roman als eine Kollektion dreier motivisch verknüpfter Kurzgeschichten, eine Auswahl prägnanter Ausschnitte aus dem Leben der Hauptfigur an einem Wendepunkt ihres Schicksals.  So wenig man dem Buch von Michael Cunningham die schiere technische Raffinesse absprechen konnte - so geschmäcklerisch war das Ergebnis. Die Porzellanfiguren, die Charaktere darstellen sollten, waren mit sprachlichem Woolf-Imitat geschmückt, mit allerhand Motivmaterial aus der Vorlage behängt und in ihrem jeweiligen Habitat ausgesetzt. Die Gefühle, die Motive, die Schicksalsmomente: wie in Seidenpapier eingeschlagen, raschelnd, niemals rührend, scheinhaft belebt, aber nicht lebendig. Eine problematische Vorgabe also, und leider ist Daldry eine ganz und gar kongeniale Verfilmung gelungen. "The Hours" ist in Ausstattung und Inszenierung, im Spiel der Darsteller allerbeste Qualitätsarbeit.
So wenig man dem Buch von Michael Cunningham die schiere technische Raffinesse absprechen konnte - so geschmäcklerisch war das Ergebnis. Die Porzellanfiguren, die Charaktere darstellen sollten, waren mit sprachlichem Woolf-Imitat geschmückt, mit allerhand Motivmaterial aus der Vorlage behängt und in ihrem jeweiligen Habitat ausgesetzt. Die Gefühle, die Motive, die Schicksalsmomente: wie in Seidenpapier eingeschlagen, raschelnd, niemals rührend, scheinhaft belebt, aber nicht lebendig. Eine problematische Vorgabe also, und leider ist Daldry eine ganz und gar kongeniale Verfilmung gelungen. "The Hours" ist in Ausstattung und Inszenierung, im Spiel der Darsteller allerbeste Qualitätsarbeit. Das Ergebnis aber ist nicht Kunst, sondern lediglich erlesenes Kunsthandwerk. Alles wirkt hier wie aus zweiter Hand, Imitat eines Originals, das mit höchst liebevoll angefertigten Figurinen nachgestellt wird. Figurinen aber bleiben sie und je größer die Gefühle sein sollen, die aus den Konstellationen entspringen, desto deutlicher wird klar, dass ausschließlich Abziehbilder agieren, die zu der Wirklichkeit, in der der Film sie mit Kostüm und Interieur zu verorten sucht, nicht die mindeste Verbindung haben. Die Gefühle bleiben in den Mund gelegt und ins Zittern der Mundwinkel von Meryl Streep. Sie kommen nicht aus dem Inneren, sondern sind auf die Darsteller eines Schicksalsballetts aufgeschminkt, das mit mechanischer Präzision abläuft. Es fehlt dem ganzen nur eine weniges: Lebendigkeit, ein Hauch nur, der aus den Menschendarstellern Menschen gemacht hätte.
Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"The Hours", von Stephen Daldry. Mit Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, John C. Reilly, Ed Harris u.a., Großbritannien 2002, 110 Minuten
Termine.
Wie "Letztes Jahr in Marienbad" im Weltraum: Steven Soderberghs "Solaris" (Wettbewerb)
 "Solaris", der Roman von Stanislaw Lem, die erste Verfilmung von Andrej Tarkowskij und nun auch Steven Soderberghs Version, ist philosophische Science-Fiction. Das Interesse gilt nicht der Zukunft, nicht den Möglichkeiten des technischen oder gesellschaftlichen Fort- oder Rückschritts. "Solaris" ist weder Utopie noch Dystopie - nein, es geht darin allein um ein Gedankenspiel, für dessen Inszenierung die Kulisse der Science-Fiction benutzt wird. Und Soderbergh tut kaum mehr als das nötigste, um diese Kulisse einzurichten. Wie hingetupfte Zeichen funktionieren der ferne Planet, die Hilfsmission, die Raumstation. Der Psychologe Chris Kelvin (George Clooney), so zunächst der reine Plot, wird per Videobotschaft zu Hilfe gerufen. Ein Raumschiff, das in der Umlaufbahn des Planeten Solaris liegt, ist in Schwierigkeiten geraten, welcher Art sie sind, erfahren wir zunächst nicht. Wir sehen nicht mehr als einige statische Einstellungen, sehr bewusst Kubricks "2001" zitierend, des schwerelos treibenden Raumschiffs, der Raumstation vor dem von rötlich-lila-gelben Lichtstreifen umgürteten Planeten. Dann ist Kelvin an Bord.
"Solaris", der Roman von Stanislaw Lem, die erste Verfilmung von Andrej Tarkowskij und nun auch Steven Soderberghs Version, ist philosophische Science-Fiction. Das Interesse gilt nicht der Zukunft, nicht den Möglichkeiten des technischen oder gesellschaftlichen Fort- oder Rückschritts. "Solaris" ist weder Utopie noch Dystopie - nein, es geht darin allein um ein Gedankenspiel, für dessen Inszenierung die Kulisse der Science-Fiction benutzt wird. Und Soderbergh tut kaum mehr als das nötigste, um diese Kulisse einzurichten. Wie hingetupfte Zeichen funktionieren der ferne Planet, die Hilfsmission, die Raumstation. Der Psychologe Chris Kelvin (George Clooney), so zunächst der reine Plot, wird per Videobotschaft zu Hilfe gerufen. Ein Raumschiff, das in der Umlaufbahn des Planeten Solaris liegt, ist in Schwierigkeiten geraten, welcher Art sie sind, erfahren wir zunächst nicht. Wir sehen nicht mehr als einige statische Einstellungen, sehr bewusst Kubricks "2001" zitierend, des schwerelos treibenden Raumschiffs, der Raumstation vor dem von rötlich-lila-gelben Lichtstreifen umgürteten Planeten. Dann ist Kelvin an Bord.  In der Raumstation sind die Farben bleich. Keine Musik zunächst, sondern die bedrohlich rauschenden, brummenden Eigengeräusche der Station. Kelvin stößt auf Spuren von Blut, trifft im Kühlraum auf Leichen - darunter die von Gibarian (Ulrich Tukur), des Mannes, der ihn zu Hilfe gerufen hatte. Auf zwei Überlebende stößt Kelvin, ihr Verhalten ist merkwürdig, in Andeutungen sprechen sie von dem Geheimnis, das hinter den seltsamen Vorgängen im Innere der Raumstation lauert. Kelvin legt sich schlafen. Soderberghs Kamera (wie fast stets ist Soderbergh, unter Pseudonym, sein eigener Kameramann) wählt einen eigenartigen verkanteten Winkel zum Blick auf Kelvins Kopf und seinen Oberkörper; in dieser fast unscheinbaren Einstellung liegt die ganze Intelligenz und Präzision des Regisseurs Soderbergh. Ins Bild gesetzt wird ein Charakter, dessen Welt aus den Fugen geraten wird. Es ist, als entspränge der schrägen Perspektive alles Folgende. Im Schlaf und doch nicht im Schlaf, in einem Zwischenreich, das evoziert, nie aber definiert wird, erscheint Kelvin seine Frau Rheya (Natasha McElhone), die vor Jahren Selbstmord begangen hat. Plötzlich, unerklärlich, aus dem Nichts ist sie da - keine Vision, kein Traum, sondern fassbare, greifbare Realität. Kelvin reagiert panisch, lockt den Geist, für den er die Erscheinung zunächst hält, in den Schleusenraum und stößt ihn hinaus in die Weiten des Alls.
In der Raumstation sind die Farben bleich. Keine Musik zunächst, sondern die bedrohlich rauschenden, brummenden Eigengeräusche der Station. Kelvin stößt auf Spuren von Blut, trifft im Kühlraum auf Leichen - darunter die von Gibarian (Ulrich Tukur), des Mannes, der ihn zu Hilfe gerufen hatte. Auf zwei Überlebende stößt Kelvin, ihr Verhalten ist merkwürdig, in Andeutungen sprechen sie von dem Geheimnis, das hinter den seltsamen Vorgängen im Innere der Raumstation lauert. Kelvin legt sich schlafen. Soderberghs Kamera (wie fast stets ist Soderbergh, unter Pseudonym, sein eigener Kameramann) wählt einen eigenartigen verkanteten Winkel zum Blick auf Kelvins Kopf und seinen Oberkörper; in dieser fast unscheinbaren Einstellung liegt die ganze Intelligenz und Präzision des Regisseurs Soderbergh. Ins Bild gesetzt wird ein Charakter, dessen Welt aus den Fugen geraten wird. Es ist, als entspränge der schrägen Perspektive alles Folgende. Im Schlaf und doch nicht im Schlaf, in einem Zwischenreich, das evoziert, nie aber definiert wird, erscheint Kelvin seine Frau Rheya (Natasha McElhone), die vor Jahren Selbstmord begangen hat. Plötzlich, unerklärlich, aus dem Nichts ist sie da - keine Vision, kein Traum, sondern fassbare, greifbare Realität. Kelvin reagiert panisch, lockt den Geist, für den er die Erscheinung zunächst hält, in den Schleusenraum und stößt ihn hinaus in die Weiten des Alls.  Rheya jedoch kehrt wieder, mit der Insistenz eines Gespensts. Mit der Insistenz auch einer Sehnsucht, von der man nicht lassen kann. Und als Verkörperung der Unfähigkeit, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man geliebt hat (eine Szene der Trauerarbeit nach Art der anonymen Alkoholiker gibt es ganz am Anfang zu sehen). Soderbergs "Solaris" konzentriert sich fortan auf den fantastischen - oder phantasmagorischen - Zwischenraum dieser unerklärlichen Wiederkehr, des erneuten Miteinander mit dem Anschein einer zweiten Chance, das vielfach gefährdet ist: durch die Crew des Schiffs zum einen, Gordon, die Astronautin, besteht darauf, dass die "Besucher" (deren Anwesenheit ist das Geheimnis von Kelvins Auftrag) getötet werden müssen. Die Gefährdung kommt aber auch aus dem Inneren dieser Wiederkehr. Rheya ist mehr als bloße Projektion Kelvins, ein eigenständiges Wesen, ein Mensch aber ist sie nicht. In meditativen Bildern, untermalt von hypnotischer, repetitiver, pulsierender Musik entfalten sich Szenen einer Ehe.
Rheya jedoch kehrt wieder, mit der Insistenz eines Gespensts. Mit der Insistenz auch einer Sehnsucht, von der man nicht lassen kann. Und als Verkörperung der Unfähigkeit, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man geliebt hat (eine Szene der Trauerarbeit nach Art der anonymen Alkoholiker gibt es ganz am Anfang zu sehen). Soderbergs "Solaris" konzentriert sich fortan auf den fantastischen - oder phantasmagorischen - Zwischenraum dieser unerklärlichen Wiederkehr, des erneuten Miteinander mit dem Anschein einer zweiten Chance, das vielfach gefährdet ist: durch die Crew des Schiffs zum einen, Gordon, die Astronautin, besteht darauf, dass die "Besucher" (deren Anwesenheit ist das Geheimnis von Kelvins Auftrag) getötet werden müssen. Die Gefährdung kommt aber auch aus dem Inneren dieser Wiederkehr. Rheya ist mehr als bloße Projektion Kelvins, ein eigenständiges Wesen, ein Mensch aber ist sie nicht. In meditativen Bildern, untermalt von hypnotischer, repetitiver, pulsierender Musik entfalten sich Szenen einer Ehe. Rheya, auf der Suche nach sich selbst und ihrer Identität, erinnert sich an das Leben auf der Erde, das erste Kennenlernen, die junge Liebe zu Kelvin, aber auch an Probleme des Zusammenlebens. Die Bilder dieser Erinnerung (in wärmeren Farben, Brauntönen) schneidet Soderbergh in ihre Gegenwart hinein. Es handelt sich, technisch gesehen, um Rückblenden, die aber weit mehr sind als das. Im nicht-linearen Schnitt, der unheimliche Doppelungen und Parallelisierungen von Vergangenem und Gegenwart herstellt, treibt "Solaris" die Erinnerung an die Grenze ihrer Ununterscheidbarkeit von der bloßen Einbildung. In der fast unmerklichen Parallelmontage von Erinnerung und Wirklichkeit findet dieses Stilmittel, das Soderbergh schon in seinen letzten Filmen zum Markenzeichen entwickelt hat, seinen philosophischen Gehalt. Die Objektivität des Bilds löst sich auf. Und diese Auflösung setzt Soderbergh im Schnitt ins Bild. Das Psychodrama von "Solaris" ist ein Drama der Gegenwart materialisierter Erinnerung, an der in jedem Moment alles falsch sein kann. Nur zu konsequent ist das Ende des Films. Hier nämlich löst sich noch der letzte Halt auf, die Wirklichkeit der Gegenwart des scheinbar objektiven Bildes.
 Diesseits dieser komplexen Sachverhalte ist Soderberghs "Solaris" nicht zu haben. Jede nur psychologische Lektüre wird auf eine kalte und glatte Oberfläche stoßen, ohne deren mit technischen Mitteln erzeugte Faltung in den Blick zu bekommen. Es ist kein Wunder, dass Soderbergh bei den Dreharbeiten immer wieder Filme von Alain Resnais vorgeführt hat. Sein "Solaris" ist "Letztes Jahr in Marienbad" im Weltraum. Ein Film über das Trügen des Scheins der Filmbilder, nicht weniger. Eine philosophische Meditation über Liebe und den Verlust eines geliebten Menschen ebenso wie über das Medium Film. Auf der Pressekonferenz hatte ein Journalist nichts weiter zu sagen, als dass er "Solaris" langweilig finde. George Clooney, der sich zuvor charmant, geistreich, witzig und verbindlich zeigte, war kurz davor auszurasten. "What a jerk!" (freundlich übersetzt: "Welch ein Idiot"), beschimpfte er den Mann - und meinte wohl auch die Reaktionen der weithin ähnlich gestimmten Filmkritik. "Solaris" ist eine Herausforderung. Mal sehen, ob die Jury unter dem Vorsitz des Kino-Intellektuellen Atom Egoyan sie annehmen wird.
Diesseits dieser komplexen Sachverhalte ist Soderberghs "Solaris" nicht zu haben. Jede nur psychologische Lektüre wird auf eine kalte und glatte Oberfläche stoßen, ohne deren mit technischen Mitteln erzeugte Faltung in den Blick zu bekommen. Es ist kein Wunder, dass Soderbergh bei den Dreharbeiten immer wieder Filme von Alain Resnais vorgeführt hat. Sein "Solaris" ist "Letztes Jahr in Marienbad" im Weltraum. Ein Film über das Trügen des Scheins der Filmbilder, nicht weniger. Eine philosophische Meditation über Liebe und den Verlust eines geliebten Menschen ebenso wie über das Medium Film. Auf der Pressekonferenz hatte ein Journalist nichts weiter zu sagen, als dass er "Solaris" langweilig finde. George Clooney, der sich zuvor charmant, geistreich, witzig und verbindlich zeigte, war kurz davor auszurasten. "What a jerk!" (freundlich übersetzt: "Welch ein Idiot"), beschimpfte er den Mann - und meinte wohl auch die Reaktionen der weithin ähnlich gestimmten Filmkritik. "Solaris" ist eine Herausforderung. Mal sehen, ob die Jury unter dem Vorsitz des Kino-Intellektuellen Atom Egoyan sie annehmen wird. Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"Solaris", von Steven Soderbergh. Mit George Clooney, Natascha McElhone, Jeremy Davies, Ulrich Tukur u.a., USA 2002, 98 Minuten
Termine.
Dekonstruktivistisches Kuddelmuddel: "Adaptation" (Wettbewerb)
Susan Orlean, Journalistin beim New Yorker, hat ein Buch über Orchideen geschrieben. Charles Kaufman, Drehbuchautor, berühmt für sein Skript zu "Being John Malkovich", bekommt den Auftrag, es fürs Kino zu adaptieren. Ihm fällt nichts ein. Was tun? Ein Drehbuch schreiben, in dem es um den Drehbuchautor Charles Kaufman (aufgedunsen, neurosengeplagt: Nicolas Cage) geht, dem zur Verfilmung von "The Orchid Thief" nichts einfällt. Abgeschmackte Idee. Was tun? Ins Drehbuch einen Zwillingsbruder schreiben, Donald (dynamischer Playboy: Nicolas Cage), mit dem man über das Drehbuchschreiben diskutieren, ja, in Konkurrenz treten kann. Man nennt das selbstreflexiv und kann eine ganze Menge Gags draus ziehen, einen Besuch im Seminar eines Drehbuchgurus zum Beispiel, der - ohne alle Selbstreflexivität, versteht sich - genau die Prinzipien vertritt, die uns die stromlinienförmigen Höllenprodukte bescheren, die einem Hollywood sonst so präsentiert.
 "Adaptation" ist anders, so viel steht fest. Kein Spannungsbogen, keine vernünftige Drei- oder Sonstwas-Aktigkeit, statt dessen ein wildes Durcheinander von erzählter Geschichte, Schreiben an der Geschichte und Diskussion über das Schreiben. Am Ende werden dann, wie sich das für den postmodernen Ansatz gehört, die Diskussion und das Schreiben in die Ausgangsgeschichte zurückgefädelt. Mit Drogen, Waffen, Krokodilen. Donald Kaufman style. Man kann sich, das ist der große Vorteil des Kaufmanschen Ansatzes, so manches erlauben, so lange klar ist, dass alles Zitat bleiben wird - und sei es das Zitat eines Verlangens nach Einmaligkeit und Leidenschaft. Irony is over? Von wegen - aber das Problem hat die Stufe erreicht, auf der die Unfähigkeit, nicht ironisch zu sein, zum Problem wird. Ironisch abgehandelt, natürlich.
"Adaptation" ist anders, so viel steht fest. Kein Spannungsbogen, keine vernünftige Drei- oder Sonstwas-Aktigkeit, statt dessen ein wildes Durcheinander von erzählter Geschichte, Schreiben an der Geschichte und Diskussion über das Schreiben. Am Ende werden dann, wie sich das für den postmodernen Ansatz gehört, die Diskussion und das Schreiben in die Ausgangsgeschichte zurückgefädelt. Mit Drogen, Waffen, Krokodilen. Donald Kaufman style. Man kann sich, das ist der große Vorteil des Kaufmanschen Ansatzes, so manches erlauben, so lange klar ist, dass alles Zitat bleiben wird - und sei es das Zitat eines Verlangens nach Einmaligkeit und Leidenschaft. Irony is over? Von wegen - aber das Problem hat die Stufe erreicht, auf der die Unfähigkeit, nicht ironisch zu sein, zum Problem wird. Ironisch abgehandelt, natürlich. Doppeldeutig ist der Titel, er bezieht sich auf die Drehbuch-Adaption, aber auch auf Darwin. Das kommt, ein wenig, von der Orchideen-Geschichte, mehr aber von Charlie Kaufmans zuletzt in seinem Buch zu Michel Gondrys "Human Nature" demonstrierten philosophischen Interesse an der Evolutionstheorie. Spike Jonze, Bruder im so ironischen wie cleveren Geiste, illustriert das gerne mal mit einem Videoclip: Vom Anfang der Welt bis Charlie Kaufman in einer Minute. Auf diese leicht postpubertäre Art stellt sich hier die Sinnfrage. Wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Kaufmans Drehbücher geben keine Antworten auf diese - im Grunde seines Herzens - ernst gemeinte Frage, sondern Ausflüchte und immer neue Abwege, die so durchgeknallt nur im Kontext Hollywood sind.
 An Hollywood aber arbeitet sich Kaufman ab, als gelte es sein Leben (der wahre Kaufmann, aber auch der so romantische wie lebensunfähige Künstler, als den er sein filmisches Alter Ego angelegt hat). Er kann so wenig vom Feindbild absehen - dem klar strukturierten Drehbuch nach Schema-F-Erfolgsrezepten -, dass er es hineinschreiben muss ins eigene, dass er sich hier, aber nicht im Ernst, mit Waffen, Drogen, Krokodilen am Thriller versucht. Aus diesem Kuddelmuddel, das als Dekonstruktion des Hollywoodfilms zu bezeichnen nicht einmal verkehrt ist (auch dazu natürlich ein Scherz im Film), führt kein Weg mehr hinaus, auch nicht für den Kritiker. Irgendwie steht der auch schon mit drin im Buch. Wenn er dann sagt: das überzeugt mich nicht, es bleibt zu viel Beliebigkeit, mancher Scherz ist doch vorhersehbar, ruft Charlie Kaufman: ick bün allhier. Sitzt da bei der Pressekonferenz, ein schüchterner Kerl mit Bart und ohne Haarausfall (ganz im Unterschied zum Film), und macht den Eindruck, als sei ihm all das, die Ironie, die Evolution, die Adaption, die Selbstreflexivität und die Sehnsucht nach der einen großen Leidenschaft, bitter Ernst. Der Kritiker ist auch nur Mensch: Vor "Adaptation" streckt er die Waffen.
An Hollywood aber arbeitet sich Kaufman ab, als gelte es sein Leben (der wahre Kaufmann, aber auch der so romantische wie lebensunfähige Künstler, als den er sein filmisches Alter Ego angelegt hat). Er kann so wenig vom Feindbild absehen - dem klar strukturierten Drehbuch nach Schema-F-Erfolgsrezepten -, dass er es hineinschreiben muss ins eigene, dass er sich hier, aber nicht im Ernst, mit Waffen, Drogen, Krokodilen am Thriller versucht. Aus diesem Kuddelmuddel, das als Dekonstruktion des Hollywoodfilms zu bezeichnen nicht einmal verkehrt ist (auch dazu natürlich ein Scherz im Film), führt kein Weg mehr hinaus, auch nicht für den Kritiker. Irgendwie steht der auch schon mit drin im Buch. Wenn er dann sagt: das überzeugt mich nicht, es bleibt zu viel Beliebigkeit, mancher Scherz ist doch vorhersehbar, ruft Charlie Kaufman: ick bün allhier. Sitzt da bei der Pressekonferenz, ein schüchterner Kerl mit Bart und ohne Haarausfall (ganz im Unterschied zum Film), und macht den Eindruck, als sei ihm all das, die Ironie, die Evolution, die Adaption, die Selbstreflexivität und die Sehnsucht nach der einen großen Leidenschaft, bitter Ernst. Der Kritiker ist auch nur Mensch: Vor "Adaptation" streckt er die Waffen. Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"Adaption", Spike Jonze. Mit Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton, Clara Seymour u.a., USA, Großbritannien 2002, 117 Minuten
Termine.
Drollig, aber falsch: Junji Sakamotos "Bokunchi - Mein Haus" (Panorama)
Ein heruntergewirtschaftetes Dorf auf einer gottverlassenen Insel. Zwei Jungs, allein, die wir kennenlernen, als ihre Mutter nach Jahren zurückkehrt, mit dabei eine junge Frau, die sie den Kindern als Schwester vorstellt. Rekonfiguration einer dysfunktionalen Familie, die ganze Wahrheit ist es nicht und die Mutter verschwindet sogleich wieder. Das Setting erinnert an die Kindheitsfilme von Hou Hsiao-hsien, der Ton aber so wenig wie der Blick auf diese Welt. Sakamoto nämlich nimmt das Dorf, die Kinder, die anderen Bewohner immer nur zum Anlass: statt subtilen Humors gibt es schräge Scherze und statt auf die distanzierte Beobachtung von Gefühlen setzt er auf Kindergesichter in Großaufnahme, Klaviergeklimper im Hintergrund.
 Das Episodische seines Erzählens ist nicht Verzicht auf Dramaturgie, sondern dient der Reihung von voneinander abgekoppelten Szenen, denen Skurrilität abgepresst wird. Skurril auch das Personal, das durchs Bild läuft, mehr nicht. Eine alte irre Lady mit einer Menge Katzen, bei deren Beerdigung aus dem Nichts eine Unzahl Kinder und Schwiegerkinder auftauchen und tanzen. Typisch wieder der Blick auf den Tanz: keinerlei Interesse am Ritual in seiner Seltsamkeit, nur an der Seltsamkeit, als die es dargestellt wird. Dann eine junge Frau vor dem chinesischen Restaurant, stumm, immerzu ihr Haar bearbeitend. Ein Mann mit seinen Kindern, erbärmlich in einem von einer Plastikplane notdürftig gedeckten Gewächshaus lebend, wird nur gebraucht, um für die eine oder andere Pointe ausgenutzt zu werden. Drangeklatscht ein Schmetterling: das Schöne im Ärmlichen, von einem Klischee fällt der Film ins andere.
Das Episodische seines Erzählens ist nicht Verzicht auf Dramaturgie, sondern dient der Reihung von voneinander abgekoppelten Szenen, denen Skurrilität abgepresst wird. Skurril auch das Personal, das durchs Bild läuft, mehr nicht. Eine alte irre Lady mit einer Menge Katzen, bei deren Beerdigung aus dem Nichts eine Unzahl Kinder und Schwiegerkinder auftauchen und tanzen. Typisch wieder der Blick auf den Tanz: keinerlei Interesse am Ritual in seiner Seltsamkeit, nur an der Seltsamkeit, als die es dargestellt wird. Dann eine junge Frau vor dem chinesischen Restaurant, stumm, immerzu ihr Haar bearbeitend. Ein Mann mit seinen Kindern, erbärmlich in einem von einer Plastikplane notdürftig gedeckten Gewächshaus lebend, wird nur gebraucht, um für die eine oder andere Pointe ausgenutzt zu werden. Drangeklatscht ein Schmetterling: das Schöne im Ärmlichen, von einem Klischee fällt der Film ins andere.  Erzählen will Bokunchi eigentlich von Beziehungen: Zwischen Itta, dem größeren Jungen, und dem Kleinkriminellen, dem er sich andient. Zwischen Nita und seiner Schwester, die ihr Geld im Bordell verdient hat und wieder verdient. Und zwischen Mutter und Tochter, die am Ende zueinander finden, indem sie die beiden Jungs aufgeben. Das alles bleibt bloße Behauptung, weil der Film selbst beziehungsunfähig ist. Er giert nach Pointen und verschenkt an sie seine Figuren. Alle Gefühle sind so aus zweiter Hand, abgepresst der abgedroschenen filmsprachlichen Grammatik, dem abgeschmacktesten Zueinander von Bild und Ton. Sakamoto strebt, scheint es, nach dem Bittersüßen der Filme Kaurismäkis, ohne im mindesten zu verstehen, dass die Poesie und die Pointen sich aus der Liebe und der Genauigkeit ergeben, mit denen Kaurismäki die Menschen beobachtet und ihre Welt. In Bokunchi regiert von Anfang an die Drolligkeit. Das ist ein Problem der Form im engsten Sinne. Die Bilder, die Gefühle, die Figuren, alles ist hier falsch.
Erzählen will Bokunchi eigentlich von Beziehungen: Zwischen Itta, dem größeren Jungen, und dem Kleinkriminellen, dem er sich andient. Zwischen Nita und seiner Schwester, die ihr Geld im Bordell verdient hat und wieder verdient. Und zwischen Mutter und Tochter, die am Ende zueinander finden, indem sie die beiden Jungs aufgeben. Das alles bleibt bloße Behauptung, weil der Film selbst beziehungsunfähig ist. Er giert nach Pointen und verschenkt an sie seine Figuren. Alle Gefühle sind so aus zweiter Hand, abgepresst der abgedroschenen filmsprachlichen Grammatik, dem abgeschmacktesten Zueinander von Bild und Ton. Sakamoto strebt, scheint es, nach dem Bittersüßen der Filme Kaurismäkis, ohne im mindesten zu verstehen, dass die Poesie und die Pointen sich aus der Liebe und der Genauigkeit ergeben, mit denen Kaurismäki die Menschen beobachtet und ihre Welt. In Bokunchi regiert von Anfang an die Drolligkeit. Das ist ein Problem der Form im engsten Sinne. Die Bilder, die Gefühle, die Figuren, alles ist hier falsch. Ekkehard Knörer (Jump Cut)
"Bokunchi - Mein Haus", Junji Sakamoto. Mit Alisa Mizuki, Yuma Yamoto, Yuki Tanaka, Claude Maki, Ran Ohtori u.a., Japan 2002, 116 Minuten
Termine.