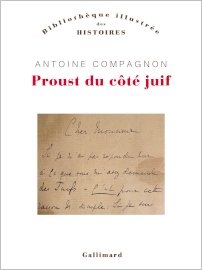
Der Judentum ist ein wichtiges Thema in
Prousts "Recherche", und dennoch hat es etwas Irrlichterndes. Proust selbst war Sohn einer Jüdin, also im traditionellen Sinne jüdisch, aber sein Vater, der Arzt Adrien Proust, war Katholik und hat ihn
katholisch erzogen. Diese Zwiespältigkeit charakterisiert auch sein Schreiben. Einerseits gibt es einige Nebenfiguren, die als antisemitisch gelesen werden, andererseits war Proust ein
leidenschaftlicher Dreyfusard, und die Dreyfus-Affäre spielt in der "Recherche" eine große Rolle. Das Thema "Proust und das Judentum" ist auch
en vogue in der Literaturwissenschaft. In Deutschland setzt sich
Andreas Isenschmid in einem
neuen Buch damit auseinander. In Frankreich gibt es zwei Neuerscheinungen, die stark auf der immensen Korrespondenz Prousts (41 Bände) basieren,
Antoine Compagnons "Proust du côté juif" und
Pierre Birnbaums "Marcel Proust - L'adieu au monde juif". Während Compagnon sich vor allem mit der französisch-jüdischen Rezeption befasst und Benjamin Crémieux' schöne Beobachtung von den "Juden, die aus Proust einen Nicht-Juden und den Nicht-Juden, die aus Proust einen Juden machen wollen" zitiert, geht Birnbaum mehr auf Prousts eigenes Verhältnis zur Frage ein. "Birnbaum spürt
die gleiche Ambivalenz in Prousts Korrespondenz mit seinen
antisemitischen Freunden auf, die 'zwischen Bewunderung und Ablehnung' schwankt. 'Es ist eine Tatsache', schreibt er, 'dass Proust vor Zärtlichkeit und Rücksichtnahme gegenüber antisemitischen Pamphletisten zerfließt, die sich selbst als seine treuen Freunde bezeichnen':
Charles Maurras, Chef der Action française,
Maurice Barrès, 'Prinz der Nationalisten',
Léon Daudet, 'einer der schärfsten Gegner von Hauptmann Dreyfus', und viele andere, die heute weniger bekannt sind. Zwar blieb Proust auf Distanz und nahm während der Dreyfus-Affäre keinen Kontakt zu ihnen auf, doch nach 1906, als Dreyfus vom Kassationsgericht rehabilitiert wurde, nahm ihr lobhudlerischer Briefwechsel wieder 'Fahrt auf'. Man muss zugeben, dass diese Briefe den heutigen Leser
in Erstaunen versetzen."
Tiphaine Samoyault
gibt außerdem einen Überblick über französische Neuerscheinungen zu Prousts
hundertstem Todestag.
Die
Ecole Normale Supérieure genießt als Ausbildungsstätte der intellektuellen Elite Frankreichs einen mythischen Ruf. Nur das beste Prozent der Abiturienten darf sich bewerben und wird in zwei Jahren gnadenloser Vorbereitungsklasse weiter gesiebt - dann darf man die Schule erst besuchen. Althusser lehrte dort, Foucault lernte dort. Aber sie ist keine Uni, und der Philosoph
Bernard Pautrat beschreibt sich im Gespräch mit Marc Lebiez als Außenseiter in der Spinoza-Forschung, weil er eben nicht an der Uni lehrt. Statt dessen bereitete er seine Spinoza-Neuübersetzung, die jetzt in der ebenso mythischen "Pléiade"
herauskommt, in einem
22-jährigen Seminar an der ENS vor. Auch die "
Ethik" hat er neu übersetzt: "Nur wenige haben sie tatsächlich gelesen, vor allem als Ethik, was die Leute nicht daran hindert, wie ich es oft gehört habe, zu sagen: '
Ach,
ich liebe Spinoza!', obwohl man nur ein paar Seiten überflogen hat. Natürlich ist es keine bequeme Lektüre, aber man wird nichts erreichen, wenn man sich nicht die Mühe macht, die
gesamte 'Ethik' zu lesen, indem man für sich selbst
alle Beweisführungen noch einmal durchführt. Dass man zwanzig Jahre braucht, um zu verstehen, dass man zwanzig Jahre braucht, um sie zu verstehen? Nun, sei's drum."