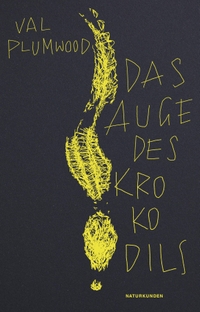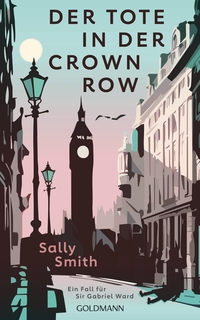Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 5. Tag
Von Thekla Dannenberg, Ekkehard Knörer, Christoph Mayerl
13.02.2006. Matthias Glasner will, dass wir in "Der freie Wille" einen Vergewaltiger mit den Augen einer Liebenden sehen. Nach Franka Potentes erstem Stummfilm ist man nicht böse auf die Regisseurin. Warten mit Ruben - in Rodrigo Morenos Wettbewerbsfilm "Der Schatten" Allan King nimmt uns in "Memory for Max, Claire, Ida and Company" mit in ein Altersheim. Robert Altman liefert mit seinem Wettbewerbsfilm "A Prairie Home Companion" gediegene Abendunterhaltung. Chen Kaiges "The Promise" ist schnell, bunt und dünn. Thomas Arslan zeigt uns "Aus der Ferne" die Türkei.Eine Liste aller besprochenen Berlinalefilme finden Sie hier. Liebt einen Vergewaltiger. Matthias Glasners "Der freie Wille" (Wettbewerb)
 Wie zeigt man eine Vergewaltigung? Wie einen Vergewaltiger? Matthias Glasner hat, sagt er in der Pressekonferenz, sechs Jahre über diese Frage nachgedacht. Er hatte ein Konzept zu Drehbeginn und dann habe er, am Drehort, die Kamera (er führte sie selbst) in der Hand, dieses Konzept über den Haufen geworfen. Was man nun sieht, ist natürlich zu viel und es ist kaum zu ertragen. Theo Stoer (Jürgen Vogel) fällt über ein Mädchen her und die Kamera nötigt uns durch ihr Dabeisein, dabei zu sein. Die Perspektive ist nicht die des Vergewaltigers, erst recht nicht die des Opfers, es ist die eines Zeugen, der nicht wegsehen kann.
Wie zeigt man eine Vergewaltigung? Wie einen Vergewaltiger? Matthias Glasner hat, sagt er in der Pressekonferenz, sechs Jahre über diese Frage nachgedacht. Er hatte ein Konzept zu Drehbeginn und dann habe er, am Drehort, die Kamera (er führte sie selbst) in der Hand, dieses Konzept über den Haufen geworfen. Was man nun sieht, ist natürlich zu viel und es ist kaum zu ertragen. Theo Stoer (Jürgen Vogel) fällt über ein Mädchen her und die Kamera nötigt uns durch ihr Dabeisein, dabei zu sein. Die Perspektive ist nicht die des Vergewaltigers, erst recht nicht die des Opfers, es ist die eines Zeugen, der nicht wegsehen kann.
Matthias Glasner hat sich entschlossen, diese Geschichte zu erzählen, und zwar ohne Kompromiss. Es ist die Geschichte eines Mannes, der Unverzeihliches tut und nichts dringlicher wünscht, als es nie wieder zu tun. Er kommt nach neun Jahren frei, darf zurück in die Welt. Es ist, wie immer in solchen Fällen, eine Wette auf die Erlösbarkeit eines Täters, dem zu verzeihen man niemals geneigt ist.
 Und doch lernt man, indem man ihm zurück in die Welt folgt, mit ihm zu hoffen. Er lernt eine junge Frau kennen, die erst widerstrebt. Wir sehen sie erst mit seinen Augen, aber diese Perspektive wechselt. Zu den Zumutungen von "Der freie Wille" gehört vor allem das: Wir sollen den Vergewaltiger mit den Augen einer Liebenden sehen. Und zu den Stärken des Films muss man zählen: Er manipuliert einen nicht, er verzichtet auf erschlichene Wirkungen, zum Beispiel durch den Einsatz von Musik. (Es gibt, an zentraler Stelle, Musik - aber dabei geht es nicht um Erschleichung von Gefühlen, sondern um das vom Geschehen zwischen den Figuren gedeckte Pathos einer Hoffnung.)
Und doch lernt man, indem man ihm zurück in die Welt folgt, mit ihm zu hoffen. Er lernt eine junge Frau kennen, die erst widerstrebt. Wir sehen sie erst mit seinen Augen, aber diese Perspektive wechselt. Zu den Zumutungen von "Der freie Wille" gehört vor allem das: Wir sollen den Vergewaltiger mit den Augen einer Liebenden sehen. Und zu den Stärken des Films muss man zählen: Er manipuliert einen nicht, er verzichtet auf erschlichene Wirkungen, zum Beispiel durch den Einsatz von Musik. (Es gibt, an zentraler Stelle, Musik - aber dabei geht es nicht um Erschleichung von Gefühlen, sondern um das vom Geschehen zwischen den Figuren gedeckte Pathos einer Hoffnung.)
 Matthias Glasner hat seine Mittel für diesen Film weitestmöglich reduziert. Mit winzigem Team sucht er als Kameramann die Nähe zu den Darstellern. Auch sie suchen niemals den einfachen Weg. Niemals zuvor hat man Jürgen Vogel so zurückgenommen gesehen, so sehr gefangen in seinem Körper, so subtil in seinen Gesten. Sabine Timoteo als Netti, die Frau, die ihn liebt, versteht es wie keine andere Schauspielerin im deutschen Film, das Gefühlte in huschenden Ausdrücken anzudeuten, ohne es auszuspielen. Ein Lächeln, das kurz auftaucht und wieder verschwindet. Und noch im Zusammenbruch spürt man keine Distanz zwischen einer Technik und dem, was sie zeigt.
Matthias Glasner hat seine Mittel für diesen Film weitestmöglich reduziert. Mit winzigem Team sucht er als Kameramann die Nähe zu den Darstellern. Auch sie suchen niemals den einfachen Weg. Niemals zuvor hat man Jürgen Vogel so zurückgenommen gesehen, so sehr gefangen in seinem Körper, so subtil in seinen Gesten. Sabine Timoteo als Netti, die Frau, die ihn liebt, versteht es wie keine andere Schauspielerin im deutschen Film, das Gefühlte in huschenden Ausdrücken anzudeuten, ohne es auszuspielen. Ein Lächeln, das kurz auftaucht und wieder verschwindet. Und noch im Zusammenbruch spürt man keine Distanz zwischen einer Technik und dem, was sie zeigt.
Obgleich Matthias Glasner in keine der Fallen, die bereit liegen, tappt - über die eine oder andere dramaturgische Entscheidung, über den Einsatz des einen oder anderen religiösen Motivs kann man streiten -, ist "Der freie Wille" doch kein ganz großer Film. Es bleibt bis zuletzt das Gefühl eines Überschusses des Inhalts über die Form. Das Problem ist nicht, dass er seine Erzählung nicht bändigt. Aber es gelingt ihm nicht, für das Moment der Nicht-Erzählbarkeit einer solchen Geschichte Mittel zu finden, die das Konzept von Direktheit und Reduktion noch einmal reflektierend übersteigen.
Ekkehard Knörer
"Der freie Wille". Regie: Matthias Glasner. Mit Jürgen Vogel, Sabine Timoteo, Andre Hennicke u.a., Deutschland, 2006, 163 Minuten (Wettbewerb)
Selbstfindung: Franka Potentes erster Film als Regisseurin, "Der die Tollkirsche ausgräbt" (Perspektive Deutsches Kino)
Franka Potente ist wohl schon länger mit dem Gedanken schwanger gegangen, einen Film zu drehen. In ihr erstes Werk sollte alles rein, was sie mag. Franka Potente mag Stummfilme, bürgerliche Familien, Slapstick, Magie und fußbetriebene Poklapsmaschinen. Soweit so gut. Leider hat sie auch ein Faible für Punks. Ein Exemplar liegt plötzlich im Garten einer vorbildlich wilhelminischen Familie. Im Gegensatz zu allen anderen Beteiligten (Stummfilm!) kann er sprechen. Die Idee klingt zunächst gut, hakt aber nach wenigen Einstellungen. Das liegt auch an Christoph Bach, der als Punk weder bei der Familie noch im Film jemals ankommt.
 Der Lederjackenträger, der immer wirkt, als würde er sich für seinen letzten Satz schämen, sollte wohl als revolutionäres Symbol mit der konservativ sprachlosen Familie kontrastieren. Leider gibt es mittlerweile nichts Konservativeres als den schon längst durchkommerzialisierten Punk, dessen hiesiger Vertreter noch dazu wie ein künftiger Bausparer in der Selbstfindungsphase aussieht.
Der Lederjackenträger, der immer wirkt, als würde er sich für seinen letzten Satz schämen, sollte wohl als revolutionäres Symbol mit der konservativ sprachlosen Familie kontrastieren. Leider gibt es mittlerweile nichts Konservativeres als den schon längst durchkommerzialisierten Punk, dessen hiesiger Vertreter noch dazu wie ein künftiger Bausparer in der Selbstfindungsphase aussieht.
Was Franka Potente hier für 40 Minuten anrichtet, ist inhaltlich überladen und stilistisch kaum aufeinander abgestimmt. Als Fingerübung in diversen Genres war das sicher lehrreich für die angehende Regisseurin Potente, doch dem Zuschauer vergeht bei dem disparaten Mischmasch der Appetit. Bis der evolutionär überlegene Punk des 21. Jahrhunderts dem Bürger von 1918 schließlich die Braut ausspannt, werden noch die angekündigten Tollkirschen ausgegraben, Elixiere gebraut, Hunde vom Erdboden verschluckt und sehr, sehr viele Grimassen geschnitten.
Wenn das Licht im Kinosaal angeht, ist man trotzdem nicht wirklich böse. Weder auf die Filmemacherin Potente, deren nächster, etwas konzentrierterer Arbeit man entgegensieht, noch darauf, dass die Regisseurin in spe es zunächst einmal bei einem Kurzfilm belassen hat.
Christoph Mayerl
"Der die Tollkirsche ausgräbt". Regie: Franka Potente. Mit Emilia Sparagna, Christoph Bach, Justus von Dohnanyi. Deutschland 2005, 40 Minuten (Perspektive Deutsches Kino)
Warten mit Ruben: Rodrigo Morenos "El custodio - Der Schatten" (Wettbewerb)
Tür auf. Tür zu. Anfangs hat das laute Türknallen noch geholfen, doch bald hat die große Dame in der Reihe vor mir der Müdigkeit nachgegeben und ist unaufhaltsam zur Seite gesunken. So konnte man endlich die Untertitel richtig lesen. Das wiederum hat eigentlich nicht gestört. Denn Rodrigo Morenos erster Spielfilm, der eher eine Studie über Identität und das Außer-sich-Sein ist, kommt auch gut ohne Dialoge auskommen. Ruben spricht nicht viel.
 Ruben ist Leibwächter des argentinischen Planungsministers, er folgt ihm überall hin, ins Büro, ins Abgeordnetenhaus, zum Wochenendausflug auf die Finca und zur Geliebten. Selbst die Toilette überprüft Rubens, bevor sein Schützling sie benutzt. Rubens nimmt nicht am Leben des Ministers teil, er beobachtet es nur. Meistens wartet er in den Gängen oder Hallen vor verschlossenen Türen, wie ausgeschaltet, um dann wieder anzuspringen, wenn die Tür sich öffnet. Die Kamera berichtet den ganzen Film über aus der Perspektive von Rubens und überträgt so die Monotonie seiner Tätigkeit maßstabsgetreu auf das Kino. In der Zurückhaltung der Kamera liegt aber keine Ruhe, man sieht es am Gesicht des Protagonisten, der angespannt wirkt, hastig an seiner Zigarette zieht, nie die Schultern hängen oder die müden Augen kurz zufallen lässt.
Ruben ist Leibwächter des argentinischen Planungsministers, er folgt ihm überall hin, ins Büro, ins Abgeordnetenhaus, zum Wochenendausflug auf die Finca und zur Geliebten. Selbst die Toilette überprüft Rubens, bevor sein Schützling sie benutzt. Rubens nimmt nicht am Leben des Ministers teil, er beobachtet es nur. Meistens wartet er in den Gängen oder Hallen vor verschlossenen Türen, wie ausgeschaltet, um dann wieder anzuspringen, wenn die Tür sich öffnet. Die Kamera berichtet den ganzen Film über aus der Perspektive von Rubens und überträgt so die Monotonie seiner Tätigkeit maßstabsgetreu auf das Kino. In der Zurückhaltung der Kamera liegt aber keine Ruhe, man sieht es am Gesicht des Protagonisten, der angespannt wirkt, hastig an seiner Zigarette zieht, nie die Schultern hängen oder die müden Augen kurz zufallen lässt.
Ruben ist immer im Job, privat erwartet ihn nicht viel, eine verwirrte Mutter, mit der er nichts anfangen kann, oder billige Prostituierte, zu denen er eher widerwillig geht. Sein Privatleben ist uninteressant, und der Job verlangt eine vollständige Unterwerfung unter das Leben des Ministers, im Ernstfall sogar die Selbstaufgabe. Auf diese Selbstaufgabe treibt Ruben hin. Er droht tatsächlich zum "Schatten" des Ministers zu werden, dem er folgen muss, ohne je er zu sein. Seine eigenen Bedürfnisse kann er schon lange nicht mehr erfüllen, ja er droht sie selbst nicht mehr zu kennen.
Rodrigo Moreno stellt diese Entleibung, diese zunehmende Entäußerung Rubens mit monotonen, sich oft wiederholenden Abläufen aus dem Leben eines Leibwächters inhaltlich und auch ästhetisch sehr konsequent dar. Moreno ist streng mit sich und mit dem Publikum. Ruben wartet, und die Kamera wartet getreu mit ihm, lenkt den Blick lange auf kleine Gegenstände, starrt auf das vorausfahrende Auto oder auf den Rücken des Ministers. Das ist atmosphärisch gelungen, aber eben auch recht monoton. Die müde Dame ist übrigens nicht mehr aufgewacht. Auch nicht beim letzten Geräusch, als Ruben nach seiner Selbstbefreiung an den Strand fährt. Tür auf.
Christoph Mayerl
"El custodio - Der Schatten". Regie: Rodrigo Moreno. Mit Julio Chavez, Osmar Nunez, Elvira Onetto. Argentinien/Deutschland/Frankreich (Wettbewerb)
Allan Kings "Memory for Max, Claire, Ida and Company" (Forum)
 Max ist ein schmaler Mann mit Stock. Mit Trippelschritten geht er im Gang auf und ab. Er singt viel, er liebt Claire, auch wenn beide vieles vergessen haben aus ihrem Leben, sie liebt ihn. An ihrem Geburtstag drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Einmal sehen wir Max noch im Gang, fast sieht er ein wenig aus wie der frühe Chaplin, die Füße gespreizt, ein kleiner Mann mit Stock, die Kamera blickt aus ein wenig Distanz.
Max ist ein schmaler Mann mit Stock. Mit Trippelschritten geht er im Gang auf und ab. Er singt viel, er liebt Claire, auch wenn beide vieles vergessen haben aus ihrem Leben, sie liebt ihn. An ihrem Geburtstag drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Einmal sehen wir Max noch im Gang, fast sieht er ein wenig aus wie der frühe Chaplin, die Füße gespreizt, ein kleiner Mann mit Stock, die Kamera blickt aus ein wenig Distanz.
Wenig später erfahren wir: Max ist tot. Er ist gestürzt und am selben Tag noch im Krankenhaus gestorben. Seine Mitbewohner im Baycrest Seniorenheim werden in einer kleinen Runde versammelt, man erzählt ihnen von seinem Tod. Claire ist schwer getroffen, sie bricht in Tränen aus. Und doch wird sie es vergessen. Wieder und wieder wird man ihr vom Tod des geliebten Mannes erzählen, wieder und wieder wird sie es vergessen. Jedes Mal erneut erfährt sie den Schock, weint, trauert.
Später erfahren wir, dass auch ihr Ehemann Max hieß. Sie verwechselt, scheint es, die beiden, sie erinnert sich an den einen Max und kaum an den anderen, oder sie sind zu einer Person verschmolzen. Den alten Leuten von Baycrest ist ihr Leben zerfallen, sie haben Alzheimer oder sind dement. Manche wissen es, manche ahnen es, oder manchmal ahnen sie es. Max, der viel sang, schien in seiner Ahnungslosigkeit glücklich. Eine scheint untröstlich, dann sagt sie, sie will nur noch sterben, und später lacht sie und sagt, sie fühle sich sehr jung.
Allan King hat zuletzt in "Dying Grace" (2003), auch auf der Berlinale zu sehen, Todkranke in einer Palliativklinik beobachtet. Sterbende sind auch die Heldinnen und Helden in diesem Film. Halb ist ihnen mit der Erinnerung ihr eigenes Leben schon entglitten. Eine von ihnen, wird ihre Tochter sagen, die sie nicht mehr erkennt, ist nicht mehr die, die sie war. Sie war freundlich und intelligent. Jetzt tritt sie nach denen, die ihr helfen wollen. Eine andere sitzt auf dem Bett, auf dem Stuhl sitzt ihr sarkastischer Sohn, gemeinsam rekonstruieren sie Episoden ihres Lebens. Sie erinnert sich an lange Zurückliegendes, an anderes nicht. Ratlos sitzt man herum, denn das Ausgegrabene wird wieder verschwinden in einem Vergessen, das ganze Leben mit sich reißt.
Human ist "Memory for Max, Claire, Ida and Company" in seiner Unaufdringlichkeit. Der Film schweigt nicht davon, wie schwer erträglich das alles ist. Er hat eine Haltung zu dem, was man sieht; oft sieht man die Alten im Gespräch mit Beverly Zwaigen, einer Betreuerin. Die Kamera ist dabei, in der Nähe, sie versteckt sich nicht, sie hört zu. Manchmal reagieren die Gefilmten auf sie, ein paar dieser Szenen zeigt auch der Film. Mehr als Dabeisein ist seine Sache nicht. Musik gibt es nur zu Beginn und am Ende. Kein Voiceover-Kommentar. Der Film macht, dass wir ganz Auge und Ohr sind und Verbündete der Sterbenden. Wir trauern mit ihnen um das, was sie waren.
Ekkehard Knörer
"Memory for Max, Claire, Ida and Company". Regie: Allan King. Dokumentarfilm. Kanada 2005. 112 Minuten (Forum)
Gediegene Unterhaltung: Robert Altmans "A Prairie Home Companion" (Wettbewerb)
 Meryl Streep jault. Sie jault wie ein Kojote, und schon geht sie los, die Show. Oder sind es nur die Vorbereitungen? Man weiß nicht, woran man ist in diesem Film. "A Prairie Home Companion" gibt es wirklich, seit dreißig Jahren ist sie eine erfolgreiche Show im amerikanischen Radio. Ihr Erfinder Garrison Keillor hat das Drehbuch zum Film geschrieben, hat nur die Ereignisse rund um die Bühne dazu erfunden und auch die meisten seiner für die Show geschaffenen Figuren untergebracht. Viele aus Keillors Originalbesetzung spielen sich selbst vor der Kamera, andere Rollen, wie die des Privatdetektivs Guy Noir oder die der singenden Country-Schwestern, übernehmen Kevin Kline, Meryl Streep und Lily Tomlin. Keillors Crew und Altmans Ensemble arbeiten nahtlos zusammen. Schließlich machen ja alle Theater.
Meryl Streep jault. Sie jault wie ein Kojote, und schon geht sie los, die Show. Oder sind es nur die Vorbereitungen? Man weiß nicht, woran man ist in diesem Film. "A Prairie Home Companion" gibt es wirklich, seit dreißig Jahren ist sie eine erfolgreiche Show im amerikanischen Radio. Ihr Erfinder Garrison Keillor hat das Drehbuch zum Film geschrieben, hat nur die Ereignisse rund um die Bühne dazu erfunden und auch die meisten seiner für die Show geschaffenen Figuren untergebracht. Viele aus Keillors Originalbesetzung spielen sich selbst vor der Kamera, andere Rollen, wie die des Privatdetektivs Guy Noir oder die der singenden Country-Schwestern, übernehmen Kevin Kline, Meryl Streep und Lily Tomlin. Keillors Crew und Altmans Ensemble arbeiten nahtlos zusammen. Schließlich machen ja alle Theater.
Robert Altmans Film behandelt im Großen und Ganzen eine besondere Folge der Show. Es soll die letzte sein, wie nach und nach klar wird. In Echtzeit verfolgen wir alles, vom ersten Vorhang bis zum letzten. Die gesamte Handlung spielt sich im Inneren des World Theaters in der Kleinstadt St. Paul ab. Es ist, als hätte man eine Eintrittskarte gelöst und würde tatsächlich auf den antiquierten Theatersesseln sitzen, die sich von Kinosesseln ja nicht wesentlich unterscheiden. Irgendwann fragt man sich, warum man nicht einfach eine Eintrittskarte für die Show gelöst hat. Alles muss bei der wöchentlichen Aufzeichnung ähnlich ablaufen, die gesungenen Werbespots, die politisch unkorrekten Witze, die Lieder vom Landleben und Jugendlieben. Oder anders gesagt: Wo ist Altman? Ist er in Kevin Kline, der trottelig hinter der Bühne ermittelt und einen Engel sieht, oder ist er in Lindsay Lohan, die ihre singende Mutter Meryl Streep mit Selbstmordgedichten nur vorübergehend beunruhigen kann?
Damit kein Missverständnis entsteht: Es ist angenehm, in dieser Show zu sein. Eine große Familie, die ihren Gästen gediegene Abendunterhaltung bietet. Ein sehr edles "Wetten dass", wenn man so will, mit einem Moderator, der eine Mischung aus Max Raabe und Wim Thoelke ist. Harmlose Unterhaltung. Leider jault Meryl Streep kein zweites Mal.
Christoph Mayerl
"A Prairie Home Companion". Regie: Robert Altman. Mit Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Meryl Streep, Lily Tomlin, Kevin Kline u.a., USA 2006, 100 Minuten (Wettbewerb)
Schnell, bunt, dünn: Chen Kaiges "The Promise" (Wettbewerb, außer Konkurrenz)
 Chen Kaige geht mit Chinas angeblich teuerster Filmproduktion aller Zeiten in den Wettbewerb. Verglichen mit dem Geld, das Hollywoods Regisseure zur Verfügung haben, sind die 30 Millionen Dollar zwar ein Klacks, trotzdem verströmt der Film den unbedingten Willen zum Blockbuster. Schon die Besetzung ist international, in den Hauptrollen finden sich die Stars des asiatischen Kinos: Aus Hongkong Cecilia Cheung, aus Japan Hiroyuki Sanada und aus Korea Jang Dung-Kun.
Chen Kaige geht mit Chinas angeblich teuerster Filmproduktion aller Zeiten in den Wettbewerb. Verglichen mit dem Geld, das Hollywoods Regisseure zur Verfügung haben, sind die 30 Millionen Dollar zwar ein Klacks, trotzdem verströmt der Film den unbedingten Willen zum Blockbuster. Schon die Besetzung ist international, in den Hauptrollen finden sich die Stars des asiatischen Kinos: Aus Hongkong Cecilia Cheung, aus Japan Hiroyuki Sanada und aus Korea Jang Dung-Kun.
Die Bilder erschlagen einen: Purpurne Armeen preschen durch gewaltige Landschaften und über violette Blumenfelder, zartrosa Mandelblüten regnen vom azurblauen Himmel, die Gewänder wallen in allen Farben des Regenbogens, es ist eine einzige Pracht. Mit Spezialeffekten wird nicht gegeizt, die Martial-Arts-Szenen haben die Rasanz eines Comics.
 Die Geschichte allerdings ist schrecklich dünn: In einem fernen Reich vor unserer Zeit streift ein kleines Mädchen um die Leichen auf einem Schlachtfeld. Sie sucht etwas zu Essen und ein Paar Stiefel. Ein Junge nimmt sie gefangen und lässt sie nur gegen das Versprechen frei, dass sie seine Sklavin wird. Doch das Mädchen hält sich nicht dran und läuft weg. Nun stößt sie auf eine Fee, die ihr ein Leben voller Reichtümer und Macht verspricht - zu dem Preis, dass jeder Mann, den sie liebt, sterben wird. Das Mädchen willigt ein.
Die Geschichte allerdings ist schrecklich dünn: In einem fernen Reich vor unserer Zeit streift ein kleines Mädchen um die Leichen auf einem Schlachtfeld. Sie sucht etwas zu Essen und ein Paar Stiefel. Ein Junge nimmt sie gefangen und lässt sie nur gegen das Versprechen frei, dass sie seine Sklavin wird. Doch das Mädchen hält sich nicht dran und läuft weg. Nun stößt sie auf eine Fee, die ihr ein Leben voller Reichtümer und Macht verspricht - zu dem Preis, dass jeder Mann, den sie liebt, sterben wird. Das Mädchen willigt ein.
Zwanzig Jahre später ist sie tatsächlich die Geliebte des Königs, der von den Soldaten des Fürsten aus dem Norden, Wuhuan belagert wird. Der General Guangming schickt seinen Sklaven Kunlun zu Hilfe. Der jedoch tötet den König, und die schöne Prinzessin verliebt sich in ihn in dem Glauben, es sei der General. Aber wer muss jetzt sterben: Der General oder sein Sklave?
Wie man überall liest, haben die Produzenten, die Brüder Weinstein, den fertigen Film umgeschnitten. Wer auch immer für den Schluss verantwortlich ist: Er verdirbt einem den Spaß an dem Film.
Thekla Dannenberg
"Wu ji - The Promise". Regie: Chen Kaige. Mit Cecilia Cheung, Hiroyuki Sanada, Jang Dung-Kun und anderen. China 2005, 103 Minuten (Wettbewerb)
Thomas Arslans Dokumentarfilm "Aus der Ferne" (Forum)
 Ein wahrer Dokumentarfilm ist eine Grunde tautologische Sache: Man sieht, was man sieht, so wie es gezeigt wird. Das ist, im besten Fall, kein Mangel, sondern gerade der Reichtum einer Dokumentation. Es ist und wird und bleibt eine Sache des "Da Seins", mit allen Komplexitäten, die in dieser Wendung stecken. Und da das eine Sache des Zeigens und nicht des Erzählens ist, bedarf sie nicht vieler Worte. Thomas Arslans "Aus der Ferne" ist ein großartiger Dokumentarfilm, der uns etwas zu sehen gibt, indem er unserem Blick Richtungen gibt, aber keine Vorschriften macht. Was die Kamera registriert, gibt sie uns, "Aus der Ferne" so nah, auf dass wir es sehen.
Ein wahrer Dokumentarfilm ist eine Grunde tautologische Sache: Man sieht, was man sieht, so wie es gezeigt wird. Das ist, im besten Fall, kein Mangel, sondern gerade der Reichtum einer Dokumentation. Es ist und wird und bleibt eine Sache des "Da Seins", mit allen Komplexitäten, die in dieser Wendung stecken. Und da das eine Sache des Zeigens und nicht des Erzählens ist, bedarf sie nicht vieler Worte. Thomas Arslans "Aus der Ferne" ist ein großartiger Dokumentarfilm, der uns etwas zu sehen gibt, indem er unserem Blick Richtungen gibt, aber keine Vorschriften macht. Was die Kamera registriert, gibt sie uns, "Aus der Ferne" so nah, auf dass wir es sehen.
Thomas Arslan gehört zu einer Gruppe von deutschen Filmemachern - unter ihnen auch Angela Schanelec und Christian Petzold -, die von der Kritik als "Berliner Schule" bezeichnet wurden. Was sie gemeinsam haben, ist ein ungewöhnliches Maß an ästhetischer Reflexion. Das spürt man - als Abwesenheit von Klischees und Dummheit - in jedem Bild dieses Films, der in Istanbul beginnt und sich dann in die östlichsten Gegenden der Türkei bewegt. Es gibt ein bezeichnendes Bild, das wiederholt auftaucht, bei jedem wichtigen Schritt auf dieser Reise. Es ist eine Einstellung, aus Zimmern ins Freie gefilmt. Was man sieht in diesen Einstellungen, ist ein offenes Fenster und ein Blick, aber auch der Rahmen des Fensters, den es braucht, damit das "Da" zum Kinobild wird. Ein wahrer Dokumentarfilm ist ein Fenster zur Welt, das nie verleugnet, dass es kein Bild gibt ohne Rahmen und ohne Verfahren des Rahmens. Die Stimme des Regisseurs fügt diesen Einstellungen nur die Fakten hinzu und die Position des Erzählers.
 Thomas Arslan ist in der Türkei geboren und zur Grundschule gegangen. Er kam nach Deutschland, als sein Vater die Heimat verließ - eine Heimat, in die Arslan zwanzig Jahre lang nicht zurückgekehrt war. So viel erfahren wir über ihn. Die Türkei ist das Land seiner Kindheit und das könnte erklären, warum er vorzugsweise Kinder zeigt in seinem Film. Kinder, die versunken sind in Spiele und Handlungen, aber auch Kinder bei der Arbeit und Kinder im spielerischen Umgang mit der Gegenwart der Kamera, die so deren Abwesenheit spürbar machen, die Abwesenheit dessen, was uns zeigt, was da ist.
Thomas Arslan ist in der Türkei geboren und zur Grundschule gegangen. Er kam nach Deutschland, als sein Vater die Heimat verließ - eine Heimat, in die Arslan zwanzig Jahre lang nicht zurückgekehrt war. So viel erfahren wir über ihn. Die Türkei ist das Land seiner Kindheit und das könnte erklären, warum er vorzugsweise Kinder zeigt in seinem Film. Kinder, die versunken sind in Spiele und Handlungen, aber auch Kinder bei der Arbeit und Kinder im spielerischen Umgang mit der Gegenwart der Kamera, die so deren Abwesenheit spürbar machen, die Abwesenheit dessen, was uns zeigt, was da ist.
Arslans Kamera bewegt sich nicht viel. Sie folgt der Bewegung Richtung Osten, indem sie die Straßen filmt und die Landschaften auf dem Weg. Und ein paar Mal eröffnet sie Plätze in Städten und Räume mit wundervollen Schwenks, die dem Zuschauer einen Eindruck vermitteln nicht nur der Offenheit für das "Da Sein" der Welt, aber auch für die Kraft der Dokumentation, dieses "Da" sichtbar zu machen - in den Grenzen, versteht sich, des tautologisch Möglichen.
Ekkehard Knörer
"Aus der Ferne". Regie: Thomas Arslan. Dokumentarfilm. Deutschland, 2006, 89 Minuten. (Forum)
 Wie zeigt man eine Vergewaltigung? Wie einen Vergewaltiger? Matthias Glasner hat, sagt er in der Pressekonferenz, sechs Jahre über diese Frage nachgedacht. Er hatte ein Konzept zu Drehbeginn und dann habe er, am Drehort, die Kamera (er führte sie selbst) in der Hand, dieses Konzept über den Haufen geworfen. Was man nun sieht, ist natürlich zu viel und es ist kaum zu ertragen. Theo Stoer (Jürgen Vogel) fällt über ein Mädchen her und die Kamera nötigt uns durch ihr Dabeisein, dabei zu sein. Die Perspektive ist nicht die des Vergewaltigers, erst recht nicht die des Opfers, es ist die eines Zeugen, der nicht wegsehen kann.
Wie zeigt man eine Vergewaltigung? Wie einen Vergewaltiger? Matthias Glasner hat, sagt er in der Pressekonferenz, sechs Jahre über diese Frage nachgedacht. Er hatte ein Konzept zu Drehbeginn und dann habe er, am Drehort, die Kamera (er führte sie selbst) in der Hand, dieses Konzept über den Haufen geworfen. Was man nun sieht, ist natürlich zu viel und es ist kaum zu ertragen. Theo Stoer (Jürgen Vogel) fällt über ein Mädchen her und die Kamera nötigt uns durch ihr Dabeisein, dabei zu sein. Die Perspektive ist nicht die des Vergewaltigers, erst recht nicht die des Opfers, es ist die eines Zeugen, der nicht wegsehen kann.Matthias Glasner hat sich entschlossen, diese Geschichte zu erzählen, und zwar ohne Kompromiss. Es ist die Geschichte eines Mannes, der Unverzeihliches tut und nichts dringlicher wünscht, als es nie wieder zu tun. Er kommt nach neun Jahren frei, darf zurück in die Welt. Es ist, wie immer in solchen Fällen, eine Wette auf die Erlösbarkeit eines Täters, dem zu verzeihen man niemals geneigt ist.
 Und doch lernt man, indem man ihm zurück in die Welt folgt, mit ihm zu hoffen. Er lernt eine junge Frau kennen, die erst widerstrebt. Wir sehen sie erst mit seinen Augen, aber diese Perspektive wechselt. Zu den Zumutungen von "Der freie Wille" gehört vor allem das: Wir sollen den Vergewaltiger mit den Augen einer Liebenden sehen. Und zu den Stärken des Films muss man zählen: Er manipuliert einen nicht, er verzichtet auf erschlichene Wirkungen, zum Beispiel durch den Einsatz von Musik. (Es gibt, an zentraler Stelle, Musik - aber dabei geht es nicht um Erschleichung von Gefühlen, sondern um das vom Geschehen zwischen den Figuren gedeckte Pathos einer Hoffnung.)
Und doch lernt man, indem man ihm zurück in die Welt folgt, mit ihm zu hoffen. Er lernt eine junge Frau kennen, die erst widerstrebt. Wir sehen sie erst mit seinen Augen, aber diese Perspektive wechselt. Zu den Zumutungen von "Der freie Wille" gehört vor allem das: Wir sollen den Vergewaltiger mit den Augen einer Liebenden sehen. Und zu den Stärken des Films muss man zählen: Er manipuliert einen nicht, er verzichtet auf erschlichene Wirkungen, zum Beispiel durch den Einsatz von Musik. (Es gibt, an zentraler Stelle, Musik - aber dabei geht es nicht um Erschleichung von Gefühlen, sondern um das vom Geschehen zwischen den Figuren gedeckte Pathos einer Hoffnung.) Matthias Glasner hat seine Mittel für diesen Film weitestmöglich reduziert. Mit winzigem Team sucht er als Kameramann die Nähe zu den Darstellern. Auch sie suchen niemals den einfachen Weg. Niemals zuvor hat man Jürgen Vogel so zurückgenommen gesehen, so sehr gefangen in seinem Körper, so subtil in seinen Gesten. Sabine Timoteo als Netti, die Frau, die ihn liebt, versteht es wie keine andere Schauspielerin im deutschen Film, das Gefühlte in huschenden Ausdrücken anzudeuten, ohne es auszuspielen. Ein Lächeln, das kurz auftaucht und wieder verschwindet. Und noch im Zusammenbruch spürt man keine Distanz zwischen einer Technik und dem, was sie zeigt.
Matthias Glasner hat seine Mittel für diesen Film weitestmöglich reduziert. Mit winzigem Team sucht er als Kameramann die Nähe zu den Darstellern. Auch sie suchen niemals den einfachen Weg. Niemals zuvor hat man Jürgen Vogel so zurückgenommen gesehen, so sehr gefangen in seinem Körper, so subtil in seinen Gesten. Sabine Timoteo als Netti, die Frau, die ihn liebt, versteht es wie keine andere Schauspielerin im deutschen Film, das Gefühlte in huschenden Ausdrücken anzudeuten, ohne es auszuspielen. Ein Lächeln, das kurz auftaucht und wieder verschwindet. Und noch im Zusammenbruch spürt man keine Distanz zwischen einer Technik und dem, was sie zeigt.Obgleich Matthias Glasner in keine der Fallen, die bereit liegen, tappt - über die eine oder andere dramaturgische Entscheidung, über den Einsatz des einen oder anderen religiösen Motivs kann man streiten -, ist "Der freie Wille" doch kein ganz großer Film. Es bleibt bis zuletzt das Gefühl eines Überschusses des Inhalts über die Form. Das Problem ist nicht, dass er seine Erzählung nicht bändigt. Aber es gelingt ihm nicht, für das Moment der Nicht-Erzählbarkeit einer solchen Geschichte Mittel zu finden, die das Konzept von Direktheit und Reduktion noch einmal reflektierend übersteigen.
Ekkehard Knörer
"Der freie Wille". Regie: Matthias Glasner. Mit Jürgen Vogel, Sabine Timoteo, Andre Hennicke u.a., Deutschland, 2006, 163 Minuten (Wettbewerb)
Selbstfindung: Franka Potentes erster Film als Regisseurin, "Der die Tollkirsche ausgräbt" (Perspektive Deutsches Kino)
Franka Potente ist wohl schon länger mit dem Gedanken schwanger gegangen, einen Film zu drehen. In ihr erstes Werk sollte alles rein, was sie mag. Franka Potente mag Stummfilme, bürgerliche Familien, Slapstick, Magie und fußbetriebene Poklapsmaschinen. Soweit so gut. Leider hat sie auch ein Faible für Punks. Ein Exemplar liegt plötzlich im Garten einer vorbildlich wilhelminischen Familie. Im Gegensatz zu allen anderen Beteiligten (Stummfilm!) kann er sprechen. Die Idee klingt zunächst gut, hakt aber nach wenigen Einstellungen. Das liegt auch an Christoph Bach, der als Punk weder bei der Familie noch im Film jemals ankommt.
 Der Lederjackenträger, der immer wirkt, als würde er sich für seinen letzten Satz schämen, sollte wohl als revolutionäres Symbol mit der konservativ sprachlosen Familie kontrastieren. Leider gibt es mittlerweile nichts Konservativeres als den schon längst durchkommerzialisierten Punk, dessen hiesiger Vertreter noch dazu wie ein künftiger Bausparer in der Selbstfindungsphase aussieht.
Der Lederjackenträger, der immer wirkt, als würde er sich für seinen letzten Satz schämen, sollte wohl als revolutionäres Symbol mit der konservativ sprachlosen Familie kontrastieren. Leider gibt es mittlerweile nichts Konservativeres als den schon längst durchkommerzialisierten Punk, dessen hiesiger Vertreter noch dazu wie ein künftiger Bausparer in der Selbstfindungsphase aussieht.Was Franka Potente hier für 40 Minuten anrichtet, ist inhaltlich überladen und stilistisch kaum aufeinander abgestimmt. Als Fingerübung in diversen Genres war das sicher lehrreich für die angehende Regisseurin Potente, doch dem Zuschauer vergeht bei dem disparaten Mischmasch der Appetit. Bis der evolutionär überlegene Punk des 21. Jahrhunderts dem Bürger von 1918 schließlich die Braut ausspannt, werden noch die angekündigten Tollkirschen ausgegraben, Elixiere gebraut, Hunde vom Erdboden verschluckt und sehr, sehr viele Grimassen geschnitten.
Wenn das Licht im Kinosaal angeht, ist man trotzdem nicht wirklich böse. Weder auf die Filmemacherin Potente, deren nächster, etwas konzentrierterer Arbeit man entgegensieht, noch darauf, dass die Regisseurin in spe es zunächst einmal bei einem Kurzfilm belassen hat.
Christoph Mayerl
"Der die Tollkirsche ausgräbt". Regie: Franka Potente. Mit Emilia Sparagna, Christoph Bach, Justus von Dohnanyi. Deutschland 2005, 40 Minuten (Perspektive Deutsches Kino)
Warten mit Ruben: Rodrigo Morenos "El custodio - Der Schatten" (Wettbewerb)
Tür auf. Tür zu. Anfangs hat das laute Türknallen noch geholfen, doch bald hat die große Dame in der Reihe vor mir der Müdigkeit nachgegeben und ist unaufhaltsam zur Seite gesunken. So konnte man endlich die Untertitel richtig lesen. Das wiederum hat eigentlich nicht gestört. Denn Rodrigo Morenos erster Spielfilm, der eher eine Studie über Identität und das Außer-sich-Sein ist, kommt auch gut ohne Dialoge auskommen. Ruben spricht nicht viel.
 Ruben ist Leibwächter des argentinischen Planungsministers, er folgt ihm überall hin, ins Büro, ins Abgeordnetenhaus, zum Wochenendausflug auf die Finca und zur Geliebten. Selbst die Toilette überprüft Rubens, bevor sein Schützling sie benutzt. Rubens nimmt nicht am Leben des Ministers teil, er beobachtet es nur. Meistens wartet er in den Gängen oder Hallen vor verschlossenen Türen, wie ausgeschaltet, um dann wieder anzuspringen, wenn die Tür sich öffnet. Die Kamera berichtet den ganzen Film über aus der Perspektive von Rubens und überträgt so die Monotonie seiner Tätigkeit maßstabsgetreu auf das Kino. In der Zurückhaltung der Kamera liegt aber keine Ruhe, man sieht es am Gesicht des Protagonisten, der angespannt wirkt, hastig an seiner Zigarette zieht, nie die Schultern hängen oder die müden Augen kurz zufallen lässt.
Ruben ist Leibwächter des argentinischen Planungsministers, er folgt ihm überall hin, ins Büro, ins Abgeordnetenhaus, zum Wochenendausflug auf die Finca und zur Geliebten. Selbst die Toilette überprüft Rubens, bevor sein Schützling sie benutzt. Rubens nimmt nicht am Leben des Ministers teil, er beobachtet es nur. Meistens wartet er in den Gängen oder Hallen vor verschlossenen Türen, wie ausgeschaltet, um dann wieder anzuspringen, wenn die Tür sich öffnet. Die Kamera berichtet den ganzen Film über aus der Perspektive von Rubens und überträgt so die Monotonie seiner Tätigkeit maßstabsgetreu auf das Kino. In der Zurückhaltung der Kamera liegt aber keine Ruhe, man sieht es am Gesicht des Protagonisten, der angespannt wirkt, hastig an seiner Zigarette zieht, nie die Schultern hängen oder die müden Augen kurz zufallen lässt.Ruben ist immer im Job, privat erwartet ihn nicht viel, eine verwirrte Mutter, mit der er nichts anfangen kann, oder billige Prostituierte, zu denen er eher widerwillig geht. Sein Privatleben ist uninteressant, und der Job verlangt eine vollständige Unterwerfung unter das Leben des Ministers, im Ernstfall sogar die Selbstaufgabe. Auf diese Selbstaufgabe treibt Ruben hin. Er droht tatsächlich zum "Schatten" des Ministers zu werden, dem er folgen muss, ohne je er zu sein. Seine eigenen Bedürfnisse kann er schon lange nicht mehr erfüllen, ja er droht sie selbst nicht mehr zu kennen.
Rodrigo Moreno stellt diese Entleibung, diese zunehmende Entäußerung Rubens mit monotonen, sich oft wiederholenden Abläufen aus dem Leben eines Leibwächters inhaltlich und auch ästhetisch sehr konsequent dar. Moreno ist streng mit sich und mit dem Publikum. Ruben wartet, und die Kamera wartet getreu mit ihm, lenkt den Blick lange auf kleine Gegenstände, starrt auf das vorausfahrende Auto oder auf den Rücken des Ministers. Das ist atmosphärisch gelungen, aber eben auch recht monoton. Die müde Dame ist übrigens nicht mehr aufgewacht. Auch nicht beim letzten Geräusch, als Ruben nach seiner Selbstbefreiung an den Strand fährt. Tür auf.
Christoph Mayerl
"El custodio - Der Schatten". Regie: Rodrigo Moreno. Mit Julio Chavez, Osmar Nunez, Elvira Onetto. Argentinien/Deutschland/Frankreich (Wettbewerb)
Allan Kings "Memory for Max, Claire, Ida and Company" (Forum)
 Max ist ein schmaler Mann mit Stock. Mit Trippelschritten geht er im Gang auf und ab. Er singt viel, er liebt Claire, auch wenn beide vieles vergessen haben aus ihrem Leben, sie liebt ihn. An ihrem Geburtstag drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Einmal sehen wir Max noch im Gang, fast sieht er ein wenig aus wie der frühe Chaplin, die Füße gespreizt, ein kleiner Mann mit Stock, die Kamera blickt aus ein wenig Distanz.
Max ist ein schmaler Mann mit Stock. Mit Trippelschritten geht er im Gang auf und ab. Er singt viel, er liebt Claire, auch wenn beide vieles vergessen haben aus ihrem Leben, sie liebt ihn. An ihrem Geburtstag drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Einmal sehen wir Max noch im Gang, fast sieht er ein wenig aus wie der frühe Chaplin, die Füße gespreizt, ein kleiner Mann mit Stock, die Kamera blickt aus ein wenig Distanz.Wenig später erfahren wir: Max ist tot. Er ist gestürzt und am selben Tag noch im Krankenhaus gestorben. Seine Mitbewohner im Baycrest Seniorenheim werden in einer kleinen Runde versammelt, man erzählt ihnen von seinem Tod. Claire ist schwer getroffen, sie bricht in Tränen aus. Und doch wird sie es vergessen. Wieder und wieder wird man ihr vom Tod des geliebten Mannes erzählen, wieder und wieder wird sie es vergessen. Jedes Mal erneut erfährt sie den Schock, weint, trauert.
Später erfahren wir, dass auch ihr Ehemann Max hieß. Sie verwechselt, scheint es, die beiden, sie erinnert sich an den einen Max und kaum an den anderen, oder sie sind zu einer Person verschmolzen. Den alten Leuten von Baycrest ist ihr Leben zerfallen, sie haben Alzheimer oder sind dement. Manche wissen es, manche ahnen es, oder manchmal ahnen sie es. Max, der viel sang, schien in seiner Ahnungslosigkeit glücklich. Eine scheint untröstlich, dann sagt sie, sie will nur noch sterben, und später lacht sie und sagt, sie fühle sich sehr jung.
Allan King hat zuletzt in "Dying Grace" (2003), auch auf der Berlinale zu sehen, Todkranke in einer Palliativklinik beobachtet. Sterbende sind auch die Heldinnen und Helden in diesem Film. Halb ist ihnen mit der Erinnerung ihr eigenes Leben schon entglitten. Eine von ihnen, wird ihre Tochter sagen, die sie nicht mehr erkennt, ist nicht mehr die, die sie war. Sie war freundlich und intelligent. Jetzt tritt sie nach denen, die ihr helfen wollen. Eine andere sitzt auf dem Bett, auf dem Stuhl sitzt ihr sarkastischer Sohn, gemeinsam rekonstruieren sie Episoden ihres Lebens. Sie erinnert sich an lange Zurückliegendes, an anderes nicht. Ratlos sitzt man herum, denn das Ausgegrabene wird wieder verschwinden in einem Vergessen, das ganze Leben mit sich reißt.
Human ist "Memory for Max, Claire, Ida and Company" in seiner Unaufdringlichkeit. Der Film schweigt nicht davon, wie schwer erträglich das alles ist. Er hat eine Haltung zu dem, was man sieht; oft sieht man die Alten im Gespräch mit Beverly Zwaigen, einer Betreuerin. Die Kamera ist dabei, in der Nähe, sie versteckt sich nicht, sie hört zu. Manchmal reagieren die Gefilmten auf sie, ein paar dieser Szenen zeigt auch der Film. Mehr als Dabeisein ist seine Sache nicht. Musik gibt es nur zu Beginn und am Ende. Kein Voiceover-Kommentar. Der Film macht, dass wir ganz Auge und Ohr sind und Verbündete der Sterbenden. Wir trauern mit ihnen um das, was sie waren.
Ekkehard Knörer
"Memory for Max, Claire, Ida and Company". Regie: Allan King. Dokumentarfilm. Kanada 2005. 112 Minuten (Forum)
Gediegene Unterhaltung: Robert Altmans "A Prairie Home Companion" (Wettbewerb)
 Meryl Streep jault. Sie jault wie ein Kojote, und schon geht sie los, die Show. Oder sind es nur die Vorbereitungen? Man weiß nicht, woran man ist in diesem Film. "A Prairie Home Companion" gibt es wirklich, seit dreißig Jahren ist sie eine erfolgreiche Show im amerikanischen Radio. Ihr Erfinder Garrison Keillor hat das Drehbuch zum Film geschrieben, hat nur die Ereignisse rund um die Bühne dazu erfunden und auch die meisten seiner für die Show geschaffenen Figuren untergebracht. Viele aus Keillors Originalbesetzung spielen sich selbst vor der Kamera, andere Rollen, wie die des Privatdetektivs Guy Noir oder die der singenden Country-Schwestern, übernehmen Kevin Kline, Meryl Streep und Lily Tomlin. Keillors Crew und Altmans Ensemble arbeiten nahtlos zusammen. Schließlich machen ja alle Theater.
Meryl Streep jault. Sie jault wie ein Kojote, und schon geht sie los, die Show. Oder sind es nur die Vorbereitungen? Man weiß nicht, woran man ist in diesem Film. "A Prairie Home Companion" gibt es wirklich, seit dreißig Jahren ist sie eine erfolgreiche Show im amerikanischen Radio. Ihr Erfinder Garrison Keillor hat das Drehbuch zum Film geschrieben, hat nur die Ereignisse rund um die Bühne dazu erfunden und auch die meisten seiner für die Show geschaffenen Figuren untergebracht. Viele aus Keillors Originalbesetzung spielen sich selbst vor der Kamera, andere Rollen, wie die des Privatdetektivs Guy Noir oder die der singenden Country-Schwestern, übernehmen Kevin Kline, Meryl Streep und Lily Tomlin. Keillors Crew und Altmans Ensemble arbeiten nahtlos zusammen. Schließlich machen ja alle Theater.Robert Altmans Film behandelt im Großen und Ganzen eine besondere Folge der Show. Es soll die letzte sein, wie nach und nach klar wird. In Echtzeit verfolgen wir alles, vom ersten Vorhang bis zum letzten. Die gesamte Handlung spielt sich im Inneren des World Theaters in der Kleinstadt St. Paul ab. Es ist, als hätte man eine Eintrittskarte gelöst und würde tatsächlich auf den antiquierten Theatersesseln sitzen, die sich von Kinosesseln ja nicht wesentlich unterscheiden. Irgendwann fragt man sich, warum man nicht einfach eine Eintrittskarte für die Show gelöst hat. Alles muss bei der wöchentlichen Aufzeichnung ähnlich ablaufen, die gesungenen Werbespots, die politisch unkorrekten Witze, die Lieder vom Landleben und Jugendlieben. Oder anders gesagt: Wo ist Altman? Ist er in Kevin Kline, der trottelig hinter der Bühne ermittelt und einen Engel sieht, oder ist er in Lindsay Lohan, die ihre singende Mutter Meryl Streep mit Selbstmordgedichten nur vorübergehend beunruhigen kann?
Damit kein Missverständnis entsteht: Es ist angenehm, in dieser Show zu sein. Eine große Familie, die ihren Gästen gediegene Abendunterhaltung bietet. Ein sehr edles "Wetten dass", wenn man so will, mit einem Moderator, der eine Mischung aus Max Raabe und Wim Thoelke ist. Harmlose Unterhaltung. Leider jault Meryl Streep kein zweites Mal.
Christoph Mayerl
"A Prairie Home Companion". Regie: Robert Altman. Mit Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Meryl Streep, Lily Tomlin, Kevin Kline u.a., USA 2006, 100 Minuten (Wettbewerb)
Schnell, bunt, dünn: Chen Kaiges "The Promise" (Wettbewerb, außer Konkurrenz)
 Chen Kaige geht mit Chinas angeblich teuerster Filmproduktion aller Zeiten in den Wettbewerb. Verglichen mit dem Geld, das Hollywoods Regisseure zur Verfügung haben, sind die 30 Millionen Dollar zwar ein Klacks, trotzdem verströmt der Film den unbedingten Willen zum Blockbuster. Schon die Besetzung ist international, in den Hauptrollen finden sich die Stars des asiatischen Kinos: Aus Hongkong Cecilia Cheung, aus Japan Hiroyuki Sanada und aus Korea Jang Dung-Kun.
Chen Kaige geht mit Chinas angeblich teuerster Filmproduktion aller Zeiten in den Wettbewerb. Verglichen mit dem Geld, das Hollywoods Regisseure zur Verfügung haben, sind die 30 Millionen Dollar zwar ein Klacks, trotzdem verströmt der Film den unbedingten Willen zum Blockbuster. Schon die Besetzung ist international, in den Hauptrollen finden sich die Stars des asiatischen Kinos: Aus Hongkong Cecilia Cheung, aus Japan Hiroyuki Sanada und aus Korea Jang Dung-Kun.Die Bilder erschlagen einen: Purpurne Armeen preschen durch gewaltige Landschaften und über violette Blumenfelder, zartrosa Mandelblüten regnen vom azurblauen Himmel, die Gewänder wallen in allen Farben des Regenbogens, es ist eine einzige Pracht. Mit Spezialeffekten wird nicht gegeizt, die Martial-Arts-Szenen haben die Rasanz eines Comics.
 Die Geschichte allerdings ist schrecklich dünn: In einem fernen Reich vor unserer Zeit streift ein kleines Mädchen um die Leichen auf einem Schlachtfeld. Sie sucht etwas zu Essen und ein Paar Stiefel. Ein Junge nimmt sie gefangen und lässt sie nur gegen das Versprechen frei, dass sie seine Sklavin wird. Doch das Mädchen hält sich nicht dran und läuft weg. Nun stößt sie auf eine Fee, die ihr ein Leben voller Reichtümer und Macht verspricht - zu dem Preis, dass jeder Mann, den sie liebt, sterben wird. Das Mädchen willigt ein.
Die Geschichte allerdings ist schrecklich dünn: In einem fernen Reich vor unserer Zeit streift ein kleines Mädchen um die Leichen auf einem Schlachtfeld. Sie sucht etwas zu Essen und ein Paar Stiefel. Ein Junge nimmt sie gefangen und lässt sie nur gegen das Versprechen frei, dass sie seine Sklavin wird. Doch das Mädchen hält sich nicht dran und läuft weg. Nun stößt sie auf eine Fee, die ihr ein Leben voller Reichtümer und Macht verspricht - zu dem Preis, dass jeder Mann, den sie liebt, sterben wird. Das Mädchen willigt ein.Zwanzig Jahre später ist sie tatsächlich die Geliebte des Königs, der von den Soldaten des Fürsten aus dem Norden, Wuhuan belagert wird. Der General Guangming schickt seinen Sklaven Kunlun zu Hilfe. Der jedoch tötet den König, und die schöne Prinzessin verliebt sich in ihn in dem Glauben, es sei der General. Aber wer muss jetzt sterben: Der General oder sein Sklave?
Wie man überall liest, haben die Produzenten, die Brüder Weinstein, den fertigen Film umgeschnitten. Wer auch immer für den Schluss verantwortlich ist: Er verdirbt einem den Spaß an dem Film.
Thekla Dannenberg
"Wu ji - The Promise". Regie: Chen Kaige. Mit Cecilia Cheung, Hiroyuki Sanada, Jang Dung-Kun und anderen. China 2005, 103 Minuten (Wettbewerb)
Thomas Arslans Dokumentarfilm "Aus der Ferne" (Forum)
 Ein wahrer Dokumentarfilm ist eine Grunde tautologische Sache: Man sieht, was man sieht, so wie es gezeigt wird. Das ist, im besten Fall, kein Mangel, sondern gerade der Reichtum einer Dokumentation. Es ist und wird und bleibt eine Sache des "Da Seins", mit allen Komplexitäten, die in dieser Wendung stecken. Und da das eine Sache des Zeigens und nicht des Erzählens ist, bedarf sie nicht vieler Worte. Thomas Arslans "Aus der Ferne" ist ein großartiger Dokumentarfilm, der uns etwas zu sehen gibt, indem er unserem Blick Richtungen gibt, aber keine Vorschriften macht. Was die Kamera registriert, gibt sie uns, "Aus der Ferne" so nah, auf dass wir es sehen.
Ein wahrer Dokumentarfilm ist eine Grunde tautologische Sache: Man sieht, was man sieht, so wie es gezeigt wird. Das ist, im besten Fall, kein Mangel, sondern gerade der Reichtum einer Dokumentation. Es ist und wird und bleibt eine Sache des "Da Seins", mit allen Komplexitäten, die in dieser Wendung stecken. Und da das eine Sache des Zeigens und nicht des Erzählens ist, bedarf sie nicht vieler Worte. Thomas Arslans "Aus der Ferne" ist ein großartiger Dokumentarfilm, der uns etwas zu sehen gibt, indem er unserem Blick Richtungen gibt, aber keine Vorschriften macht. Was die Kamera registriert, gibt sie uns, "Aus der Ferne" so nah, auf dass wir es sehen.Thomas Arslan gehört zu einer Gruppe von deutschen Filmemachern - unter ihnen auch Angela Schanelec und Christian Petzold -, die von der Kritik als "Berliner Schule" bezeichnet wurden. Was sie gemeinsam haben, ist ein ungewöhnliches Maß an ästhetischer Reflexion. Das spürt man - als Abwesenheit von Klischees und Dummheit - in jedem Bild dieses Films, der in Istanbul beginnt und sich dann in die östlichsten Gegenden der Türkei bewegt. Es gibt ein bezeichnendes Bild, das wiederholt auftaucht, bei jedem wichtigen Schritt auf dieser Reise. Es ist eine Einstellung, aus Zimmern ins Freie gefilmt. Was man sieht in diesen Einstellungen, ist ein offenes Fenster und ein Blick, aber auch der Rahmen des Fensters, den es braucht, damit das "Da" zum Kinobild wird. Ein wahrer Dokumentarfilm ist ein Fenster zur Welt, das nie verleugnet, dass es kein Bild gibt ohne Rahmen und ohne Verfahren des Rahmens. Die Stimme des Regisseurs fügt diesen Einstellungen nur die Fakten hinzu und die Position des Erzählers.
 Thomas Arslan ist in der Türkei geboren und zur Grundschule gegangen. Er kam nach Deutschland, als sein Vater die Heimat verließ - eine Heimat, in die Arslan zwanzig Jahre lang nicht zurückgekehrt war. So viel erfahren wir über ihn. Die Türkei ist das Land seiner Kindheit und das könnte erklären, warum er vorzugsweise Kinder zeigt in seinem Film. Kinder, die versunken sind in Spiele und Handlungen, aber auch Kinder bei der Arbeit und Kinder im spielerischen Umgang mit der Gegenwart der Kamera, die so deren Abwesenheit spürbar machen, die Abwesenheit dessen, was uns zeigt, was da ist.
Thomas Arslan ist in der Türkei geboren und zur Grundschule gegangen. Er kam nach Deutschland, als sein Vater die Heimat verließ - eine Heimat, in die Arslan zwanzig Jahre lang nicht zurückgekehrt war. So viel erfahren wir über ihn. Die Türkei ist das Land seiner Kindheit und das könnte erklären, warum er vorzugsweise Kinder zeigt in seinem Film. Kinder, die versunken sind in Spiele und Handlungen, aber auch Kinder bei der Arbeit und Kinder im spielerischen Umgang mit der Gegenwart der Kamera, die so deren Abwesenheit spürbar machen, die Abwesenheit dessen, was uns zeigt, was da ist.Arslans Kamera bewegt sich nicht viel. Sie folgt der Bewegung Richtung Osten, indem sie die Straßen filmt und die Landschaften auf dem Weg. Und ein paar Mal eröffnet sie Plätze in Städten und Räume mit wundervollen Schwenks, die dem Zuschauer einen Eindruck vermitteln nicht nur der Offenheit für das "Da Sein" der Welt, aber auch für die Kraft der Dokumentation, dieses "Da" sichtbar zu machen - in den Grenzen, versteht sich, des tautologisch Möglichen.
Ekkehard Knörer
"Aus der Ferne". Regie: Thomas Arslan. Dokumentarfilm. Deutschland, 2006, 89 Minuten. (Forum)