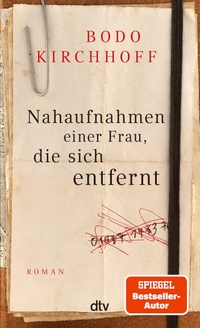Redaktionsblog - Im Ententeich
Der dritte Schritt vorm ersten
Von Thierry Chervel
05.06.2014. Mit Jaron Lanier erhält einer den Friedenspreis, der die dunklen Seiten des Netzes ausmalt. Hätte man nicht erst mal das Helle am Netz feiern können?Für eines kann man der Jury des Friedenspreises dankbar sein: Immerhin haben sie nicht Evgeny Morozov zum Preisträger gekürt, jenen World Wide Troll, der den Kräften der Beharrung erzählt, dass es mit dem Netz nicht so weit her ist. Jaron Lanier ist von anderer Statur, er ist ein wirklicher Pionier der Computerwelt und kommt aus jener libertären Kultur des amerikanischen Westens, die die Computer und das Internet erst möglich machte. (Bild: unter cc von ALA / Flickr)
Und doch macht mich die Entscheidung eher traurig. Sie ist so deutsch! Bevor man die Befreiung feiert, die das Netz doch brachte, bevor man Autoren und Pioniere sucht, die das Offene und das Verbindende am Netz verkörpern, zeichnet man doch lieber einen aus, der seit einigen Jahren mit Hingabe - und durchaus auch Argumenten - die dunklen Seiten des Netzes ausmalt. "Lanier hat als einer der Ersten überhaupt auf den zutiefst ambivalenten, für Missbrauch anfälligen Charakter hingewiesen, der die schöne neue Welt auszeichnet", schreibt Jordan Mejias im FAZ.Net. Genau: Das ist es, was die Leute hören wollen.
Irgendwie kommt es mir vor, als serviere man hier jenen, die den ersten Schritt noch nicht gemacht haben, einen Preisträger, der schon beim dritten Schritt ist. Ja, ganz recht, Lanier beklagt, dass sich die großen Internetkonzerne das Netz unter den Nagel zu reißen drohen und dass "du das Produkt bist", aber jene, die ihn begierig drucken und rezipieren, haben noch nie darauf hingewiesen, dass Lanier dies im Namen eines offenen Netzes tut, das für die Kräfte der Beharrung die eigentliche Provokation darstellt.
Lanier beschuldigt die Wikipedia des digitalen Maoismus und mag es im Namen der heroischen Frühzeit des Internets tun, als das Netz noch das sich selbst webende Weltwissen war und jeder einzelne seine Liebhaberei pflegte, ohne sich einer normierenden Syntax zu unterwerfen. Aber dieses Argument wird hier von einen Publikum goutiert, das noch das Verschwinden der zwanzigbändigen Lexika bedauert, die es einst so stolz in sein Regal stellte.
Da wird einem auch klar, warum Lanier zum Börsenverein des deutschen Buchhandels so viel besser passt als, sagen wir, ein Yochai Benkler, ein in Deutschland fast unbekannter Autor, der in seinem gundlegenden Werk "The Wealth of Networks" (hier unter CC-Lizenz) auf die Fortschrittsfeindlichkeit eines sich verabsolutierenden Copyrights und der Idee des geistigen Eigentums hinweist. Oder gar der wunderbare Dichter und Denker Lewis Hyde, der in "Common as Air" (hier ein Auszug aus seinem Buch als pdf) die Ideen der amerikanischen Günderväter über das Copyright (sie waren misstrauisch!) als Blaupause für das Internetzeitalter ausarbeitet.
Thomas Thiel feierte Lanier in der FAZ in der Rezension zu seinem letzten Buch "Wem gehört die Zukunft?" vor allem als Kritiker der Gratiskultur. Auch das passt! Natürlich ist an Laniers Argumenten vieles richtig: Wir nutzen das kostenlose Gmail - und merken nicht, dass wir das Produkt sind, das vermarktet und durch den persönlichen Zuschnitt konditioniert wird, zumindest der Idee nach. Aber die in solchen Modellen pervertierte Gratiskultur war ursprünglich eine des Teilens, und trotz allem ist diese Geste des Teilens, die anderen Wissen gibt, die vornehmste Dimension des Netzes. Darum lieben die Nutzer das Netz. Diese Idee ist es, die von den Adepten des geistigen Eigentums von FAZ bis Reuss nie benannt wird.
Open Source, Open Access: Das ist zu subversiv für den Friedenspreis.
Man hätte Netzpioniere wie Richard Stallman würdigen können, der zu den Vorkämpfern der freien Softwarebewegung gehört und in einer visionären Erzählung die totalitären Gefahren einer Ideologie des geistigen Eigentums skizzierte. Man hätte Lawrence Lessig auszeichnen können, der die Creative-Commons-Bewegung entscheidend prägte und "Freie Kultur" als "Wesen und Zukunft der Kreativität" versteht. Doch für beide hat man sich in Deutschland nicht interessiert.
Und es hätte noch zwei Kandidaten für den Friedenspreis gegeben, die vor Lanier den Preis verdient hätten: Tim Berners-Lee, der der Welt das Internet erst schenkte, denn vorher war es nur Geeks und Nerds nutzbar, oder eben doch Jimmy Wales für seine Idee der Wikipedia, trotz des absurden Maoismus-Vorwurfs Laniers.
Nun ist es also Lanier. Er ist ein Kopf. Seine Idee, die Gratiskultur des Netzes aufzuheben, indem jeder Einzelne seine Daten an die Konzerne verkauft, kam in den Kritiken nicht so gut an. Sie zeigt allerdings, dass das subversive Potenzial Kaliforniens in Lanier noch pocht. Möge es sich in der Friedenspreisrede manifestieren. Wir gratulieren.
Thierry Chervel
Und doch macht mich die Entscheidung eher traurig. Sie ist so deutsch! Bevor man die Befreiung feiert, die das Netz doch brachte, bevor man Autoren und Pioniere sucht, die das Offene und das Verbindende am Netz verkörpern, zeichnet man doch lieber einen aus, der seit einigen Jahren mit Hingabe - und durchaus auch Argumenten - die dunklen Seiten des Netzes ausmalt. "Lanier hat als einer der Ersten überhaupt auf den zutiefst ambivalenten, für Missbrauch anfälligen Charakter hingewiesen, der die schöne neue Welt auszeichnet", schreibt Jordan Mejias im FAZ.Net. Genau: Das ist es, was die Leute hören wollen.
Irgendwie kommt es mir vor, als serviere man hier jenen, die den ersten Schritt noch nicht gemacht haben, einen Preisträger, der schon beim dritten Schritt ist. Ja, ganz recht, Lanier beklagt, dass sich die großen Internetkonzerne das Netz unter den Nagel zu reißen drohen und dass "du das Produkt bist", aber jene, die ihn begierig drucken und rezipieren, haben noch nie darauf hingewiesen, dass Lanier dies im Namen eines offenen Netzes tut, das für die Kräfte der Beharrung die eigentliche Provokation darstellt.
Lanier beschuldigt die Wikipedia des digitalen Maoismus und mag es im Namen der heroischen Frühzeit des Internets tun, als das Netz noch das sich selbst webende Weltwissen war und jeder einzelne seine Liebhaberei pflegte, ohne sich einer normierenden Syntax zu unterwerfen. Aber dieses Argument wird hier von einen Publikum goutiert, das noch das Verschwinden der zwanzigbändigen Lexika bedauert, die es einst so stolz in sein Regal stellte.
Da wird einem auch klar, warum Lanier zum Börsenverein des deutschen Buchhandels so viel besser passt als, sagen wir, ein Yochai Benkler, ein in Deutschland fast unbekannter Autor, der in seinem gundlegenden Werk "The Wealth of Networks" (hier unter CC-Lizenz) auf die Fortschrittsfeindlichkeit eines sich verabsolutierenden Copyrights und der Idee des geistigen Eigentums hinweist. Oder gar der wunderbare Dichter und Denker Lewis Hyde, der in "Common as Air" (hier ein Auszug aus seinem Buch als pdf) die Ideen der amerikanischen Günderväter über das Copyright (sie waren misstrauisch!) als Blaupause für das Internetzeitalter ausarbeitet.
Thomas Thiel feierte Lanier in der FAZ in der Rezension zu seinem letzten Buch "Wem gehört die Zukunft?" vor allem als Kritiker der Gratiskultur. Auch das passt! Natürlich ist an Laniers Argumenten vieles richtig: Wir nutzen das kostenlose Gmail - und merken nicht, dass wir das Produkt sind, das vermarktet und durch den persönlichen Zuschnitt konditioniert wird, zumindest der Idee nach. Aber die in solchen Modellen pervertierte Gratiskultur war ursprünglich eine des Teilens, und trotz allem ist diese Geste des Teilens, die anderen Wissen gibt, die vornehmste Dimension des Netzes. Darum lieben die Nutzer das Netz. Diese Idee ist es, die von den Adepten des geistigen Eigentums von FAZ bis Reuss nie benannt wird.
Open Source, Open Access: Das ist zu subversiv für den Friedenspreis.
Man hätte Netzpioniere wie Richard Stallman würdigen können, der zu den Vorkämpfern der freien Softwarebewegung gehört und in einer visionären Erzählung die totalitären Gefahren einer Ideologie des geistigen Eigentums skizzierte. Man hätte Lawrence Lessig auszeichnen können, der die Creative-Commons-Bewegung entscheidend prägte und "Freie Kultur" als "Wesen und Zukunft der Kreativität" versteht. Doch für beide hat man sich in Deutschland nicht interessiert.
Und es hätte noch zwei Kandidaten für den Friedenspreis gegeben, die vor Lanier den Preis verdient hätten: Tim Berners-Lee, der der Welt das Internet erst schenkte, denn vorher war es nur Geeks und Nerds nutzbar, oder eben doch Jimmy Wales für seine Idee der Wikipedia, trotz des absurden Maoismus-Vorwurfs Laniers.
Nun ist es also Lanier. Er ist ein Kopf. Seine Idee, die Gratiskultur des Netzes aufzuheben, indem jeder Einzelne seine Daten an die Konzerne verkauft, kam in den Kritiken nicht so gut an. Sie zeigt allerdings, dass das subversive Potenzial Kaliforniens in Lanier noch pocht. Möge es sich in der Friedenspreisrede manifestieren. Wir gratulieren.
Thierry Chervel
12 Kommentare