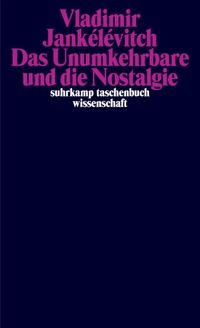Virtualienmarkt
Deutsche Zeitungen im Internet: ratlos
Von Robin Meyer-Lucht
22.05.2003. Deutsche Medienhäuser klagen gern über die "Kostenloskultur" im Internet - und zeigen damit nur, dass sie das neue Medium nicht verstanden haben. Manchmal hat man den Eindruck, die deutschen Verlagshäuser würden das Internet am liebsten wieder abschaffen. Wohl kaum einem Medium misstrauen sie inzwischen mehr: Die Ratlosigkeit und Verzagtheit will so gar nicht einem Masterplan weichen. Statt dessen beklagt man die "Fehler" der Anfangsjahre. So schrieb der ehemalige Zeit-Chefredakteur Roger de Weck vor einigen Monaten, die Zeitungsverlage hätten ihre Inhalte nie kostenfrei ins Netz stellen dürfen. Focus-Chefredakteur Helmut Markwort sprach im letzten Herbst vom "Schnorrer-Medium Internet".
Euphorie schlug um in Unbehagen und einen Rückfall in bekannte Verhaltensmuster. Die Wissenschaft nennt das "threat rigidity phenomenon" - wörtlich übersetzt etwa: "Starrheit durch Bedrohung": Printjournalisten wollen endlich das Print-Geschäftsmodell online durchboxen. Nur ein zahlender Leser sei auch ein guter Leser. Damit verweigern sich erhebliche Teile der deutschen Medienindustrie der Einsicht in die Landschaft des Wettbewerbs in einem neuen Medium - in dem zunehmend mehr professionelle journalistische Inhalte nachgefragt werden.
Dabei zeigt ein Blick in die Vereinigten Staaten, wie sich die Fundamentalprinzipien des verlegerischen Gewerbes online ausbuchstabieren: Microsofts Online-Magazin Slate hat nach einem Bericht der New York Times im letzten Quartal erstmals mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Man beachte, woraus die Einnahmen vornehmlich bestanden: aus Online-Werbung. Dabei hatte gerade Slate zunächst auf ein Abonnements-Modell gesetzt. Im Frühjahr 1996 gestartet, führte die Site 1998 eine Jahresgebühr von $ 19,95 ein. Binnen eines Jahres wurden weniger als 30 000 Abonnenten gewonnen. Slate kehrte zum werbefinanzierten Modell zurück.
"Unsere heutige Reichweite hat uns erstmals über die Gewinnschwelle geführt", jubilierte nun Bill Gates in einer E-Mail an seine Mitarbeiter, "Und unsere Reichweite wird weiter steigen." Mit rund sechs Millionen Besuchern pro Monat hat die Site die Zahl ihrer Leser innerhalb eines Jahres verdoppelt. Sie liegt damit vor dem Online-Angebot des Time-Magazins und dem der Washington Post.
"Als wir anfingen, haben wir die Site eher mit einer Print-Publikation verglichen," sagt Jack Shafer, Chef vom Dienst bei Slate, "doch tatsächlich ist sie einer Radiostation viel ähnlicher." Ein zusätzlicher Nutzer koste eine Site wie Slate nämlich fast nichts - anders als in Print, wo die Ausgaben für jeden zusätzlichen Leser mit Druck, der Versand und Abonnenten-Gewinnung erheblich seien. "Ein Medienprodukt wie Slate erreicht sehr günstig Skaleneffekte", erläutert Shafer.
Für Texte und Fotos ähnelt das Internet in seiner ökonomischen Struktur den Rundfunkmedien: Reichweite kostet fast nichts. In einem solchen Umfeld ist der Anreiz groß, das Heil in der Reichweite zu suchen, die dann wiederum sehr attraktiv für die Werbeindustrie ist. Die größten Sites mit dem besten Publikum werden sich dann weitgehend über Werbung finanzieren lassen. Hohe Reichweiten erleichtern es zudem, weitere Einnahmequellen zu erschließen.
Die New York Times hat dies sehr genau analysiert und daher beschlossen, kein Geld für ihr aktuelles Online-Angebot zu nehmen. Sie ist fest entschlossen, zu den Gewinnern im Reichweitenwettbewerb gehören und wartet nun mit großer Geduld eine Konsolidierung und die weiter steigende Popularität des Internets ab. Sie will sich durch Gebühren nicht einen Markt verbauen, der sich langfristig höchstwahrscheinlich über Werbung wird finanzieren lassen.
Mit weniger als 7 Millionen Dollar Umsatz und 30 Mitarbeitern ist Slate ein Winzling, der vom Microsofts finanziellem Rückhalt und der Einbindung in ein reichweitenstarkes Portal getragen wird. Man mag das Zahlenwerk hinter der Gewinnmeldung bezweifeln, doch es hat Signalwirkung für das Internet: Überregionale General-Interest-Inhalte werden sich mittelfristig auf reichweitenstarken Plattformen über Werbung finanzieren lassen - auch im kleineren Markt Deutschland.
Dies bedeutet andersherum auch, dass weniger frequentierte Sites - wenn sie nicht ein für die Werbeindustrie besonders attraktives Publikum haben - direkte Zahlungen durchsetzen müssen. Gelingt dies nicht, werden sie zum PR-Anhängsel oder Hobby oder verschwinden. Die geringen Verbreitungskosten ermöglichen im übrigen zugleich auch erst die nichtkommerzielle Konkurrenz der Verlage im Internet.
Das Beispiel Slate zeigt auch, dass man den Journalismus online nicht revolutionieren muss, um gelesen zu werden. Als prägender Vorteil des Internets erwies sich auch für Slate die Schnelligkeit. Den Magazinstil machte die Site zusammen mit anderen zu einem täglichen Format, das nun die teilweise strenge und nüchterne Schule der Nachrichtensites ergänzt. Zudem bespricht und verlinkt Slate versiert die Inhalte anderer Medien.
Salon, neben Slate das zweite große US-Online-Magazin, geriet in den letzten beiden Jahren ins Nirgendwo zwischen oben beschriebenen Optionen. Besonders hart von der Online-Werbekrise in den USA getroffen, stellte Salon in den letzten zwei Jahren immer mehr Inhalte zahlungspflichtig - um Ende 2002 dann jedoch festzustellen, dass die Zahl ihrer leidenschaftlichen und zahlungswilligen Leser doch nicht groß genug ist. Nun versucht sich die Site in einer waghalsigen Kombination aus Werbe- und Abonnementsfinanzierung.
Die überregionalen deutschen Tageszeitungen haben sich online leider in ein ähnliches Abseits manövriert. Angesichts geringer Reichweiten haben sie kaum Aussicht auf ein werbefinanziertes Online-Geschäft. "E-Paper" ist nur ein anderes Wort dafür, dass sie es nicht geschafft haben, ein reines Online-Geschäft zu entwickeln.
In Deutschland wird das Thema Bezahlinhalte vom Verband deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) mit großer Emphase vorangetrieben. Tatsächlich wird ein Massenpublikum wohl häufig lieber zu einem anderem Medium greifen als online für aktuelle journalistische General-Interest-Inhalte zu zahlen. In einer Befragung der Universität St. Gallen schätzten jüngst Experten, dass die großen deutschsprachigen General-Interest-Sites in vier Jahren rund 10 Prozent und in acht Jahren rund 20 Prozent ihrer Einnahmen aus direkten Nutzerzahlungen für journalistische Inhalte erzielen werden. Diese Angaben erscheinen noch optimistisch.
Für die Etablierung journalistischer Online-Angebote braucht es Ausdauer, weil sie erst langsam ihren Platz im Informationsalltag der Nutzer finden. Die Diskussion um eine "Kostenlos-Kultur" und Bezahlinhalte lenkt von dieser Geduldsübung nur ab. Die Verlage entwickeln dem Internet gegenüber zumeist keine Hingabe, weil sie sich bis heute kein realistisches Bild von ihren Chancen und dem Weg dorthin gemacht haben.
Einst gab es Menschen, die hielten werbefinanziertes Fernsehen in Deutschland für unmöglich. So lange ist das noch gar nicht her.
Euphorie schlug um in Unbehagen und einen Rückfall in bekannte Verhaltensmuster. Die Wissenschaft nennt das "threat rigidity phenomenon" - wörtlich übersetzt etwa: "Starrheit durch Bedrohung": Printjournalisten wollen endlich das Print-Geschäftsmodell online durchboxen. Nur ein zahlender Leser sei auch ein guter Leser. Damit verweigern sich erhebliche Teile der deutschen Medienindustrie der Einsicht in die Landschaft des Wettbewerbs in einem neuen Medium - in dem zunehmend mehr professionelle journalistische Inhalte nachgefragt werden.
Dabei zeigt ein Blick in die Vereinigten Staaten, wie sich die Fundamentalprinzipien des verlegerischen Gewerbes online ausbuchstabieren: Microsofts Online-Magazin Slate hat nach einem Bericht der New York Times im letzten Quartal erstmals mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Man beachte, woraus die Einnahmen vornehmlich bestanden: aus Online-Werbung. Dabei hatte gerade Slate zunächst auf ein Abonnements-Modell gesetzt. Im Frühjahr 1996 gestartet, führte die Site 1998 eine Jahresgebühr von $ 19,95 ein. Binnen eines Jahres wurden weniger als 30 000 Abonnenten gewonnen. Slate kehrte zum werbefinanzierten Modell zurück.
"Unsere heutige Reichweite hat uns erstmals über die Gewinnschwelle geführt", jubilierte nun Bill Gates in einer E-Mail an seine Mitarbeiter, "Und unsere Reichweite wird weiter steigen." Mit rund sechs Millionen Besuchern pro Monat hat die Site die Zahl ihrer Leser innerhalb eines Jahres verdoppelt. Sie liegt damit vor dem Online-Angebot des Time-Magazins und dem der Washington Post.
"Als wir anfingen, haben wir die Site eher mit einer Print-Publikation verglichen," sagt Jack Shafer, Chef vom Dienst bei Slate, "doch tatsächlich ist sie einer Radiostation viel ähnlicher." Ein zusätzlicher Nutzer koste eine Site wie Slate nämlich fast nichts - anders als in Print, wo die Ausgaben für jeden zusätzlichen Leser mit Druck, der Versand und Abonnenten-Gewinnung erheblich seien. "Ein Medienprodukt wie Slate erreicht sehr günstig Skaleneffekte", erläutert Shafer.
Für Texte und Fotos ähnelt das Internet in seiner ökonomischen Struktur den Rundfunkmedien: Reichweite kostet fast nichts. In einem solchen Umfeld ist der Anreiz groß, das Heil in der Reichweite zu suchen, die dann wiederum sehr attraktiv für die Werbeindustrie ist. Die größten Sites mit dem besten Publikum werden sich dann weitgehend über Werbung finanzieren lassen. Hohe Reichweiten erleichtern es zudem, weitere Einnahmequellen zu erschließen.
Die New York Times hat dies sehr genau analysiert und daher beschlossen, kein Geld für ihr aktuelles Online-Angebot zu nehmen. Sie ist fest entschlossen, zu den Gewinnern im Reichweitenwettbewerb gehören und wartet nun mit großer Geduld eine Konsolidierung und die weiter steigende Popularität des Internets ab. Sie will sich durch Gebühren nicht einen Markt verbauen, der sich langfristig höchstwahrscheinlich über Werbung wird finanzieren lassen.
Mit weniger als 7 Millionen Dollar Umsatz und 30 Mitarbeitern ist Slate ein Winzling, der vom Microsofts finanziellem Rückhalt und der Einbindung in ein reichweitenstarkes Portal getragen wird. Man mag das Zahlenwerk hinter der Gewinnmeldung bezweifeln, doch es hat Signalwirkung für das Internet: Überregionale General-Interest-Inhalte werden sich mittelfristig auf reichweitenstarken Plattformen über Werbung finanzieren lassen - auch im kleineren Markt Deutschland.
Dies bedeutet andersherum auch, dass weniger frequentierte Sites - wenn sie nicht ein für die Werbeindustrie besonders attraktives Publikum haben - direkte Zahlungen durchsetzen müssen. Gelingt dies nicht, werden sie zum PR-Anhängsel oder Hobby oder verschwinden. Die geringen Verbreitungskosten ermöglichen im übrigen zugleich auch erst die nichtkommerzielle Konkurrenz der Verlage im Internet.
Das Beispiel Slate zeigt auch, dass man den Journalismus online nicht revolutionieren muss, um gelesen zu werden. Als prägender Vorteil des Internets erwies sich auch für Slate die Schnelligkeit. Den Magazinstil machte die Site zusammen mit anderen zu einem täglichen Format, das nun die teilweise strenge und nüchterne Schule der Nachrichtensites ergänzt. Zudem bespricht und verlinkt Slate versiert die Inhalte anderer Medien.
Salon, neben Slate das zweite große US-Online-Magazin, geriet in den letzten beiden Jahren ins Nirgendwo zwischen oben beschriebenen Optionen. Besonders hart von der Online-Werbekrise in den USA getroffen, stellte Salon in den letzten zwei Jahren immer mehr Inhalte zahlungspflichtig - um Ende 2002 dann jedoch festzustellen, dass die Zahl ihrer leidenschaftlichen und zahlungswilligen Leser doch nicht groß genug ist. Nun versucht sich die Site in einer waghalsigen Kombination aus Werbe- und Abonnementsfinanzierung.
Die überregionalen deutschen Tageszeitungen haben sich online leider in ein ähnliches Abseits manövriert. Angesichts geringer Reichweiten haben sie kaum Aussicht auf ein werbefinanziertes Online-Geschäft. "E-Paper" ist nur ein anderes Wort dafür, dass sie es nicht geschafft haben, ein reines Online-Geschäft zu entwickeln.
In Deutschland wird das Thema Bezahlinhalte vom Verband deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) mit großer Emphase vorangetrieben. Tatsächlich wird ein Massenpublikum wohl häufig lieber zu einem anderem Medium greifen als online für aktuelle journalistische General-Interest-Inhalte zu zahlen. In einer Befragung der Universität St. Gallen schätzten jüngst Experten, dass die großen deutschsprachigen General-Interest-Sites in vier Jahren rund 10 Prozent und in acht Jahren rund 20 Prozent ihrer Einnahmen aus direkten Nutzerzahlungen für journalistische Inhalte erzielen werden. Diese Angaben erscheinen noch optimistisch.
Für die Etablierung journalistischer Online-Angebote braucht es Ausdauer, weil sie erst langsam ihren Platz im Informationsalltag der Nutzer finden. Die Diskussion um eine "Kostenlos-Kultur" und Bezahlinhalte lenkt von dieser Geduldsübung nur ab. Die Verlage entwickeln dem Internet gegenüber zumeist keine Hingabe, weil sie sich bis heute kein realistisches Bild von ihren Chancen und dem Weg dorthin gemacht haben.
Einst gab es Menschen, die hielten werbefinanziertes Fernsehen in Deutschland für unmöglich. So lange ist das noch gar nicht her.
Kommentieren