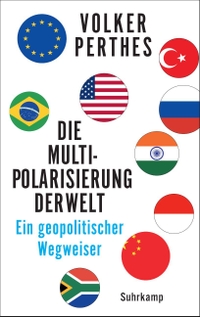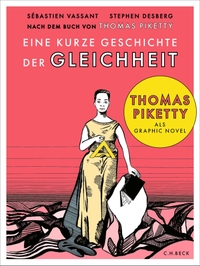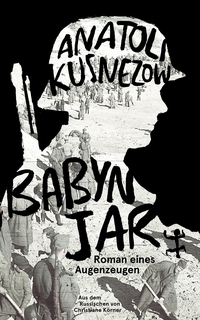Vom Nachttisch geräumt
Vorsichtige Grenzüberschreitungen
Von Arno Widmann
16.07.2019. "Queer Holdings" zeigt eine Auswahl der Sammlung queerer Kunst des Leslie-Lohman Museums - mit Lücken. Die deutsche Wikipedia schreibt: "Das Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art ist ein Kunstmuseum in SoHo, Manhattan. New York City. Es gilt als das erste Museum weltweit, das sich auf Kunst und Künstler der LGBTQ-Szene spezialisiert hat. Das Paar J. Frederic ("Fritz") Lohman (* 1922; † 2009) und Charles W. Leslie (* 1933) hatte seit den 1950er Jahren entsprechende Kunst gesammelt und 1969 erstmals eine Ausstellung dazu in ihrer Wohnung organisiert. 1987 eröffneten sie eine kommerzielle Galerie, die sie bis zum Zusammenbruch der schwulen Szene aufgrund der Aids-Epidemie Anfang der 1980er Jahre betrieben. Sie gründeten 1987 die Leslie-Lohman Gay Art Foundation, eine Stiftung, in die sie ihre umfangreiche Kunstsammlung zu LGBTQ-Themen und Künstlern einbrachten, um diese dauerhaft erhalten und zeigen zu können. Von 1987 bis 1990 weigerte sich die Finanzverwaltung zunächst, diese Stiftung als gemeinnützig anzuerkennen, weil sie in ihrem Namen das Wort 'gay' ('schwul') führte. 2006 konnte das Museum, nachdem es zunächst an anderer Stelle ausgestellt hatte, einen Teil des Erdgeschosses der Wooster Street 26 im Süden Manhattans beziehen. 2011 wurde das Museum durch den Staat New York als Museum anerkannt."
Die deutsche Wikipedia schreibt: "Das Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art ist ein Kunstmuseum in SoHo, Manhattan. New York City. Es gilt als das erste Museum weltweit, das sich auf Kunst und Künstler der LGBTQ-Szene spezialisiert hat. Das Paar J. Frederic ("Fritz") Lohman (* 1922; † 2009) und Charles W. Leslie (* 1933) hatte seit den 1950er Jahren entsprechende Kunst gesammelt und 1969 erstmals eine Ausstellung dazu in ihrer Wohnung organisiert. 1987 eröffneten sie eine kommerzielle Galerie, die sie bis zum Zusammenbruch der schwulen Szene aufgrund der Aids-Epidemie Anfang der 1980er Jahre betrieben. Sie gründeten 1987 die Leslie-Lohman Gay Art Foundation, eine Stiftung, in die sie ihre umfangreiche Kunstsammlung zu LGBTQ-Themen und Künstlern einbrachten, um diese dauerhaft erhalten und zeigen zu können. Von 1987 bis 1990 weigerte sich die Finanzverwaltung zunächst, diese Stiftung als gemeinnützig anzuerkennen, weil sie in ihrem Namen das Wort 'gay' ('schwul') führte. 2006 konnte das Museum, nachdem es zunächst an anderer Stelle ausgestellt hatte, einen Teil des Erdgeschosses der Wooster Street 26 im Süden Manhattans beziehen. 2011 wurde das Museum durch den Staat New York als Museum anerkannt."Gonzalo Casals ist Chef des Museums. Zusammen mit dem Kurator Noam Parness hat er einen Band vorgelegt, der mehr als 200 Aufnahmen von Objekten der Sammlung (meist Fotos) zeigt. Cocteau ist dabei, Nan Goldin, Hockney, Horst, Mapplethorpe, Warhol, Wilhelm von Gloeden usw. Aber auch jede Menge mir gänzlich unbekannter Größen der LGBTQ-Szene New Yorks. (Nebenbemerkung: Ich wäre dankbar für eine Chronologie, die mir erzählte, wann welcher Buchstabe, nach welchen Kämpfen wo dazu kam.) Der Band heißt Queer Holdings und wird in Deutschland vom Hirmer-Verlag vertrieben. Es gibt ihn nur auf Englisch.

Auf Seite 36 beginnen die Abbildungen. Mit einer Zeichnung von Jean Cocteau, die einen jungen athletischen Mann zeigt, dessen fast bis zur Brust reichender Penis ihm wohl nachträglich vorangestellt wurde. Von Mapplethorpe gibt es keine Blumen, sondern das Foto eines Männerarmes, der fast bis zum Ellbogen im Anus eines anderen Mannes steckt. Also ist es wohl mehr der Blick auf den Arsch eines beim fist-fucking fotografierten Mannes, wirft der informierte Leser ein. Er hat Recht. Patrick Angus' Gemälde "I got weak" aus dem Jahre 1991 zeigt ein Kino mit einigen wenigen ausschließlich männlichen Besuchern. Vorne auf der Leinwand sitzt ein junger Mann auf einem Stuhl und masturbiert. Unter ihm liegt ein anderer junger Mann und leckt ihm die Eier.
Doch noch einmal zurück zu Mapplethorpe. Der Arsch und der Arm haben Namen bei ihm. Auch das Bild daneben, das einen Mann zeigt, der eine Peitsche oder einen Schwanz aus seinem After zieht, trägt einen Namen: Robert Mapplethorpe. Die Namen sind die Pointe. Es geht nicht mehr um anonymen Sex, sondern wir schauen Menschen zu, die ihren Vergnügen nachgehen: Freunde, Nachbarn. Sie sind zu identifizieren. Sie wollen, dass man weiß, wer sie sind. Das ist die Botschaft. Wir bewegen uns im Jahr 1978. Wer die Grenze überschreitet, fühlt sich als Befreier, begrüßt uns als solcher. Ruft uns zu, mitzumachen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall geht er davon aus, dass er nicht mehr beim Überschreiten der Grenze zusammengeschlagen, erschossen wird.
Wer die zweihundert Aufnahmen durchblättert, dem fällt freilich auf, dass ein paar Grenzen doch sehr genau eingehalten werden. Es gibt keine Massenorgien. Die Zweisamkeit beherrscht die Kollektion. Nirgends greifen Unbekannte überkreuz einander in die Geschlechter. Das ist eine interessante Lücke. Ich weiß nicht, ob es eine dieses Bandes, eine der Kollektion oder gar eine der Realität ist. Man sieht das Foto eines bärtigen Mannes mit sehr schönen Brüsten - oder ist es eine Frau mit dem Kopf eines Mannes -, man sieht auch einen nackten Mann, auf dem ein Schaf steht - wohl eine Hommage an Woody Allens Film aus dem Jahre 1972 "Was ich schon immer über Sex wissen wollte…" -, nirgends aber ein Rudelfick. So transgressiv ist das Ganze also doch nicht.
Eine andere Lücke ist eher noch auffälliger: Es fehlen Teenager. Weit und breit keine Jugendlichen - naja, bei von Gloeden dann doch. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Das ist eine Maßnahme, die gut erklärt werden kann mit der Gesetzgebung. Bei der man nur hoffen kann, dass sie sich in der Wirklichkeit der Stadt New York so erfolgreich durchsetzt wie bei diesem Band über LGBTQ-Kunst.
Gonzalo Casals, Noam Parness: Queer Holdings - A survey oft the Leslie-Lohman Museum Collection, Hirmer, München 2019, 264 Seiten, s/w und farbige Abbildungen, 39,90 Euro.
Kommentieren