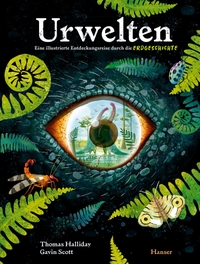Essay
In der Zeitschleife der siebziger Jahre
Von Max Thomas Mehr
08.08.2016. Trotz ihrer geringen Auflage ist die taz stilbildend geworden für die mediale Öffentlichkeit in Deutschland, genauso wie die Grünen für die Parteien. Erinnerung an eine Zeit, die völlig anders war und dennoch nicht recht vergehen will.
Kalle Ruch (auf dem Tisch) und Arno Widmann 1984 in der Wattstraße. Foto: Isabel Lott
Arno Widmann wird 70. Das kann nicht sein, wir sind doch immer die "jungen" gewesen!
Und doch muss ich nun schon fast vierzig Jahre zurückdenken. Ich möchte verstehen, warum "wir" und mit uns große Teile der Öffentlichkeit in einer Art Zeitschleife der Siebziger Jahre hängen geblieben sind, mit all den bekannten reflexhaften Einordnungen in links und rechts, unserem moralisch aufgeladenem Rigorismus und der Sehnsucht nach klaren Verhältnissen, und das trotz aller Veränderungen, die das Land seither erlebt hat.
Denn viele von uns damals - von mir einmal abgesehen - sind heute als führende Köpfe in die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, natürlich in jedes Zeitungshaus - ja sogar bei Springer - eingezogen. Grün-links-alternative Kultur hat seit den Siebziger Jahren die Hegemonie in der Öffentlichkeit übernommen, ist nicht mehr - wie damals - eine verschwindend kleine Minderheitskultur, die um öffentliche Wahrnehmung kämpfen muss. Nur weil das inzwischen auch die Rechtspopulisten von der AfD behaupten, ist diese Erkenntnis ja nicht schon von vorn herein falsch. Die grün-linke Hegemonie in der Öffentlichkeit feiert sich gerne und viel, ohne zu begreifen, welche Verantwortung ihr daraus erwächst. Und so nervt sie mich mehr, als dass sie mich freut.
Wie alles anfing: Entstanden ist die taz in einer Zeit und in einem Rahmen von Öffentlichkeit, der heute kaum mehr vorstellbar ist. Die Klammern bildeten keinesfalls nur die Nazivergangenheit unserer Eltern und Achtundsechzig. In Chile, Argentinien, aber auch in Spanien und Portugal kämpften Demokraten, Kommunisten und auch andere revolutionäre, manchmal terroristische Menschenfreunde gegen autokratische, faschistische Generäle an der Macht. Und meist stand die sogenannte etablierte Öffentlichkeit, die politische Klasse in Deutschland auf der Seite dieser Despoten. Der Vietnam-Krieg ging erst 1976 mit dem Sieg der FNL zu Ende. Hatten nicht Politiker aller Couleur von CDU bis zur SPD bis zum Schluss behauptet, dort verteidigten amerikanische Soldaten die Freiheit West-Berlins?
Heute wäre es nicht mehr denkbar, dass zum Beispiel die FAZ den Militärputsch Augusto Pinochets gegen die demokratisch gewählte sozialistische Regierung Salvador Allendes in Chile wie eine Naturkatastrophe, ein Gewitter, quasi entschuldigend hinnähme - so wie sie es 1973 tat: "Die politischen Spannungen, die Allendes missglücktes Volksfrontexperiment in Chile erzeugt hatte, drängten zur Entladung". (FAZ, 12. 9. 1973)
Dass dieser Pinochet mehr als dreißig Jahre später, am Ende seines Lebens in England wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit diesem Putsch verhaftet worden war, und bald zwei Jahre festsaß, erschien uns wie eine späte Genugtuung. Und natürlich verteidigt die FAZ heute nicht mehr solche Despoten - auch nicht CDU oder SPD. Genauso wenig wie die Verbrechen, die über die "Operation Condor" ans Licht der Öffentlichkeit gelangten, wonach die Geheimdienste autoritärer Regime in Lateinamerika in Zusammenarbeit mit US- aber auch mit anderen westlichen Geheimdiensten in den siebziger und achtziger Jahren Tausende linke Oppositionelle verschleppten, folterten und "verschwinden" ließen. Heute entschuldigt sich immerhin der amerikanische Präsident für die Verstrickung seines Landes in diese Mordaktionen.
Wir lebten damals in einer anderen Zeit, in einer Zeit, in der zwischen dem Postulat der Demokratie und tatsächlich gelebter "Demokratie" eben noch Anführungszeichen standen. Gesellschaft und Politik hatten oft nicht wirklich eine demokratische Haltung. In Spanien etwa herrschte bis in die Mitte der siebziger Jahre das faschistische Regime des General Franco, das seine Gegner mit der Garotte hinrichten ließ und trotzdem das Wohlwollen der damaligen politischen Klasse in der Bundesrepublik genoss.
Unvergessen auch der etwas spätere innenpolitische Zoff um den "Buback-Nachruf". Ein Göttinger Student hatte sich in der örtlichen Studentenzeitung an einem Nachruf auf den von der RAF ermordeten Generalbundesanwalt versucht - eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Terrorismus, der das Attentat kritisch hinterfragt und zum Fazit kommt, dass "unser Weg nicht von Leichen gepflastert sein darf". Ins öffentliche Bewusstsein drang der schnoddrige Text damals freilich nur durch den Ausdruck der "klammheimlichen Freude" über das Attentat, die der Autor zu Beginn des Textes formulierte - um sie dann im weiteren Text als unangemessen zu entlarven.
Auch wenn aus dem Pamphlet nicht viel Menschenfreundlichkeit spricht - der Shitstorm, der daraufhin in der analogen Öffentlichkeit ausbrach, die öffentliche Hinrichtung des Autors als eines Unterstützers von Terroristen, war durch nichts gerechtfertigt. Die Denunziation wurde möglich, weil die Zeitungen parteiisch berichteten und nur Halbsätze zitierten. Der Höhepunkt der Affäre: Professoren aus der ganzen Republik, die den Text gemeinsam in voller Länge publizierten, um den studentischen Autor mit dem Decknamen "Mescalero" gegen die Angriffe zu schützen, wurden von ihren Arbeitgebern, den Kultusministerien der Bundesländer, heftig attackiert; einzelne - etwa der Psychologieprofessor Peter Brückner - mussten zeitweilig sogar ihre Suspendierung hinnehmen.
Heute dagegen kann ein Jan Böhmermann den türkischen Präsidenten in einem als Satire bezeichneten Gedicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einen "Ziegenficker" nennen und wenn er sich deswegen eine Beleidigungsklage einfängt, dann kommt ihm nicht nur der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns, der Journalist Matthias Döpfner zuhilfe, der sich jede seiner inkriminierten Äußerungen ausdrücklich auch juristisch zu eigen macht, sondern auch ein Bundestagsabgeordneter der CDU, der die umstrittene Satire gleich vollständig im Plenum des Bundestages vorträgt.
Der Gegensatz zwischen den siebziger Jahren und heute könnte kaum als größer beschrieben werden, als er sich in einer Reflexion über den unterschiedlichen Umgang mit diesen beiden Texten in der Öffentlichkeit zeigt.
Aber die siebziger Jahre waren eben nicht nur durch eine kurze Periode des Gesinnungsterrors geprägt, dem die taz ihre Gründung als Versuch einer Gegenöffentlichkeit verdankte - eine Funktion, die sie bis heute einzunehmen behauptet, auch wenn der Gesinnungsterror von damals längst verschwunden ist. Als die Zeitung sich gründete, kam viel zusammen. Die Achtundsechziger fragten sich, was machen wir nach dem Ende der Studentenbewegung? Die Kultur der WGs löste sich in Frankfurt schon auf, genauso wie die Hausbesetzerbewegung. Berlin hatte sie noch vor sich. Ich selbst war gerade mal dreiundzwanzig, ein nachholender 68er, hatte die Schule abgebrochen, war in West-Berlin auf der Flucht vorm Militärdienst gestrandet und arbeitete in einer linken Buchhandlung. Aufgewachsen bin ich in der niedersächsischen Provinz, in der die Zeit vor Achtundsechzig irgendwie stehen geblieben war - auch noch Anfang der siebziger Jahre. Als Zeitungsbote verdiente ich mir, noch Schüler, das erste Geld und lieferte immer Montags den Spiegel vom Buchhändler aus - in verschlossenen Umschlägen an die Abonnenten persönlich abzugeben, wie ein Pornoheft, mit dem man lieber nicht öffentlich erwischt werden wollte. Womöglich um nicht gleich in den Ruf des "Vaterlandsverräters" zu geraten, wie einst Herausgeber Rudolf Augstein. Das war Anfang der siebziger Jahre auch noch bundesdeutsche Wirklichkeit - zumindest in der Provinz. Von der RAF hörte ich vermutlich zum ersten Mal, als Baader und Co. in Frankfurt verhaftet wurden.
Denn die siebziger Jahre waren vor allem auch eine Zeit der Ungleichzeitigkeit. In der taz versammelte sie sich. Vom linken Buchhändler bis zum Adorno-Doktoranden Arno Widmann. Er kam zusammen mit Frank Berberich aus Frankfurt. Sie waren individualistische, philosophisch geschulte Intellektuelle. Sie wohnten erst einmal im wörtlichen Sinne zwei Monate in der Redaktion. Lagerten nachts auf Matratzen und spielten nach Redaktionsschluss im Keller Tischtennis. Arno, das Sprachengenie, verschwand immer mittags zum Bahnhof Zoo und versorgte sich und uns mit der internationalen Presse. Mancher Essay wurde dann schnell noch übersetzt und ins Blatt gehievt. Copyright-Gesetze kannten wir nicht. Arno konnte fließend englische, französische, italienische, spanische und portugiesische Zeitungen lesen und übersetzen, kannte sich in Lateinamerika aus und hatte andererseits eher eine philosophische Haltung zur Revolution und zur APO. Am Mieterkampf war er weniger interessiert als an moralphilosophischen Abhandlungen von Jean-Paul Sartre. Auf Demos hat man ihn eher nicht angetroffen, dafür hatte er bald die größte Bibliothek. Der andere Teil der taz kam vom OSI. Frustrierte Studenten, die genervt waren von den dort inzwischen lehrenden Achtundsechziger-Professoren, die sie mit dem "Kapital" von Karl Marx schuriegelten oder versuchten, die Demokratie als Schein zu entlarven. Diese Generation OSI wollte endlich auf die Wirklichkeit losgelassen werden und landete in der taz.
Es waren zwei Schulen der Linken. Die Frankfurter und die Berliner, das war mehr als eine geografische Distanz. Es waren auch zwei Generationen, selbst wenn sie nur wenige Jahre voneinander trennten. Während die meisten Berliner tazler dem Otto-Suhr-Institut für politische Wissenschaften an der Freien Universität entflohen und sich die nächsten zehn Jahre mit Häuserkampf, den Nachwehen der RAF , der Unterstützung dubioser Revolutionsbewegungen in Lateinamerika beschäftigten oder mit dem Weltuntergangsszenario von Nachrüstung, Kriegsgefahr oder mindestens explodierenden Atomkraftwerken, hatten die Frankfurter längst eine kritische Distanz zu dieser Art von Linken. Meine Sympathie galt eher den Frankfurtern. Sie waren weltoffener, undogmatischer, witziger, lebendiger und nicht so linkshaberisch wie die Berliner abgebrochenen Studenten. Ein ehemaliger OSI-Assistent war auch dabei.
Nirgendwo wird die Differenz so deutlich, wie am ersten Titelbild der ersten täglichen taz, das von beiden "Schulen" bis heute verschieden interpretiert wird. Ein Clown, der mit einem Stein zum Wurf ansetzt, auf dem die drei Buchstaben taz eingraviert sind. Dieser Clown sollte die Skepsis gegenüber der Linken symbolisieren genauso wie gegenüber sich selbst. Er tänzelte eher mit dem Stein, als dass er ihn warf. Und ob der Stein überhaupt zum Werfen taugte, die Zweifel daran waren ins Gesicht des Clowns geschminkt. Skepsis statt Revolution. Es war ein "Frankfurter", der dieses Bild ausgewählt hatte und der es bis heute so interpretiert. Doch durchgesetzt haben sich in der Zeitung die "Berliner" mit ihrer fragwürdigen Waffen-für-El-Salvador-Kampagnen-Ästhetik und dem voluntaristischen Revolutionsgehabe einer Hausbesetzerbewegung, die den Clown als Symbol für den spielerischen Umgang mit der Gewalt viel zu lange noch hoch hielt und diverse Unterstützergruppen der RAF gewähren ließ, wenn sie die Redaktionsräume besetzten.
Parallel zur Gründung der taz entstanden die Grünen mit ähnlichen Gründungsmythen und Irrungen und Wirrungen. Partei oder Zeitung? Beide hatten eine ähnliche Geschichte und kleben irgendwie in den Siebziger Jahren fest. Wer heute alt genug ist und ein Interview mit Jürgen Trittin im Spiegel liest, denkt immer noch "KB-Nord" und "Arbeiterkampf". Derselbe Polit-Sound. Während die Grünen als Partei reüssierten und in fast allen Landesregierungen schon mal vertreten waren oder sind und sogar mehr als eine Legislaturperiode im Bund mitregierten, führt die taz immer noch ein Dasein als Mauerblümchen. Zumindest was die Auflage betrifft: Sie stieg nie wesentlich über die 60.000. Und in Berlin selbst hat sie kaum mehr als 5.000 Käufer, zu Mauerzeiten genauso wie danach. Und doch ist sie stilbildend geworden für die mediale Öffentlichkeit in Deutschland, genauso wie die Grünen für die Parteien. Gemessen an der Hegemonie der linksalternativen Kultur im Land müsste sich ihre Haltung ähnlich ändern wie die der Grünen. Doch sie bleibt vielleicht sogar stärker noch als die Öko-Partei in der Endlosschleife eines Oppositionsgestus, einer Minderheitenkultur verhaftet, der an die siebziger Jahre erinnert.
Daran hat auch die deutsche Einheit nichts geändert. Im Gegenteil: Mit dem Phantom der sozialen Gleichheit wurde der Osten schnell mit integriert. Der höhere Begriff der Freiheit hat sich nicht gegenüber der Gleichheit durchgesetzt. In der taz wurde die Diskussion darüber jedenfalls nur rudimentär in den ganz frühen Jahren, lange vor dem Mauerfall, geführt.
Gestritten wurde im grünlinken Milieu auch nicht über Habermas' Kommentierung der deutschen Einheit als DM-Nationalismus und die Frage, was es eigentlich bedeutet, wenn Deutschland zum ersten Mal in unserer politischen Zeitspanne souverän wird. Stattdessen setzte sich eine illusionistische Europaseligkeit durch, in der so etwas wie "nationale Interessen" nicht vorkamen.
Wenn aus einer Minderheitskultur der Mainstream wird, dann ändert sich auch die Verantwortung gegenüber Nichtgrünen, gegenüber dem Gemeinwohl. Die taz müsste genauso wie die Grünen ihre Klientel längst auch auf die Möglichkeit einer Koalition mit der CDU im Bund einstimmen, um so wieder in die Nähe der Macht zu gelangen, statt auf ein rot-rot-grünes Bündnis von gestern zu schielen, für das es weit und breit keine Mehrheit gibt.
Es hat in den siebziger Jahren bis weit in die Achtziger Jahre hinein Spaß gemacht, durch gezielte Provokationen die Öffentlichkeit aus einer Minderheitenecke heraus aufzumischen. Arno Widmann ist ein Meister darin gewesen.
Noch im Jahr 1979 gab er Rudi Dutschke seine Bonner Akkreditierung, um ihn bei einer Pressekonferenz des chinesischen Staatschefs Hua Guofeng zusammen mit Bundeskanzler Helmut Schmidt drei Fragen zur Situation von Menschenrechtsverletzungen und Dissidenten in der Volksrepublik stellen zu lassen. Natürlich flog Rudi Dutschke hochkant raus, aber die Presse folgte ihm, und seine in Anklagen umgewandelten Fragen schafften es bis in die New York Times.
Dass Arno sich dreißig Jahre später dafür in einer Kolumne in der Berliner Zeitung schämte, weil ihm damals nicht klar war, wie anstrengend diese Aktion für Rudi Dutschke war, der immer noch an der Attentatsverletzung im Kopf litt, und zwei Monate später daran starb, rührte mich zutiefst. Unerreicht seine Rubrik auf der Seite 2: "Was fehlt" und die Dichter-taz.
Der Spaß an der Provokation war ansteckend: Der Brief der Braunmühl-Brüder an die Mörder ihres Bruders von der RAF, Das gefälschte Neue Deutschland zum Honecker-Besuch in Bonn mit der Schlagzeile: "Erich, nimm uns mit" zwei Jahre vor dem Mauerfall. Doch diese Spaßzeiten waren spätestens mit der friedlichen Revolution 1989 auch für die taz vorbei.
Zum Aufbau des wiedervereinigten Deutschland hat sie keine Haltung entwickelt - warum eigentlich nicht? Wahrscheinlich mehr als ein Symptom, das die meisten kreativen Köpfe der ersten Generation spätestens um 1990/91 die taz verließen.
Welche Rolle aber müsste eine Zeitung der Gegenöffentlichkeit heute spielen, wo der Mainstream grün-rot ist, im Sommer 2016, anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl? Arno, hast Du eine Idee?
Kommentieren