Gottlos, roh und unschicklich
 Fotolot 14.03.2019 Mit den Bildern wird es immer schwieriger: Wer über Fotobücher, Ausstellungen oder KünstlerInnen schreibt, kann die Artikel kaum mehr illustrieren. Pressestellen geben fast nur unverfängliches Material heraus, Heikleres soll lieber nicht gezeigt werden. Bildrechte blockieren die Auseinandersetzung mit Kunst. Und dann stellt sich noch die Geldfrage. Von Peter Truschner
Fotolot 14.03.2019 Mit den Bildern wird es immer schwieriger: Wer über Fotobücher, Ausstellungen oder KünstlerInnen schreibt, kann die Artikel kaum mehr illustrieren. Pressestellen geben fast nur unverfängliches Material heraus, Heikleres soll lieber nicht gezeigt werden. Bildrechte blockieren die Auseinandersetzung mit Kunst. Und dann stellt sich noch die Geldfrage. Von Peter Truschner





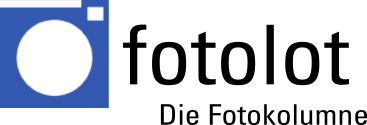
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e) Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Leila Slimani: Trag das Feuer weiter