Aufgenommen und abgestellt
 Fotolot 11.12.2020 Drei Fotobücher zeichnen präzise Porträts eines sozialen Milieus: Über Jindrich Streits einst verbotene Expeditionen in den real existierenden Sozialismus. Sibylle Fendts empathische Zwiesprache mit allein gelassenen Flüchtlingen in einem Schwarwaldtal und Claudia Reinhardts diskreten Blick in die Stuben deutscher Witwen. Von Peter Truschner
Fotolot 11.12.2020 Drei Fotobücher zeichnen präzise Porträts eines sozialen Milieus: Über Jindrich Streits einst verbotene Expeditionen in den real existierenden Sozialismus. Sibylle Fendts empathische Zwiesprache mit allein gelassenen Flüchtlingen in einem Schwarwaldtal und Claudia Reinhardts diskreten Blick in die Stuben deutscher Witwen. Von Peter Truschner





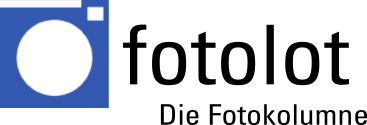
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e) Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen
Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen Leila Slimani: Trag das Feuer weiter
Leila Slimani: Trag das Feuer weiter