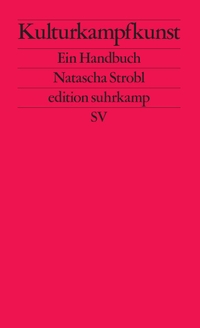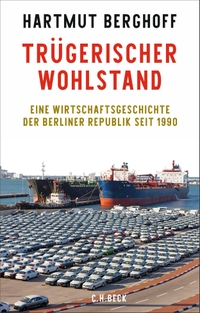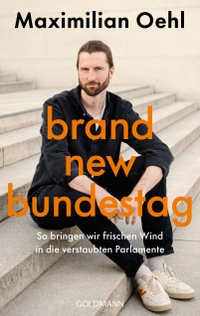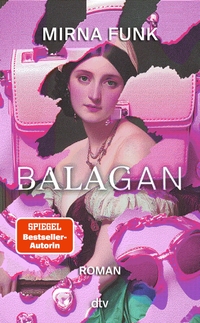Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
04.07.2006. The Nation erklärt, wie man einen linken Bestseller macht. Im Espresso rechnet Andrzej Stasiuk mit katholischen Kommunisten und kommunistischen Faschisten in Polen ab. Der Economist sieht das Paradies. Folio erforscht die Schotten. Polityka sieht tausend kleine Spielbergs. Il Foglio stellt den indischen Giovanni Agnelli vor. Wired besucht Rupert Murdoch. Das du-Magazin begibt sich nach Sankt Moritz. Im Merkur erkennt Volker Gerhardt das wahre Glück in der Säkularisierung. In Liberation sorgt sich Serge July um die Zukunft der Zeitungen. Für den Spectator haben die Bomben der Islamisten vor allem ein Ziel: die Demokratie. Im New Yorker erklärt Seymour Hersh, warum die amerikanischen Militärs den Iran nicht angreifen möchten.
The Nation | Rivista dei Libri | Polityka | Liberation | Spectator | Wired | DU | Al Ahram Weekly | Weltwoche | New Yorker | Outlook India | London Review of Books | Espresso | Economist | Folio | Magyar Lettre International | Foglio | Merkur
The Nation (USA), 17.07.2006
 Jennifer Nix erzählt, wie man es in den USA schafft, in drei Monaten einen linken Bestseller zu lancieren. Man muss nur aufmerksam die Blogs lesen und sich Talente schnappen! Wie den Staatsrechtler Glenn Greenwald, der in seinem Blog "Unclaimed Territory" gegen die Aushöhlung amerikanischer Grundrechte anschreibt. "Am 15. Februar fragte ich Greenwald, ob er nicht ein Buch herausbringen wollte. Working Asset (ein linkes Kreditkartenunternehmen mit dem Slogan "shop for change") erklärte sich bereit, das Projekt zu finanzieren, und rief Working Assets Publishing ins Leben. Am 1. März hatten wir einen Vertrag mit Greenwald. Wir brauchten allerdings noch eine Druckerei, einen Vertrieb und ein Lektorenteam, was alles von einer schnell ins Leben gerufenen Verlagsabteilung bei Working Asset in San Francisco organisiert wurde. Nach einigen sehr langen Tagen, lieferten wir das Buch am 24. April in der Druckerei ab. Am Tag zuvor hatte ich digitale Manuskripte an sieben Blogger versandt, mit denen ich öfter zusammenarbeite, und bat sie, über das Buch zu schreiben, wenn sie es denn wert fänden. Innerhalb von Tagen stieg 'How would a Patriot act?' aus der Obskurität auf Platz eins bei Amazon, vor allem weil die ersten Blogs ein Lauffeuer von Erwähnungen und Links in der Blogosphäre in Gang setzten. Dies sandte Schockwellen durch die progressiven Verlagskreise und weckte bei Buchläden im ganzen Land Interesse. Das Erscheinungsdatum des Buchs war der 15,. Mai und seit dem steht es auf den Bestsellerlisten der Washington Post und der New York Times."
Jennifer Nix erzählt, wie man es in den USA schafft, in drei Monaten einen linken Bestseller zu lancieren. Man muss nur aufmerksam die Blogs lesen und sich Talente schnappen! Wie den Staatsrechtler Glenn Greenwald, der in seinem Blog "Unclaimed Territory" gegen die Aushöhlung amerikanischer Grundrechte anschreibt. "Am 15. Februar fragte ich Greenwald, ob er nicht ein Buch herausbringen wollte. Working Asset (ein linkes Kreditkartenunternehmen mit dem Slogan "shop for change") erklärte sich bereit, das Projekt zu finanzieren, und rief Working Assets Publishing ins Leben. Am 1. März hatten wir einen Vertrag mit Greenwald. Wir brauchten allerdings noch eine Druckerei, einen Vertrieb und ein Lektorenteam, was alles von einer schnell ins Leben gerufenen Verlagsabteilung bei Working Asset in San Francisco organisiert wurde. Nach einigen sehr langen Tagen, lieferten wir das Buch am 24. April in der Druckerei ab. Am Tag zuvor hatte ich digitale Manuskripte an sieben Blogger versandt, mit denen ich öfter zusammenarbeite, und bat sie, über das Buch zu schreiben, wenn sie es denn wert fänden. Innerhalb von Tagen stieg 'How would a Patriot act?' aus der Obskurität auf Platz eins bei Amazon, vor allem weil die ersten Blogs ein Lauffeuer von Erwähnungen und Links in der Blogosphäre in Gang setzten. Dies sandte Schockwellen durch die progressiven Verlagskreise und weckte bei Buchläden im ganzen Land Interesse. Das Erscheinungsdatum des Buchs war der 15,. Mai und seit dem steht es auf den Bestsellerlisten der Washington Post und der New York Times." Outlook India (Indien), 10.07.2006
 Juden in Bombay? Die gibt es. Payal Kapadia erzählt von der etwas anderen Diaspora der knapp 5.000, vor allem in Bombay lebenden indischen Juden - den Bene-Israelis und den so genannten Bagdad Juden, die im 18. Jahrhundert aus dem Irak kamen - und dass das Jüdische andere Identifikationsmöglichkeiten bietet als die Verfolgung: Diese Menschen "haben die schreckliche Erfahrung des Holocaust nicht gemacht noch wirklich begriffen. Macht sie das weniger jüdisch? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil stellt es die Vorstellung vom geschlossenen, verfolgten Volk auf den Kopf."
Juden in Bombay? Die gibt es. Payal Kapadia erzählt von der etwas anderen Diaspora der knapp 5.000, vor allem in Bombay lebenden indischen Juden - den Bene-Israelis und den so genannten Bagdad Juden, die im 18. Jahrhundert aus dem Irak kamen - und dass das Jüdische andere Identifikationsmöglichkeiten bietet als die Verfolgung: Diese Menschen "haben die schreckliche Erfahrung des Holocaust nicht gemacht noch wirklich begriffen. Macht sie das weniger jüdisch? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil stellt es die Vorstellung vom geschlossenen, verfolgten Volk auf den Kopf."Ferner: Pramila N. Phatarphekar führt durch das wieder eröffnete Küchen-Museum in Neu-Delhi, das Tafelsilber und Picknickkörbe der königlich-britischen Besatzer zeigt. Und Mahmood Farooqui bespricht zwei Bücher ("The Black Hole: Money, Myth and Empire" von Jan Dalley und "The Corporation that Changed the World" über die Ostindien-Kompanie von Nick Robbins), die das Raj ins genuin britische Visier fassen.
London Review of Books (UK), 06.07.2006
 Michael Wood ist absolut begeistert von dem von Adam Philipps herausgegebenen "Penguin Freud Reader", der Freuds Denken und Schreiben in all seiner komplexen Hintergründigkeit zum Vorschein bringt - und allzu schematische Freud-Lesarten als Klischees überführt: "Ich weiß, dass Sie Ja meinen, weil Sie zu nachdrücklich Nein gesagt haben. Ach, Sie haben es also nicht nachdrücklich gesagt? Dann muss ich wohl den Nachdruck gehört haben, den Sie verbergen wollten. - Nein wird als Antwort einfach nicht akzeptiert, wie es so schön heißt."
Michael Wood ist absolut begeistert von dem von Adam Philipps herausgegebenen "Penguin Freud Reader", der Freuds Denken und Schreiben in all seiner komplexen Hintergründigkeit zum Vorschein bringt - und allzu schematische Freud-Lesarten als Klischees überführt: "Ich weiß, dass Sie Ja meinen, weil Sie zu nachdrücklich Nein gesagt haben. Ach, Sie haben es also nicht nachdrücklich gesagt? Dann muss ich wohl den Nachdruck gehört haben, den Sie verbergen wollten. - Nein wird als Antwort einfach nicht akzeptiert, wie es so schön heißt."Weitere Artikel: Grozny ein potemkinsches Dorf zu nennen, ist keine bloße Metapher, berichtet Anna Neistat aus der tschetschenischen Hauptstadt und warnt inständig davor, den russischen Verlautungen von einer Rückkehr zur Normalität Glauben zu schenken. Rosemary Hill begeht in Stonehenge die Sommersonnenwende, inmitten von Öko-Heiden, Punks und Druiden. Andrew O'Hagan lobt Margo Jefferson für ihr schonungslos klarsichtiges Porträt von Michael Jackson ("On Michael Jackson"). Und Peter Campbell hat in Howard Hodgkins Gemälden, denen die Tate Britain eine Ausstellung widmet, jene lustvolle, glückliche und "singende" Übereinstimmung von Farbe und Form gefunden, wie man sie aus der Natur kennt.
Espresso (Italien), 06.07.2006
 Das anachronistische Gebahren der polnischen Politikerriege hat seinen Ursprung in Pater Tadeusz Rydzyks Radio Maria, meint Andrzej Stasiuk in seiner bissigen Abrechnung mit Giertych, Lepper und den Kaczynski-Brüdern. "Rydzyk ist ein Produkt des Kommunismus. Denn es war der Kommunismus, der die polnische Realität über Jahrzehnte hinweg eingefroren hat. Als das Eis schmolz, kam das Leichenschauhaus der polnischen Vorkriegs-Ideologie zum Vorschein. Rydzyk tauchte auf, ein Zombie, eine Mischung aus dem primitiven Ultranationalismus vor dem Krieg und einer tribalen Parodie des Katholizismus. Und Roman Giertych mit seiner Allpolnischen Jugend kam hervor, ein Frankenstein, zusammengesetzt aus den verwesenden Körperteilen der faschistischen Aktionskommandos der Vorkriegszeit. Der eine wie der andere ist ziemlich haarsträubend aus moralischer Sicht, der eine wie der andere hat dank der konservativen Kräfte des Kommunismus überlebt. Der eine wie der andere blickt hoffnungsvoll auf das postsowjetische Russland, in dem er einen Verbündeten im Kampf gegen den liberalen Westen zu finden hofft."
Das anachronistische Gebahren der polnischen Politikerriege hat seinen Ursprung in Pater Tadeusz Rydzyks Radio Maria, meint Andrzej Stasiuk in seiner bissigen Abrechnung mit Giertych, Lepper und den Kaczynski-Brüdern. "Rydzyk ist ein Produkt des Kommunismus. Denn es war der Kommunismus, der die polnische Realität über Jahrzehnte hinweg eingefroren hat. Als das Eis schmolz, kam das Leichenschauhaus der polnischen Vorkriegs-Ideologie zum Vorschein. Rydzyk tauchte auf, ein Zombie, eine Mischung aus dem primitiven Ultranationalismus vor dem Krieg und einer tribalen Parodie des Katholizismus. Und Roman Giertych mit seiner Allpolnischen Jugend kam hervor, ein Frankenstein, zusammengesetzt aus den verwesenden Körperteilen der faschistischen Aktionskommandos der Vorkriegszeit. Der eine wie der andere ist ziemlich haarsträubend aus moralischer Sicht, der eine wie der andere hat dank der konservativen Kräfte des Kommunismus überlebt. Der eine wie der andere blickt hoffnungsvoll auf das postsowjetische Russland, in dem er einen Verbündeten im Kampf gegen den liberalen Westen zu finden hofft." Economist (UK), 30.06.2006
 Der Economist ist dem Paradies einen gehörigen Schritt näher gekommen, und das verdankt er Kevin Rushbys ausgezeichneter Kulturgeschichte des Paradieses ("Paradise: A History of the Idea that Rules the World") und Alessandro Scafis Studie zur Paradies-Kartografie ("Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth"). Dass Paradiesdarstellungen mit derselben geografischen Sorgfalt wie Navigationskarten erstellt wurden, mag heute verwundern, doch "den vormodernen Kartografen ging es um die Navigation der spirituellen, und nicht der säkulären Art. Sie versuchten, Zeit und Raum auf eine Weise darzustellen, die auch heute noch schön ist, die aber auch verblüfft. Ihre Karten zeigten Gott, die Geschichte und menschliche Freuden und Leiden, oftmals aus der Bibel. Der Garten Eden war ein wirklicher Ort, genauso wie Adam ein wirklicher Mensch war."
Der Economist ist dem Paradies einen gehörigen Schritt näher gekommen, und das verdankt er Kevin Rushbys ausgezeichneter Kulturgeschichte des Paradieses ("Paradise: A History of the Idea that Rules the World") und Alessandro Scafis Studie zur Paradies-Kartografie ("Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth"). Dass Paradiesdarstellungen mit derselben geografischen Sorgfalt wie Navigationskarten erstellt wurden, mag heute verwundern, doch "den vormodernen Kartografen ging es um die Navigation der spirituellen, und nicht der säkulären Art. Sie versuchten, Zeit und Raum auf eine Weise darzustellen, die auch heute noch schön ist, die aber auch verblüfft. Ihre Karten zeigten Gott, die Geschichte und menschliche Freuden und Leiden, oftmals aus der Bibel. Der Garten Eden war ein wirklicher Ort, genauso wie Adam ein wirklicher Mensch war."Außerdem zu lesen: Wie der Economist feststellen muss, ist die Demokratie im Nahen Osten schon wieder aus der Mode gekommen. Und schließlich erweist der Economist Barbara Epstein, der charismatischen Mitbegründerin und Herausgeberin der New York Review of Books, im Nachruf die letzte Ehre.
Folio (Schweiz), 03.07.2006
 Wieder so eine Ausgabe, an der man sich festliest! Diesmal geht es im Folio um Schottland. Allan Brown liefert ein kleines Glossar zu treffenden und unzutreffenden Klischees: "Über Malzwhisky wird viel Unsinn erzählt, etwa dass er sich je nach der Gegend seiner Destillation im Geschmack unterscheide. Dies hat die hochfahrende Vorstellung genährt, Whisky sei ebenso komplex wie guter Wein und wahre Kenner könnten in einer Probe Bowmore, Glenfiddich, Lagavulin oder Talisker Spuren von Schokolade, Eiche, Lakritz oder Seife entdecken. In Wirklichkeit wollen sie sich nur wichtig machen." Und zum Stichwort "Engländer" schreibt er: "Man nimmt allgemein an, dass die Schotten ihre Nachbarn aufgrund jahrhundertealter militärischer Streitigkeiten und neuerdings auch wegen des politischen Desinteresses in Westminster bis aufs Blut hassen. Diese Annahme ist richtig."
Wieder so eine Ausgabe, an der man sich festliest! Diesmal geht es im Folio um Schottland. Allan Brown liefert ein kleines Glossar zu treffenden und unzutreffenden Klischees: "Über Malzwhisky wird viel Unsinn erzählt, etwa dass er sich je nach der Gegend seiner Destillation im Geschmack unterscheide. Dies hat die hochfahrende Vorstellung genährt, Whisky sei ebenso komplex wie guter Wein und wahre Kenner könnten in einer Probe Bowmore, Glenfiddich, Lagavulin oder Talisker Spuren von Schokolade, Eiche, Lakritz oder Seife entdecken. In Wirklichkeit wollen sie sich nur wichtig machen." Und zum Stichwort "Engländer" schreibt er: "Man nimmt allgemein an, dass die Schotten ihre Nachbarn aufgrund jahrhundertealter militärischer Streitigkeiten und neuerdings auch wegen des politischen Desinteresses in Westminster bis aufs Blut hassen. Diese Annahme ist richtig."Mikael Krogerus gibt einen anschaulichen Bericht aus Europas Hauptstadt der Morde und Messer - aus Glasgow: "Die Jungs schauen mich an. Wir sind 20 Meter voneinander entfernt, ich werde nervös. Soll ich umkehren? Wegrennen? Meine Schritte werden langsamer, ihre schneller. Ich bleibe stehen. Der mittlere bellt etwas zur Begrüßung: 'Haaaw, you, giiies fägg!' Er spricht Glasgower Dialekt, ich verstehe kein Wort. Die beiden anderen kichern und tauschen Blicke aus, ihre Gesichter sehen seltsam alt aus. Der mittlere nimmt einen Schritt auf mich zu, ich weiche zurück. Alle drei sprechen jetzt durcheinander, die Angst lärmt in meinem Kopf: Ich könnte ihnen mein Portemonnaie geben. Oder ich könnte mich wehren. Ich bin einen Kopf größer als der mittlere... Aus den Augenwinkeln sehe ich einen Mann, der kurz zu uns herüberblickt, dann weitergeht. Mit lauter Stimme sage ich: 'Ich bin Journalist', es klingt schwächlich. Es ist mein erster Abend in Glasgow. Und ich habe Angst vor 11-Jährigen." (Vielleicht wollten die Jungs nur eine Zigarette?)
Weiteres: Rohland Schuknecht begibt sich auf die Highland-Halbinsel Knoydart, wo man sich noch die Zeit mit Gummistiefelweitwurf und Hirschhodenjagd vertreibt. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Schotten nimmt Andreas Heller nicht allzu ernst: "Sie kommen nicht vom britischen Empire los, weil sie dann nicht mehr davon träumen können, wie wunderbar es wäre, unabhängig zu sein." Harald Willenbrock erzählt die Geschichte der Royal Bank of Scotland, die inzwischen zur sechstgrößten Bank der Welt aufgestiegen ist. Liliane Lerch porträtiert den Late-Night-Star Craig Ferguson.
Und Luca Turin trauert in seiner "Duftnote" der guten alten Zeit nach, als es noch keine Verträglichkeitsprüfungen für Parfümstoffe gab. Doch dann wies ihn ein Kollege "auf einen neuen Moschusduft namens Musk KS von Grau Aromatics hin, der (natürlich) aus Deutschland kommt. Ich bestellte ein Muster und war verblüfft: kraftvoll, erdig, unvergleichlich. Dann betrachtete ich die chemische Struktur. Das Molekül enthält zwei Bromatome und eine Nitritgruppe - alles Stoffe, die jedem Schreibtischwächter den Schweiß auf die Stirn treiben. Aber Grau hat es hergestellt, geprüft und schickt sich nun an, es zu verkaufen. Gott segne sie."
Magyar Lettre International (Ungarn), 03.07.2006
 Abgedruckt ist ein Auszug aus dem autobiografischen Essay "Emigrationsübungen" des Theaterwissenschaftlers und Essayisten Dragan Klaic, der die Geschichte des mehrfachen Exils einer jüdischen Familie erzählt. "Die Muttersprache meiner Mutter war Serbokroatisch, das sie im Dialekt von Sarajewo sprach. Dieses Idiom wird heute offiziell 'bosnische Sprache' genannt. Ihre Eltern sprachen auch Deutsch, Polnisch und Jiddisch zu Hause. Meine Eltern sprachen Serbokroatisch und Ungarisch mit uns, Kindern.... Mit der Mehrsprachigkeit in der Familie habe ich die Logik des Übersiedelns, der Mobilität eingeatmet. Sprachliche Unvollkommenheit kam mir nie negativ, sondern normal vor. Heute noch, bei uns zu Hause in Amsterdam sprechen wir Serbokroatisch, Ungarisch, Englisch oder Niederländisch miteinander." (Mindestens Deutsch und Französisch spricht er außerdem noch.)
Abgedruckt ist ein Auszug aus dem autobiografischen Essay "Emigrationsübungen" des Theaterwissenschaftlers und Essayisten Dragan Klaic, der die Geschichte des mehrfachen Exils einer jüdischen Familie erzählt. "Die Muttersprache meiner Mutter war Serbokroatisch, das sie im Dialekt von Sarajewo sprach. Dieses Idiom wird heute offiziell 'bosnische Sprache' genannt. Ihre Eltern sprachen auch Deutsch, Polnisch und Jiddisch zu Hause. Meine Eltern sprachen Serbokroatisch und Ungarisch mit uns, Kindern.... Mit der Mehrsprachigkeit in der Familie habe ich die Logik des Übersiedelns, der Mobilität eingeatmet. Sprachliche Unvollkommenheit kam mir nie negativ, sondern normal vor. Heute noch, bei uns zu Hause in Amsterdam sprechen wir Serbokroatisch, Ungarisch, Englisch oder Niederländisch miteinander." (Mindestens Deutsch und Französisch spricht er außerdem noch.)Die in Ungarn geborene, seit 1990 in Deutschland lebende und Deutsch schreibende Autorin Terezia Mora spricht im Interview mit Lidia Nadori, der Übersetzerin ihres Romans "Alle Tage", über die Auswirkungen einer Diktatur. "In nicht wenigen Familien, also im privaten - nicht im politischen oder im wirtschaftlichen - Raum wird alltäglich Gewalt angewandt. Das ist eine tief wurzelnde, von Generation auf Generation weitervererbte Gewalt; das empört mich sehr. Es ist zwar kein Honiglecken, die Kindheit in einer Diktatur verbringen zu müssen, trotzdem habe ich vor allem unter der Roheit meiner unmittelbaren Umwelt gelitten. Wir sind vom Erbarmen unserer Mitmenschen abhängig, besonders in unserer Kindheit." Das Problem habe auch einen politischen Aspekt: "Je emanzipierter eine Gesellschaft ist (was Frauen, Männer, Kinder, Bürger angeht), desto leichter können wir uns gegen die alltäglichen Grausamkeiten wehren. In meiner Kindheit spielte Toleranz - als unmittelbare Manifestation der Demokratie - im Alltag nicht einmal als Wort eine Rolle."
Foglio (Italien), 01.07.2006
Ugo Bertone stellt den indischen Giovanni Agnelli vor, der nun, siebzig Jahre nach dem Fiat Topolino, ein Volksauto für 2.000 Euro entwickeln lässt. "Ratan Tata, 68 Jahre alt, ein eleganter Herr von hohem Ansehen, der mit dem Stahlkönig Lakhsmi Mittal um den Titel als lebende Verkörperung des 'indischen Modells' ringt. Ein Tycoon, der an der Spitze der Tata-Gruppe steht, ein Gigant, der verteilt auf 91 Firmen 220.000 Leute beschäftigt und ein wenig von allem macht: Stahl, Chemie, Telekommunikation, biomedizinische Apparate und so weiter."
Marin Valensise trifft in Paris den Ethik- und Biotechnologieprofessor Gregory Katz Benichou und schmilzt dahin. "Stellen Sie sich einen europäischen Gregory Peck vor, aber ohne die Dreistigkeit." Das Gespräch dreht sich um ernüchterndere Themen wie die bald erschwingliche DNA-Vorselektion bei Embryos. "Plötzlich unterbricht er sich, hebt seinen Blick und gesteht mit einem Lächeln, das schließlich die Schüchternheit besiegt: 'Wenn man diesen genetischen Test an dem Embyro durchgeführt hätte, der ich vor 36 Jahren war, würde ich hier nicht sitzen und mit Ihnen reden... Es wäre mir nicht erlaubt worden, geboren zu werden, weil ich verdammt schlechte Chromosomen habe, ein furchtbares genetisches Erbe.'" (Das wäre wirklich schade gewesen!)
Weiteres: Maurizio Stefanini durchstreift literarische Landschaften, von Gabriel Garcia Marquez' Macondo (das vor kurzem fast real geworden wäre) bis zu Tolkiens Mittelerde. Der römische Esquilin wird zum chinesischen Viertel der ewigen Stadt, beobachtet Roberta Tatafiore.
Marin Valensise trifft in Paris den Ethik- und Biotechnologieprofessor Gregory Katz Benichou und schmilzt dahin. "Stellen Sie sich einen europäischen Gregory Peck vor, aber ohne die Dreistigkeit." Das Gespräch dreht sich um ernüchterndere Themen wie die bald erschwingliche DNA-Vorselektion bei Embryos. "Plötzlich unterbricht er sich, hebt seinen Blick und gesteht mit einem Lächeln, das schließlich die Schüchternheit besiegt: 'Wenn man diesen genetischen Test an dem Embyro durchgeführt hätte, der ich vor 36 Jahren war, würde ich hier nicht sitzen und mit Ihnen reden... Es wäre mir nicht erlaubt worden, geboren zu werden, weil ich verdammt schlechte Chromosomen habe, ein furchtbares genetisches Erbe.'" (Das wäre wirklich schade gewesen!)
Weiteres: Maurizio Stefanini durchstreift literarische Landschaften, von Gabriel Garcia Marquez' Macondo (das vor kurzem fast real geworden wäre) bis zu Tolkiens Mittelerde. Der römische Esquilin wird zum chinesischen Viertel der ewigen Stadt, beobachtet Roberta Tatafiore.
Merkur (Deutschland), 01.07.2006
Der Philosoph Volker Gerhardt kann der neuen Religiösität unter dem Druck des Terrors nichts abgewinnen. Auch wenn er der Religion eine "antitotalitäre Erosionskraft" nicht absprechen will, erkennt er das wahre Glück jedoch in der Säkularisierung, in der durchgängig auf die Rechte des Individuums gegründeten Politik. "Die Säkularisierung ist den europäischen Kirchen nicht erspart geblieben, und niemand kann sie den anderen Glaubensgemeinschaften vorenthalten. Dass sie sich weltweit ereignet, beruht nicht auf dem missionarischen Mutwillen der Europäer oder der Amerikaner. Dagegen ließen sich Kriege führen! Es ist aber so, dass sich die Menschen weltweit selbst zur Teilnahme an den globalen Prozessen entscheiden. Deshalb müssen sie den Weg der säkularen Ernüchterung gehen und Politik nach den Regeln machen, die sich im Prozess einer mehrtausendjährigen Entwicklung von der Institution zu deren Autonomie und Konstitution entwickelt haben."
Weiteres: In einer Marginalie verarbeitet Marc Degens noch die Niederlage der Franzosen bei der WM 1982 gegen Deutschland im Elfmeterschießen. Der frühere Tagesspiegel-Herausgeber Hermann Rudolph rekapituliert die Hautstadtwerdung Berlins. Michael Rutschky erzählt von der neuen Boheme, in der sich heute heute eher Informationstechnologen tummeln als Künstler. Dirk Knipphals verabschiedet die deutsche Mutter als "emotionales Mängelwesen". Tim Harford beschreibt am Beispiel Kameruns, wie die Kleptokratie an der Spitze die armen Länder arm bleiben lässt.
Weiteres: In einer Marginalie verarbeitet Marc Degens noch die Niederlage der Franzosen bei der WM 1982 gegen Deutschland im Elfmeterschießen. Der frühere Tagesspiegel-Herausgeber Hermann Rudolph rekapituliert die Hautstadtwerdung Berlins. Michael Rutschky erzählt von der neuen Boheme, in der sich heute heute eher Informationstechnologen tummeln als Künstler. Dirk Knipphals verabschiedet die deutsche Mutter als "emotionales Mängelwesen". Tim Harford beschreibt am Beispiel Kameruns, wie die Kleptokratie an der Spitze die armen Länder arm bleiben lässt.
Rivista dei Libri (Italien), 01.07.2006
Der Gehirnforscher Giacomo Rizzolatti gilt nicht nur als Entdecker der Spiegelneuronen, er hat auch ein hervorragendes Buch darüber geschrieben, meint Luciano Mecacci, der die Aufgabe dieser Spezialzellen an einem Beispiel aus dem Alltag erklärt. "Ich esse zu Mittag und vor mir sind die Spaghetti in der Schüssel. Ich habe einen Löffel und eine Gabel, über deren Gebrauch ich Bescheid weiß, und ich wähle die Gabel. Ich weiß wie ich die Gabel anwende und wie ich sie bewegen muss, um die Spaghetti zu essen. Wenn ich etwas Käse möchte, greife ich zum Löffel und streue den Käse über die Nudeln. Die Objekte werden dank des visuellen Systems erkannt (natürlich könnte ich sie auch blind unterscheiden), aber der Akt des Erkennens reicht nicht aus. In dem Moment, in dem ich die Gabel und den Löffel erkenne, weiß ich auch, zu was sie gut sind, wie ich sie benutzen muss, um das zu erreichen, was ich will. Die Neuronen des visuellen Systems (der hintere Teil der Gehirnrinde) sind darauf spezialisiert, Formen zu unterscheiden, aber wenn es darum geht, ein Objekt mit einem Verwendungszweck zu verknüpfen, braucht man diverse andere Klassen von Neuronen." Im vielseitigeren Deutschland werden sogar Messer als potenzielles Spaghetti-Besteck erkannt.
Polityka (Polen), 01.07.2006
 "Heute kann jeder ein Spielberg sein. Für tausend Dollar", behauptet der Medienexperte Edwin Bendyk. Dank Internetforen, Blogs und Seiten wie youtube.com ("Broadcast yourself") kann jeder Filme drehen und im Netz veröffentlichen. Die Welt der Politik reagiert wie immer sehr langsam auf solche Phänomene, die Institutionen wie den Fernsehrat obsolet machen. "Für Nicht-Eingeweihte erscheint das Internet wie ein großer Abfallkorb, wo sich nichts Wertvolles finden lässt. Dabei wissen Nutzer, dass in dieser Welt eine eigene Ordnung herrscht, die durch pausenlose Kommunikation untereinander entsteht. Schlechte Filme haben da keine Chance, weil sie niemand weiterempfiehlt." Bendyk (der selbst ein Blog führt) resümiert: Für die traditionellen Medien, z.B. das Fernsehen, bedeutet dies noch nicht das Ende. Nur ist das jetzt ein Medium unter vielen, das im Netz weiter verwertet wird."
"Heute kann jeder ein Spielberg sein. Für tausend Dollar", behauptet der Medienexperte Edwin Bendyk. Dank Internetforen, Blogs und Seiten wie youtube.com ("Broadcast yourself") kann jeder Filme drehen und im Netz veröffentlichen. Die Welt der Politik reagiert wie immer sehr langsam auf solche Phänomene, die Institutionen wie den Fernsehrat obsolet machen. "Für Nicht-Eingeweihte erscheint das Internet wie ein großer Abfallkorb, wo sich nichts Wertvolles finden lässt. Dabei wissen Nutzer, dass in dieser Welt eine eigene Ordnung herrscht, die durch pausenlose Kommunikation untereinander entsteht. Schlechte Filme haben da keine Chance, weil sie niemand weiterempfiehlt." Bendyk (der selbst ein Blog führt) resümiert: Für die traditionellen Medien, z.B. das Fernsehen, bedeutet dies noch nicht das Ende. Nur ist das jetzt ein Medium unter vielen, das im Netz weiter verwertet wird."In Polen ist wieder ein Streit um die Bewertung der kommunistischen Vergangenheit entbrannt. Nachdem die populäre Finanzministerin Zyta Gilowska aufgrund von Vorwürfen wegen angeblicher Stasi-Mitarbeit zurücktreten musste, diagnostizieren die Publizisten Mariusz Janicki und Wladysla Wladyka: "Für die regierende PiS ist jeder suspekt, der in der Volksrepublik nicht auf persönliches Glück, Familie, Karriere und kleine Bequemlichkeiten verzichtet hat - so wie Jaroslaw Kaczynski". Dabei seien doch alle irgendwie Komplizen gewesen. "Man las Bücher, die zensiert waren; man nahm Urlaub im staatlichen Erholungsheim in Anspruch; musste sich den Pass erschleichen. Das ganze Leben war eine große Matrix, in der nichts so war, wie es sich nach außen gab". Vom Ideal des einsamen Untergrundkämpfers auszugehen, und alles andere zu verdammen, sei töricht und gegen die Meinung der Mehrheit, so die Autoren. Stattdessen sollte man stolz sein auf das Erreichte nach 1989.
Der nächste Literaturnobelpreisträger? Ist doch klar! Haruki Murakami! Nicht nur, weil er in diesem Jahr den Kafka-Preis bekommen hat - so wie Elfriede Jelinek 2004 und Harold Pinter 2005. Auch, und vor allem, schreibt Aleksander Kaczorowski, "weil er so gar nicht der japanischen Tradition entspricht. Seine Helden sind keine fanatischen Workaholics. Es sind Individualisten, die versuchen, so wenig wie möglich mit der Welt des Business, der Politik und der Werbung in Berührung zu kommen."
Liberation (Frankreich), 30.06.2006
Nach 33 Jahren verlässt der charismatische Herausgeber Serge July die von ihm mitbegründete Zeitung Liberation. In seinem letzten Artikel für die Zeitung erklärt er, warum er diesen Schritt tut. Hintergrund ist ein Streit mit Edouard de Rothschild, der inzwischen einen großen Teil der Holding besitzt. July denkt in seinem Artikel auch über die Internetrevolution nach und macht sich Sorgen über die französischen Zeitungen insgesamt: "Die überregionale Informationspresse ist seit Jahren das fragilste aller Medien. Keine einzige Qualitätszeitung macht zur Zeit Gewinne. Dabei ist dieses Medium für das demokratische Leben unverzichtbar, ja, häufig ist es das Medium, aus dem sich all anderen Medien nähren, die Werkstatt der Reflexion und nationalen Debatte. Aber in seiner bisherigen Form ist es ökonomisch nicht mehr haltbar: Es muss finanziell durch externe profitable Aktivitäten gestützt werden."
Spectator (UK), 01.07.2006
 Ein Jahr nach den Bombenanschlägen in London widerspricht Philip Bobbitt Ansichten, nach denen die Anschläge eine Reaktion auf den Irakkrieg oder die gescheiterte Integration von Muslimen gewesen seien: "Bei den Anschlägen ging es, ganz einfach, um Demokratie. Werden demokratisch gewählte Regierungen in der Lage sein, auf der Basis ihrer Institutionen und Urteilsfähigkeit ihre Politik zu verfolgen oder werden sie in Versuchung geraten, ihre Bevölkerung freizukaufen, wenn sie als Geisel gehalten wird? Wie al-Sawahiri und al-Sarkawi offen aussprachen, ist es die Demokratie, die Zivilisten zu legitimen Zielen macht, es ist die Demokratie, die die Wünsche einer messianischen Minderheit ablehnt; es ist die Demokratie, die auf dem Spiel steht."
Ein Jahr nach den Bombenanschlägen in London widerspricht Philip Bobbitt Ansichten, nach denen die Anschläge eine Reaktion auf den Irakkrieg oder die gescheiterte Integration von Muslimen gewesen seien: "Bei den Anschlägen ging es, ganz einfach, um Demokratie. Werden demokratisch gewählte Regierungen in der Lage sein, auf der Basis ihrer Institutionen und Urteilsfähigkeit ihre Politik zu verfolgen oder werden sie in Versuchung geraten, ihre Bevölkerung freizukaufen, wenn sie als Geisel gehalten wird? Wie al-Sawahiri und al-Sarkawi offen aussprachen, ist es die Demokratie, die Zivilisten zu legitimen Zielen macht, es ist die Demokratie, die die Wünsche einer messianischen Minderheit ablehnt; es ist die Demokratie, die auf dem Spiel steht."Für Michael Gove wurde das Jahr nach den Anschlägen völlig nutzlos vertan. Statt endlos darüber zu diskutieren, wie sich das Land am vernünftigsten schützt, hätte man darüber reden sollen, was die Attentäter antreibt, meint Gove, denn der Islamismus sei keine religiöse Bewegung, "keine Kampagne, die durch Lehre, Predigt und Ermunterung die Frömmigkeit wiederherstellen will. Es ist der revolutionäre Versuch, eine neue Gesellschaft zu schaffen, sicher durch Überzeugung, aber unvermeidlich mit Gewalt, um die totale Unterwerfung unter eine einzige gestrenge und militaristische Göttlichkeit zu sichern."
Saira Khan hat als überzeugte britische Muslimin vor allem eine Frage an die Muslime, die sich nicht britisch fühlen wollen: "Warum lebt ihr hier?"
Wired (USA), 01.07.2006
Das Zentralmagazin der Internetvisionäre hebt im Juli Rupert Murdoch aufs Cover, der nicht nur eine inzwischen berühmte Rede über die Zukunft der Medien hielt, sondern auch gleich den bei Jugendlichen beliebten Onlinedienst MySpace.com inzwischen über eine Milliarde Seitenaufrufen täglich kaufte. Spencer Reiss besucht Murdoch in seinem New Yorker Büro, und sein Artikel fängt so an: "Wie er da so auf seinem weißen Powersofa in der überirdisch stillen achten Etage des Hauptquartiers von NewsCorp sitzt, erinnert Rupert Murdoch ganz und gar nicht an einen feurigen Revolutionär. Das Hemd gestärkt. Die Manieren höflich. Einen Monat nach seinem 75. Geburtstag. Aber dann spricht er: 'Um etwas Vergleichbares zu finden, müssen Sie 500 Jahre zur Erfindung des Buchdrucks zurückgehen. Das war die Geburt der Massenmedien. Sie haben doch die alte Welt der Könige und Aristokratien zerstört. Die Technologie schiebt die Macht von Redakteuren, Verlegern, dem Establishment und der Medienelite weg. Nun üben die Leute die Macht aus.' Und er lächelt."
Im gleichen Heft schreibt auch der Theoretiker der "Long-Tail-Ökonomie" Chris Anderson über die Macht der "consumer generated media" - und sein Vokabular klingt überraschend altbekannt: "Die Produktionsmittel werden demokratisiert."
Im gleichen Heft schreibt auch der Theoretiker der "Long-Tail-Ökonomie" Chris Anderson über die Macht der "consumer generated media" - und sein Vokabular klingt überraschend altbekannt: "Die Produktionsmittel werden demokratisiert."
DU (Schweiz), 01.07.2006
 Das ewige St. Moritz ist Thema dieser Ausgabe. Thomas Hettche (mehr) verzieht sich ins benachbarte Sils, um darüber nachzugrübeln, was den prototypischen Ferienort im Innersten zusammenhält. "Der Jet Set ist dieser Region insofern eingeschrieben, als Geschwindigkeit das natürliche Maß einer Landschaft der Leere ist. Und damit der Tod. Mir scheint, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der englische Sportler das Phantasma, das St. Moritz bestimmt, und der Wiedergänger, der es belebt. Indem die ersten angelsächsischen Touristen in den Alpen aus Langweile den Wintersport erfanden, erfanden sie eine tatsächlich vollständige neue Figur im europäischen Naturraum. Anders als der Bergführer, der Wildschütz, der Jäger opfert sich der Sportler, der auf dem Schlitten das Abenteuer der Geschwindigkeit sucht, nicht für andere, sondern agiert für sich allein. Das einzige, was er sucht und was von ihm bleiben wird, ist der Rekord. Er ist bei aller aristokratischen Attitüde immer Demokrat. Oder Autist, wenn man so will."
Das ewige St. Moritz ist Thema dieser Ausgabe. Thomas Hettche (mehr) verzieht sich ins benachbarte Sils, um darüber nachzugrübeln, was den prototypischen Ferienort im Innersten zusammenhält. "Der Jet Set ist dieser Region insofern eingeschrieben, als Geschwindigkeit das natürliche Maß einer Landschaft der Leere ist. Und damit der Tod. Mir scheint, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der englische Sportler das Phantasma, das St. Moritz bestimmt, und der Wiedergänger, der es belebt. Indem die ersten angelsächsischen Touristen in den Alpen aus Langweile den Wintersport erfanden, erfanden sie eine tatsächlich vollständige neue Figur im europäischen Naturraum. Anders als der Bergführer, der Wildschütz, der Jäger opfert sich der Sportler, der auf dem Schlitten das Abenteuer der Geschwindigkeit sucht, nicht für andere, sondern agiert für sich allein. Das einzige, was er sucht und was von ihm bleiben wird, ist der Rekord. Er ist bei aller aristokratischen Attitüde immer Demokrat. Oder Autist, wenn man so will."Margrit Sprecher besucht das schön dekadente Gourmet-Festival im Palace. "Am liebsten kochen Sterne-Köche mit Kaviar, Gänseleber und Trüffel, was nach einer Woche zu einer gewissen Monotonie führen kann. Die Organisatoren kamen deshalb nicht darum herum, die teuren Zutaten gewissermaßen zu rationieren und nach einem strengen Schlüssel zuzuteilen. Doch sie hatten nicht mit der Erfindungsgabe der Köche gerechnet. So raspelte der Tessiner Martin Dalsass einen Trüffel über seine Vorspeise, der, so beteuerte er, sich grundlegend vom Trüffel seines Konkurrenten im Hauptgang unterscheidet. Er schmeckt, sagte er, eher wie ein Steinpilz und wächst, anders als der gewöhnliche Trüffel, nur auf über 1.000 Metern Höhe. Andere Köche versteckten den Kaviar und Hummer hinter unverfänglich rustikalen Namen. Lokalmatador Roland Jöhri beispielsweise schmuggelte den Kaviar ins Bündner Armeleutegericht Maluns, in der Pfanne zerstoßene Kartoffeln. Und die Capuns - in Mangoldblätter eingewickelter Spätzliteig - peppte er mit Hummer auf."
Außerdem beschreibt Jürg Kienberger seine Kindheit in einem Hotel in St. Moritz. Nur im Print zu lesen sind Li Daweis chinesischer Blick auf den Gesellschaftsort, Cordula Segers Chronik, in der sie auch das Geburtsdatum des Wintersports auf etwa 1850 festlegt, und Richard Swartz' Physiognomie der "Dickmadam" Javanka Tito.
Al Ahram Weekly (Ägypten), 29.06.2006
 Football rules. Galal Nassar erhebt den rüden Auftritt des Präsidenten von Ägyptens bekanntestem Fußballclub Zamalek während des Ägypten Cup Finales (er bedrohte die gegnerischen Offiziellen mit einem Schuh) zur Staatssache: "Der Niedergang von Recht und Gesetz hat verschiedene Gesichter. Keiner vertraut mehr den Parteien und Institutionen. Das Regime seinerseits respektiert den Willen der Wähler nicht ... Es schickt Truppen, um friedlichen Protest niederzuschlagen und zettelt endlose Reform-Debatten an, die ohne Ergebnis bleiben. Wenn Leute mit dem Schuh in der Hand argumentieren, muss gehandelt werden."
Football rules. Galal Nassar erhebt den rüden Auftritt des Präsidenten von Ägyptens bekanntestem Fußballclub Zamalek während des Ägypten Cup Finales (er bedrohte die gegnerischen Offiziellen mit einem Schuh) zur Staatssache: "Der Niedergang von Recht und Gesetz hat verschiedene Gesichter. Keiner vertraut mehr den Parteien und Institutionen. Das Regime seinerseits respektiert den Willen der Wähler nicht ... Es schickt Truppen, um friedlichen Protest niederzuschlagen und zettelt endlose Reform-Debatten an, die ohne Ergebnis bleiben. Wenn Leute mit dem Schuh in der Hand argumentieren, muss gehandelt werden."Außerdem: Amira El-Noshokaty beklagt die erneute Zwangsumsiedelung des Kairoer Azbakia-Marktes für antiquarische Bücher als Fanal des kulturellen Verfalls. Und Mohamed El-Assyouti stellt die Filmfassung von Alaa El-Aswanis Roman-Bestseller "The Yacoubian Building" (Leseprobe) vor - ein Sittengemälde des modernen Ägyptens, inszeniert mit dem größten Budget der ägyptischen Filmgeschichte.
Weltwoche (Schweiz), 29.06.2006
 Christoph Neidhart sieht Russlands Außenpolitik als ewiges wie vergebliches Ringen um Anerkennung. Es "zieht sich seit Peter dem Großen als Konstante durch die russische Politik - 'einholen und überholen'. Und nicht nur durch die Politik. 1838 führten Petersburger Adlige dem französischen Besucher Marquis de Custine teure Edelbetten vor. Doch sie benutzten sie nicht zum Schlafen, nur zum Vorzeigen. In seinem Reisebericht machte der Marquis sich, statt beeindruckt zu sein, über ihre Besitzer lustig. Alles sei in Russland Theater, schrieb er. Je länger, je mehr mutet Putins Demokratie an wie jene Betten: Man hat sie zum Präsentieren, benutzt sie selten - weiß kaum, wie sie funktioniert."
Christoph Neidhart sieht Russlands Außenpolitik als ewiges wie vergebliches Ringen um Anerkennung. Es "zieht sich seit Peter dem Großen als Konstante durch die russische Politik - 'einholen und überholen'. Und nicht nur durch die Politik. 1838 führten Petersburger Adlige dem französischen Besucher Marquis de Custine teure Edelbetten vor. Doch sie benutzten sie nicht zum Schlafen, nur zum Vorzeigen. In seinem Reisebericht machte der Marquis sich, statt beeindruckt zu sein, über ihre Besitzer lustig. Alles sei in Russland Theater, schrieb er. Je länger, je mehr mutet Putins Demokratie an wie jene Betten: Man hat sie zum Präsentieren, benutzt sie selten - weiß kaum, wie sie funktioniert."Weitere Artikel: In einem langen Interview verteidigt die Amnesty-Generalsekretärin Irene Khan auch ihre aufsehenerregende Aussage, Guantanamo sei der "Gulag unserer Zeit". "Ich vergleiche nicht die Opferzahlen. Ich wollte zeigen, dass Guantanamo ein Symbol ist. Es wird immer in den Köpfen der Menschen bleiben als die schwerste Menschenrechtsverletzung der USA." Walter de Gregorio übt Stilkritik am italienischen Fußballspiel wie den Trikots. Wolfram Knorr preist eine DVD-Kollektion mit Filmen des französischen Regisseurs Louis Malle.
New Yorker (USA), 10.07.2006
In einem wie immer bestens recherchierten Bericht erklärt Seymour M. Hersh das Problem des amerikanischen Militärs mit der Iran-Politik des Präsidenten: "Entscheidend für die Vorbehalte des Militärs, sagen die Offiziere, ist die Tatsache, dass weder die amerikanischen noch die europäischen Geheimdienste konkrete Hinweise auf geheime Atom-Aktivitäten oder versteckte Anlagen gefunden haben. Die Kriegsplaner wissen nicht, worauf sie zielen sollen. 'Das Angebot an Zielen im Iran ist groß, aber nicht fassbar', sagte mir ein hochrangiger General. 'Die Frage, vor der wir stehen, lautet: Wann wird aus harmloser Infrastruktur eine gefährliche?' Der hochrangige General fügte hinzu, dass die Erfahrungen des Militärs im Irak, bei dem die Informationen über Massenvernichtungswaffen so fehlerhaft waren, seine Haltung gegenüber dem Iran verändert hätten. 'Wir haben im Irak eine große Schimäre aufgebaut, und nichts war da.'"
Weitere Artikel: David Remnick kommentiert die Attacken des Weißen Hauses gegen die New York Times. Judith Thurman beschreibt ein Treffen mit Charlotte Rampling. Zu lesen ist außerdem die Erzählung "The Phone Call" von Alexander Solschenizyn.
Besprochen werden Peter Beinarts Buch "The Good Fight: Why Liberals - and Only Liberals - Can Win the War on Terror and Make America Great Again", Chris Andersons Studie über den Niedergang von Megaverkaufsschlagern "The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More" (Rezensent John Cassidy hat für die beispielgebenden Firmen Amazon, Google eBay etc. einen weniger freundlichen Namen: Oligopole. Mehr zum Buch hier) und David Frankels Filmkomödie "The Devil Wears Prada" mit Meryl Streep als Vogue-Biest Anna Wintour - "schillerndes Unterhaltungskino wie in den Tagen von George Cukor oder Stanley Donen", findet David Denby.
Nur im Print: ein Bericht über einen Geheimagenten, der gute Chancen hatte, den 11. September verhindern zu können (online zu lesen ist ein Interview mit dem Autor), Artikel über die HipHop-Radiostation Hot 97 sowie über die Sorte Humor, die Hollywood gar nicht lustig findet. Außerdem Lyrik von Mary Stewart Hammond und William Logan.
Weitere Artikel: David Remnick kommentiert die Attacken des Weißen Hauses gegen die New York Times. Judith Thurman beschreibt ein Treffen mit Charlotte Rampling. Zu lesen ist außerdem die Erzählung "The Phone Call" von Alexander Solschenizyn.
Besprochen werden Peter Beinarts Buch "The Good Fight: Why Liberals - and Only Liberals - Can Win the War on Terror and Make America Great Again", Chris Andersons Studie über den Niedergang von Megaverkaufsschlagern "The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More" (Rezensent John Cassidy hat für die beispielgebenden Firmen Amazon, Google eBay etc. einen weniger freundlichen Namen: Oligopole. Mehr zum Buch hier) und David Frankels Filmkomödie "The Devil Wears Prada" mit Meryl Streep als Vogue-Biest Anna Wintour - "schillerndes Unterhaltungskino wie in den Tagen von George Cukor oder Stanley Donen", findet David Denby.
Nur im Print: ein Bericht über einen Geheimagenten, der gute Chancen hatte, den 11. September verhindern zu können (online zu lesen ist ein Interview mit dem Autor), Artikel über die HipHop-Radiostation Hot 97 sowie über die Sorte Humor, die Hollywood gar nicht lustig findet. Außerdem Lyrik von Mary Stewart Hammond und William Logan.
The Nation | Rivista dei Libri | Polityka | Liberation | Spectator | Wired | DU | Al Ahram Weekly | Weltwoche | New Yorker | Outlook India | London Review of Books | Espresso | Economist | Folio | Magyar Lettre International | Foglio | Merkur