Magazinrundschau
Falsche Kosmopoliten
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
07.12.2021. Rest of World erzählt, wie die chinesische LGBTQI-Szene im Netz ausgelöscht wird. Die World Socialist Web Site fragt, ob die New York Times noch den Unterschied zwischen Geschichte und Narrativ kennt. Der Merkur geißelt das antiaufklärerische Politikverständnis der verwöhnten Deutschen. In Liberties fragt der Übersetzer Benjamin Moser, wie wir in fremde Kulturen eintauchen können, wenn wir unsere eigene kaum noch kennen. The Atlantic warnt vor dem Aufbau eines Apparats für Wahldiebstahl durch die Republikaner.
Rest of World (USA), 30.11.2021
HVG (Ungarn), 07.12.2021
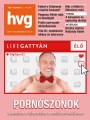 Die Historikerin Andrea Pethő ist von ihrem Posten in der Ungarischen Akkreditierungskommission von Hochschulstudiengängen zurückgetreten, nachdem sie von der Präsidentin der Kommission aufgefordert worden war, die Ergebnisse ihrer Studie über die Instrumentalisierung des höheren Bildungs- und Forschungssektors durch illiberalen Regime vor der Veröffentlichung zu verändern. Im Gespräch mit Hanna Csatlós begründet sie ihre Entscheidung: "Die illiberalen politischen Berater haben erkannt, dass die wissenschaftliche Legitimierung, die solche Institutionen gewährleisten, nicht nur für die ideologische Grundlage benötigt wird, sondern auch um loyale Unterstützer beschäftigen zu können, die wiederum weitere loyale Unterstützer ausbilden, die später dann die Leitung realer Bildungs- und Forschungsstätte übernehmen können. (...) Illiberale Staaten versuchen ein Schaufenster zu errichten, in dem es so aussieht, als wäre alles in Ordnung, denn das ist freilich die Bedingung, dass Fördergelder aus der EU zugänglich sind."
Die Historikerin Andrea Pethő ist von ihrem Posten in der Ungarischen Akkreditierungskommission von Hochschulstudiengängen zurückgetreten, nachdem sie von der Präsidentin der Kommission aufgefordert worden war, die Ergebnisse ihrer Studie über die Instrumentalisierung des höheren Bildungs- und Forschungssektors durch illiberalen Regime vor der Veröffentlichung zu verändern. Im Gespräch mit Hanna Csatlós begründet sie ihre Entscheidung: "Die illiberalen politischen Berater haben erkannt, dass die wissenschaftliche Legitimierung, die solche Institutionen gewährleisten, nicht nur für die ideologische Grundlage benötigt wird, sondern auch um loyale Unterstützer beschäftigen zu können, die wiederum weitere loyale Unterstützer ausbilden, die später dann die Leitung realer Bildungs- und Forschungsstätte übernehmen können. (...) Illiberale Staaten versuchen ein Schaufenster zu errichten, in dem es so aussieht, als wäre alles in Ordnung, denn das ist freilich die Bedingung, dass Fördergelder aus der EU zugänglich sind."World Socialist Web Site (USA), 25.11.2021
Hätten deutsche Zeitungen noch Kulturkorrespondenten, hätten sie vielleicht intensiver über die Debatte berichtet. Denn hier geht es, ähnlich wie in der deutschen Debatte um A. Dirk Moses um den Widerstreit zwischen Geschichte und "Narrativ", Fakten und politisch erwünschten Wahrheiten. Der Streit ist um so giftiger, als selbstverständlich auch die Trumpianische Rechte sich seiner bemächtigte und ihn für ihre Zwecke ausbeutet.
Auf der World Socialist Web Site antwortet nun der Historiker Tom Mackaman auf Silversteins Artikel und das Buch. Ihn stört schon Hannah-Jones' Grundkonzept des Projekts, an dem fast nur schwarze Historiker beteiligt waren: "Wenn nur schwarze Historiker wirklich wissen können, was in 'black history' zur Debatte steht, muss daraus folgen, dass nur Weiße in der Lage sein können, die 'weiße Geschichte' zu kennen. Daraus folgt, dass schwarze Historiker sich nicht mit Episoden der Geschichte befassen sollten, in denen die Akteure überwiegend weiß waren - zum Beispiel mit der politischen Geschichte der amerikanischen Revolution oder des Bürgerkriegs. Diese Sichtweise ist offensichtlich durch und durch reaktionär. Dennoch bedingte sie den Versuch der Times, 'fast jeden Mitarbeiter' für das 1619-Projekt auf der Grundlage der schwarzen Identität auszuwählen, wie die Zeitung bei der Vorstellung des Projekts schrieb."
Silverstein verteidigt in seinem New York Times-Artikel mit geringen Einschränkungen die These, dass die Revolution zur Verteidigung der Sklaverei ausgefochten wurde, obwohl etwa Autoren wie Leslie M. Harris in Politico eingewandt hatten , dass die Sklaverei damals von Britannien überhaupt nicht in Frage gestellt und etwa in der Karibik eifrig weiter betrieben wurde, trotz des entstehenden Abolitionismus. Silverstein verteidigt auch die Idee des "Narrativs": In Antwort auf eine Rede des Gouverneurs Ron DeSantis schreibt er: Das Bestehen auf historischer Überlieferung sei selbst ahistorisch. "Wer die 'eigentlichen Fakten' gegenüber dem Narrativ hervorhebt wie der Gouverneur und viele andere, scheint von der Prämisse auszugehen, dass Geschichte eine ein für alle Mal fixierte Sache ist. Und dass Historiker nur dafür da seien einen Bestand relevanter Fakten zu hegen und zu verbreiten."
Mackaman schreibt zu diesem Argument Silversteins und Hannah-Jones': "Ihnen gilt Narrativ schlicht als eine 'Story', die über die Vergangenheit erzählt werden kann - tatsächlich haben sie ihrem Buch den Untertitel ' A New Origin Story' gegeben. In ihrer Sicht der Dinge ist eine Geschichte so gut wie die andere."
Merkur (Deutschland), 01.12.2021
 Der Soziologe Marco Bitschnau verteidigt die deutsche Politik gegen ihr missmutiges, wenn nicht gar gehässiges Wahlvolk: "Wie anders soll man es nennen, wenn sich die halbe Republik wochenlang über Laschets Lachen und Baerbocks Buch mokiert und dabei geflissentlich ausblendet, dass andere Demokratien in Deutschlands Gewichtsklasse sich nach mit derlei 'Skandalen' beflecktem Spitzenpersonal alle Finger lecken würden... Dennoch ist da dieser mürrische Ton, dieser Zorn und immer wieder dieses Anspruchsdenken: Politik soll gleichzeitig sexy und seriös daherkommen, soll prinzipientreu sein, doch auf keinen Fall ideologisch, soll das Ohr für Volkes Stimme spitzen, muss aber über jeden Verdacht der bloßen Wählerbeschwichtigung erhaben sein. Man wünscht sich gewissermaßen eine Art deutschen Obama, den es natürlich nicht gibt und nicht geben kann und dessen Irrealität man dann mit Fundamentalkritik an den vermeintlichen Limitationen des tatsächlichen Wahlangebots kompensiert. Es ist ein antiaufklärerisches Politikverständnis, das hier immer wieder durchscheint; ein Verständnis, nach dem Politik nicht das sprichwörtlichen Bohren dicker Bretter ist, nicht das behutsame Austarieren verschiedener und zum Teil auch entgegengesetzter Interessenslagen, sondern eine staatsseitige Serviceleistung in der Erlebnisdemokratie. "
Der Soziologe Marco Bitschnau verteidigt die deutsche Politik gegen ihr missmutiges, wenn nicht gar gehässiges Wahlvolk: "Wie anders soll man es nennen, wenn sich die halbe Republik wochenlang über Laschets Lachen und Baerbocks Buch mokiert und dabei geflissentlich ausblendet, dass andere Demokratien in Deutschlands Gewichtsklasse sich nach mit derlei 'Skandalen' beflecktem Spitzenpersonal alle Finger lecken würden... Dennoch ist da dieser mürrische Ton, dieser Zorn und immer wieder dieses Anspruchsdenken: Politik soll gleichzeitig sexy und seriös daherkommen, soll prinzipientreu sein, doch auf keinen Fall ideologisch, soll das Ohr für Volkes Stimme spitzen, muss aber über jeden Verdacht der bloßen Wählerbeschwichtigung erhaben sein. Man wünscht sich gewissermaßen eine Art deutschen Obama, den es natürlich nicht gibt und nicht geben kann und dessen Irrealität man dann mit Fundamentalkritik an den vermeintlichen Limitationen des tatsächlichen Wahlangebots kompensiert. Es ist ein antiaufklärerisches Politikverständnis, das hier immer wieder durchscheint; ein Verständnis, nach dem Politik nicht das sprichwörtlichen Bohren dicker Bretter ist, nicht das behutsame Austarieren verschiedener und zum Teil auch entgegengesetzter Interessenslagen, sondern eine staatsseitige Serviceleistung in der Erlebnisdemokratie. "Florian Hannig liefert eine kleine Begriffsgeschichte der Betroffenheit, die als schillernde Vokabel und umkämpfte Ressource für Anerkennungskämpfe der Identitätspolitik voranging: "Auch von links kam Kritik: Auf dem Weg zum Parlamentarismus warfen die ehemaligen Spontis Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit nicht nur ihre Anti-Stellvertreterpolitik über Bord, sondern distanzierten sich allgemein von Betroffenheit als politischer Praxis. Fischer fragte 1984: 'Seien wir doch ehrlich: Wer von uns interessiert sich denn für Wassernotstände im Vogelsberg, für Stadtautobahnen in Frankfurt, für Atomkraftwerke irgendwo, weil er sich persönlich betroffen fühlt?' Innerhalb der Frauenbewegung wurden Stimmen laut, die zwar nicht komplett mit dem Konzept brachen, aber nachdenklich fragten, ob die Bewegung sich durch die Norm 'Betroffenheit-geht-vor-Inhalt' einer notwendigen Form der Selbstkritik beraube."
Liberties (USA), 07.12.2021
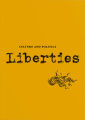 Der Autor und Übersetzer Benjamin Moser hat nicht nur eine gefeierte Susan-Sontag-Biografie geschrieben, er hat vor allem eine Biografie Clarice Lispectors geschrieben und mehrere ihrer Bücher übersetzt, die die brasilianische Autorin gewissermaßen auf die Karte der Weltliteratur gesetzt haben. Dass Übersetzen eine gute Sache ist, daran hatte er nie Zweifel. Bis er in einem Apartment in London auf eine Bibliothek stieß, deren Bücher ihn sofort in die Welt seiner Großeltern versetzte. Diese Welt, meint er, kennt heute kaum noch jemand. Aber kann man andere Kulturen und ihre Bücher verstehen, wenn man seine eigene Kultur nicht mehr kennt? "Es ist harmlos, schwedische Kriminalromane oder Elena Ferrante zu genießen, aber ein solcher Genuss impliziert ebenso wenig eine Vertrautheit mit der skandinavischen oder italienischen Literatur wie der Genuss mexikanischer Speisen eine Vertrautheit mit der mexikanischen Kultur bedeutet. Übersetzung ohne Kontext kann eine Form des Konsumismus, des Alibiismus, der - ich wage es zu sagen? - 'kulturellen Aneignung' sein. Das eigentliche Problem bei der 'kulturellen Aneignung' ist, dass sie nicht tief genug geht. Clarice Lispector nannte die Brasilianer 'falsche Kosmopoliten', und der Begriff erscheint uns unangenehm passend: Menschen, die ständig in Kulturen eintauchen, die sie kaum verstehen. Indem wir uns in zu viele andere Welten ausdehnen, haben wir die Tiefe unserer eigenen geopfert und uns von dem abgeschnitten, was an uns besonders und tiefgründig war. Die Übersetzung - nicht die Sache selbst, sondern die unhinterfragte Betonung ihrer Tugend - kommt mir wie ein weiteres Spießbürgertum vor, das sich als Weltoffenheit tarnt: ein weiterer Teil der Infrastruktur. Die Art und Weise, wie wir lesen, die Art und Weise, wie wir uns mit der Welt auseinandersetzen, ähnelt der Art und Weise, wie wir reisen: Reisen, die, auch wenn sie kilometermäßig weit entfernt sind, fast immer innerhalb unserer eigenen Klasse stattfanden. Wie Chesterton bemerkte, verengt das Reisen den Geist."
Der Autor und Übersetzer Benjamin Moser hat nicht nur eine gefeierte Susan-Sontag-Biografie geschrieben, er hat vor allem eine Biografie Clarice Lispectors geschrieben und mehrere ihrer Bücher übersetzt, die die brasilianische Autorin gewissermaßen auf die Karte der Weltliteratur gesetzt haben. Dass Übersetzen eine gute Sache ist, daran hatte er nie Zweifel. Bis er in einem Apartment in London auf eine Bibliothek stieß, deren Bücher ihn sofort in die Welt seiner Großeltern versetzte. Diese Welt, meint er, kennt heute kaum noch jemand. Aber kann man andere Kulturen und ihre Bücher verstehen, wenn man seine eigene Kultur nicht mehr kennt? "Es ist harmlos, schwedische Kriminalromane oder Elena Ferrante zu genießen, aber ein solcher Genuss impliziert ebenso wenig eine Vertrautheit mit der skandinavischen oder italienischen Literatur wie der Genuss mexikanischer Speisen eine Vertrautheit mit der mexikanischen Kultur bedeutet. Übersetzung ohne Kontext kann eine Form des Konsumismus, des Alibiismus, der - ich wage es zu sagen? - 'kulturellen Aneignung' sein. Das eigentliche Problem bei der 'kulturellen Aneignung' ist, dass sie nicht tief genug geht. Clarice Lispector nannte die Brasilianer 'falsche Kosmopoliten', und der Begriff erscheint uns unangenehm passend: Menschen, die ständig in Kulturen eintauchen, die sie kaum verstehen. Indem wir uns in zu viele andere Welten ausdehnen, haben wir die Tiefe unserer eigenen geopfert und uns von dem abgeschnitten, was an uns besonders und tiefgründig war. Die Übersetzung - nicht die Sache selbst, sondern die unhinterfragte Betonung ihrer Tugend - kommt mir wie ein weiteres Spießbürgertum vor, das sich als Weltoffenheit tarnt: ein weiterer Teil der Infrastruktur. Die Art und Weise, wie wir lesen, die Art und Weise, wie wir uns mit der Welt auseinandersetzen, ähnelt der Art und Weise, wie wir reisen: Reisen, die, auch wenn sie kilometermäßig weit entfernt sind, fast immer innerhalb unserer eigenen Klasse stattfanden. Wie Chesterton bemerkte, verengt das Reisen den Geist."En attendant Nadeau (Frankreich), 01.12.2021
 Die "Pléiade", gestaltet in dunkel leuchtenden Lederbänden, ist die französische Klassikerbibliothek schlechthin - in Deutschland gibt es dazu kein Pendant. Etwas skeptisch begutachtet Philippe Mesnard den jüngsten Anthologieband "L'espèce humaine et autres récits des camps". "L'espèce humaine" ist der Titel des berühmten Buchs von Robert Antelme, der als einer der ersten in Frankreich über die Konzentrationslager der Nazis berichtete. Insgesamt versammelt der Band acht französischsprachige Texte über die Lager, darunter Jorge Sempruns "L'écriture ou la vie". Die Kriterien der Auswahl und der Präsentation überzeugen Mesnard nicht. Ihn stört etwas die Terminologie über die Lager, die von den Herausgebern im Band verwendet wird: "Dominique Moncond'huy et Henri Scepi beschönigen den Völkermord an den Juden zwar keineswegs, aber sie benutzen immer wieder den verallgemeinernden Begriff des 'Lagers', der bereits im Titel besiegelt ist. Da kann man sich fast fragen, warum nicht auch Schriften über den Gulag vertreten sind. Warum hat man nicht einfach geschrieben 'Schriften aus den Nazi-Lagern?' Hinzukommt, dass fast auf jeder Seite vom 'Modell des Lagers' die Rede ist, so dass der Unterschied zwischen der Struktur der Konzentrationslager und die Umsetzung eines Völkermords, der die Juden von der Erde auslöschen sollte, verlorengeht."
Die "Pléiade", gestaltet in dunkel leuchtenden Lederbänden, ist die französische Klassikerbibliothek schlechthin - in Deutschland gibt es dazu kein Pendant. Etwas skeptisch begutachtet Philippe Mesnard den jüngsten Anthologieband "L'espèce humaine et autres récits des camps". "L'espèce humaine" ist der Titel des berühmten Buchs von Robert Antelme, der als einer der ersten in Frankreich über die Konzentrationslager der Nazis berichtete. Insgesamt versammelt der Band acht französischsprachige Texte über die Lager, darunter Jorge Sempruns "L'écriture ou la vie". Die Kriterien der Auswahl und der Präsentation überzeugen Mesnard nicht. Ihn stört etwas die Terminologie über die Lager, die von den Herausgebern im Band verwendet wird: "Dominique Moncond'huy et Henri Scepi beschönigen den Völkermord an den Juden zwar keineswegs, aber sie benutzen immer wieder den verallgemeinernden Begriff des 'Lagers', der bereits im Titel besiegelt ist. Da kann man sich fast fragen, warum nicht auch Schriften über den Gulag vertreten sind. Warum hat man nicht einfach geschrieben 'Schriften aus den Nazi-Lagern?' Hinzukommt, dass fast auf jeder Seite vom 'Modell des Lagers' die Rede ist, so dass der Unterschied zwischen der Struktur der Konzentrationslager und die Umsetzung eines Völkermords, der die Juden von der Erde auslöschen sollte, verlorengeht."The Atlantic (USA), 01.01.2022
 In einer riesigen Reportage untersucht Barton Gellman die Taktiken der Trump-Anhänger, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu kapern. Dass ihnen das gelingen kann, bezweifelt er nicht: "Seit mehr als einem Jahr haben republikanische Funktionäre in den Bundesstaaten mit stillschweigender und ausdrücklicher Unterstützung der nationalen Parteiführung einen Apparat für Wahldiebstahl aufgebaut. Gewählte Beamte in Arizona, Texas, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan und anderen Staaten haben Donald Trumps Kreuzzug, die Wahl 2020 zu kippen, studiert. Sie haben die Schwachstellen erkannt und konkrete Schritte unternommen, um ein Scheitern beim nächsten Mal zu vermeiden. Einige von ihnen haben ihre Gesetze umgeschrieben, um den Parteien die Kontrolle darüber zu entziehen, welche Stimmzettel gezählt und welche verworfen werden, welche Ergebnisse bestätigt und welche abgelehnt werden. Sie vertreiben oder entmachten Wahlbeamte, die sich im letzten November geweigert hatten, sich dem Komplott anzuschließen, und versuchen, sie durch Vertreter der großen Lüge zu ersetzen. Sie feilen an einem juristischen Argument, das es den staatlichen Gesetzgebern erlauben soll, sich über die Entscheidung der Wähler hinwegzusetzen." Dieses Argument besagt, dass Wahlen ausschließlich vom Parlament eines Bundesstaates kontrolliert werden sollten: "In ihrer logischen Konsequenz könnte dies eine Rechtsgrundlage für jede staatliche Legislative sein, ein Wahlergebnis, das ihr nicht gefällt, zu verwerfen und stattdessen die von ihr bevorzugten Wahlmänner zu ernennen."
In einer riesigen Reportage untersucht Barton Gellman die Taktiken der Trump-Anhänger, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu kapern. Dass ihnen das gelingen kann, bezweifelt er nicht: "Seit mehr als einem Jahr haben republikanische Funktionäre in den Bundesstaaten mit stillschweigender und ausdrücklicher Unterstützung der nationalen Parteiführung einen Apparat für Wahldiebstahl aufgebaut. Gewählte Beamte in Arizona, Texas, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan und anderen Staaten haben Donald Trumps Kreuzzug, die Wahl 2020 zu kippen, studiert. Sie haben die Schwachstellen erkannt und konkrete Schritte unternommen, um ein Scheitern beim nächsten Mal zu vermeiden. Einige von ihnen haben ihre Gesetze umgeschrieben, um den Parteien die Kontrolle darüber zu entziehen, welche Stimmzettel gezählt und welche verworfen werden, welche Ergebnisse bestätigt und welche abgelehnt werden. Sie vertreiben oder entmachten Wahlbeamte, die sich im letzten November geweigert hatten, sich dem Komplott anzuschließen, und versuchen, sie durch Vertreter der großen Lüge zu ersetzen. Sie feilen an einem juristischen Argument, das es den staatlichen Gesetzgebern erlauben soll, sich über die Entscheidung der Wähler hinwegzusetzen." Dieses Argument besagt, dass Wahlen ausschließlich vom Parlament eines Bundesstaates kontrolliert werden sollten: "In ihrer logischen Konsequenz könnte dies eine Rechtsgrundlage für jede staatliche Legislative sein, ein Wahlergebnis, das ihr nicht gefällt, zu verwerfen und stattdessen die von ihr bevorzugten Wahlmänner zu ernennen."Rebecca Giggs stellt zwei Bücher vor - "Hurricane Lizards and Plastic Squid: The Fraught and Fascinating Biology of Climate Change" von Thor Hanson und "A Natural History of the Future: What the Laws of Biology Tell Us About the Destiny of the Human Species" von Rob Dunn -, die untersuchen, wie es einigen Tierarten gelingt, sich der Veränderung der Welt durch die Menschen und dem Klimawandel anzupassen. Vielleicht können wir davon lernen? Die Erkenntnisse sind jedenfalls überraschend: "Wissenschaftler, die sich mit der Überwachung der städtischen Tierwelt befassen, weisen darauf hin, dass bebaute Gebiete mehr gefährdeten Arten Schutz bieten, als wir uns vorstellen können: Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigte, dass in australischen Städten pro Quadratkilometer wesentlich mehr bedrohte Arten leben als in nicht-städtischen Gebieten. ... Am erstaunlichsten ist, wie Robert Dunn anhand mehrerer faszinierender Fallstudien zeigt, dass sich die Organismen im Zuge ihrer Entwicklung zur Nutzung der Bedingungen und Ressourcen in diesen künstlichen Umgebungen manchmal so stark verändern, dass neue Arten entstehen. Aus Getreidesilos sind einzigartige Singvögel und Käfer hervorgegangen, die von einer stärkereichen Ernährung leben. Braune Ratten haben in einigen Städten begonnen, isolierte Populationen zu bilden. In New Orleans trennen Wasserstraßen die Rattenkolonien voneinander. In New York scheinen die Ratten nur ungern durch Midtown Manhattan zu ziehen - vielleicht, weil sie dort weniger zu fressen finden. Und die Ratten der Stadt haben charakteristische Merkmale entwickelt: Sie haben längere Nasen und kürzere Zähne als anderswo, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sie sich von weicherer Nahrung ernähren." Ob wir auch so flexibel sein können?
Außerdem: Rachel Donadio erklärt den Amerikanern die Laïcité, die Frankreich prägt.
Literarni noviny (Tschechien), 05.12.2021
 Vor wenigen Tagen starb mit Petr Uhl eine wichtige Figur der tschechoslowakischen Dissidentenszene. Uhl war einer der Erstunterzeichner der Charta 77, gründete zusammen mit Václav Havel das Menschenrechtskomitee VONS und saß unter den Kommunisten insgesamt neun Jahre im Gefängnis. Doch auch nach der Wende blieb Uhl ein hartnäckiger Kritiker der Verhältnisse. Der marxistisch geprägte "lebenslange Kämpfer für größere Gerechtigkeit" (so Petr Fischer) der sich selbst zuletzt "Sozialist und grüngefärbter Linksliberaler" nannte, blieb überzeugt, dass man nach anderen politischen Möglichkeiten suchen müsse: durch direkte Demokratie in Form von Referenden in grundlegenden Fragen (Ökologie, Geschlechtergleichheit) und auch durch freie Bürgerversammlungen, die er aus der Dissidentenzeit kannte und für viel kreativer hielt als die eingeführte Organisation in den politischen Parteien. In den Literární Noviny erinnert sich sein Weggefährte Jan Schneider an den Unbequemen: "Unter seinen Gegnern genoss er hohen Respekt, vielleicht sogar höheren als unter den 'Seinen', denn der Wert, den er hochhielt, war die Solidarität, was gegen totalitäre Regimes aller Art die wirksamste Waffe ist, die aber letztlich beiden Seiten wehtut." Und so habe Uhl auch nach dem Regimewechsel alle gepiesackt, "er stritt sich mit Freunden, stritt sich mit Feinden, war manchmal bis zur Ungerechtigkeit gerecht, und oft war es mit ihm schwer auszuhalten, aber auf der anderen Seite waren wenige Begegnungen im Leben so wertvoll und inspirierend, so ergiebig und lehrreich, dass es das einfach wert war, sich immer wieder mit diesem Menschen zu treffen, der wohl niemanden kalt ließ, entweder weil er einem das Herz erwärmte oder die Galle hochkochen ließ."
Vor wenigen Tagen starb mit Petr Uhl eine wichtige Figur der tschechoslowakischen Dissidentenszene. Uhl war einer der Erstunterzeichner der Charta 77, gründete zusammen mit Václav Havel das Menschenrechtskomitee VONS und saß unter den Kommunisten insgesamt neun Jahre im Gefängnis. Doch auch nach der Wende blieb Uhl ein hartnäckiger Kritiker der Verhältnisse. Der marxistisch geprägte "lebenslange Kämpfer für größere Gerechtigkeit" (so Petr Fischer) der sich selbst zuletzt "Sozialist und grüngefärbter Linksliberaler" nannte, blieb überzeugt, dass man nach anderen politischen Möglichkeiten suchen müsse: durch direkte Demokratie in Form von Referenden in grundlegenden Fragen (Ökologie, Geschlechtergleichheit) und auch durch freie Bürgerversammlungen, die er aus der Dissidentenzeit kannte und für viel kreativer hielt als die eingeführte Organisation in den politischen Parteien. In den Literární Noviny erinnert sich sein Weggefährte Jan Schneider an den Unbequemen: "Unter seinen Gegnern genoss er hohen Respekt, vielleicht sogar höheren als unter den 'Seinen', denn der Wert, den er hochhielt, war die Solidarität, was gegen totalitäre Regimes aller Art die wirksamste Waffe ist, die aber letztlich beiden Seiten wehtut." Und so habe Uhl auch nach dem Regimewechsel alle gepiesackt, "er stritt sich mit Freunden, stritt sich mit Feinden, war manchmal bis zur Ungerechtigkeit gerecht, und oft war es mit ihm schwer auszuhalten, aber auf der anderen Seite waren wenige Begegnungen im Leben so wertvoll und inspirierend, so ergiebig und lehrreich, dass es das einfach wert war, sich immer wieder mit diesem Menschen zu treffen, der wohl niemanden kalt ließ, entweder weil er einem das Herz erwärmte oder die Galle hochkochen ließ."London Review of Books (UK), 06.12.2021
 John Lanchester liest eine ganze Reihe von Büchern zur Corona-Pandemie, die ihm alle sehr eindrücklich rekapitulieren, was wir in den vergangenen beiden Jahren erlebt haben: Rachel Clarke schildert die Schlacht des Gesundheitssystems NHS, die beiden Times-Reporter Jonathan Calvert und George Arbuthnott das gigantische Versagen der britischen Regierung und Adam Tooze die zunehmende Spaltung in Arm und Reich auch dank der üppigen Wirtschaftshilfen: Die Armen sterben überproportional, die Reichen vergrößern ihre Aktiendepots. Natürlich weiß Lanchester aber auch als geborener Reporter sehr eindrücklich von seiner eigenen Covid-Erkrankung zu berichten: "Mein Körper schien in meinem Halbdelirium zu wissen, dass er mit einer neuen Krankheit umging. Mal fühlte ich mich ok, mal nicht, es wechselte in Schüben. In jener Woche kam mir das Bild in den Kopf, dass ich in einem nicht sehr guten Hotel im Bett liege und jemand versucht, die Tür zu öffnen, er rüttelt am Knauf, gibt auf und geht weg, nur um einige Stunden später wiederzukommen und es noch mal zu versuchen. Es fühlte sich an, als würde Covid ein Schloss öffnen wollen. Nie zuvor hatte ich bei einer Krankheit so etwas erlebt: Das Gefühl, Covid hat Absichten, und sie bedeuten nichts Gutes. Ich lese jetzt seit einem Jahr über die Krise - und meterweise journalistische Kommentare, und ich glaube inzwischen, dass sich Covid unmöglich zusammenfassen lässt, weil wir noch nicht wissen, wo wir in dieser Geschichte stehen."
John Lanchester liest eine ganze Reihe von Büchern zur Corona-Pandemie, die ihm alle sehr eindrücklich rekapitulieren, was wir in den vergangenen beiden Jahren erlebt haben: Rachel Clarke schildert die Schlacht des Gesundheitssystems NHS, die beiden Times-Reporter Jonathan Calvert und George Arbuthnott das gigantische Versagen der britischen Regierung und Adam Tooze die zunehmende Spaltung in Arm und Reich auch dank der üppigen Wirtschaftshilfen: Die Armen sterben überproportional, die Reichen vergrößern ihre Aktiendepots. Natürlich weiß Lanchester aber auch als geborener Reporter sehr eindrücklich von seiner eigenen Covid-Erkrankung zu berichten: "Mein Körper schien in meinem Halbdelirium zu wissen, dass er mit einer neuen Krankheit umging. Mal fühlte ich mich ok, mal nicht, es wechselte in Schüben. In jener Woche kam mir das Bild in den Kopf, dass ich in einem nicht sehr guten Hotel im Bett liege und jemand versucht, die Tür zu öffnen, er rüttelt am Knauf, gibt auf und geht weg, nur um einige Stunden später wiederzukommen und es noch mal zu versuchen. Es fühlte sich an, als würde Covid ein Schloss öffnen wollen. Nie zuvor hatte ich bei einer Krankheit so etwas erlebt: Das Gefühl, Covid hat Absichten, und sie bedeuten nichts Gutes. Ich lese jetzt seit einem Jahr über die Krise - und meterweise journalistische Kommentare, und ich glaube inzwischen, dass sich Covid unmöglich zusammenfassen lässt, weil wir noch nicht wissen, wo wir in dieser Geschichte stehen."Bookforum (USA), 01.12.2021
 Benjamin Kunkel befasst sich eingehend mit der Studie "Everything and Less" des Literaturwissenschaftlers Mark McGurl, der eine zentrale Herausforderung der Literaturwissenschaft im Zeitalter von Amazon und Self-Publishing kenntlich macht: Wie den Gegenstand einhegen, gewichten und priorisieren angesichts eines überbordenden Überangebots und dem Vorhaben, Literaturwissenschaft nicht mehr als Wissenschaft im Elfenbeinturm zu betreiben. McGurls populistischer Ansatz ist Kunkel eine Spur zu egalitär: "Beschämt über die soziale Unausgewogenheit ihres alten Kanons, der hauptsächlich aus weißen Männern bestand; verlegen angesichts der Schwierigkeit von Studenten, sowohl imaginative als auch theoretische Werke zu lesen, die Professoren einst typischerweise zuwiesen; und schließlich unsicher über ihren Platz in einer Welt, die behauptet, keine Zeit zum Lesen zu haben, obwohl sie reichlich Muße für Podcasts und Fernsehen hat - versucht die akademische Literaturwissenschaft erneut relevant zu werden, indem sie ihr Feld ausweitet und nivelliert, um dem Amazonas-Marktplatz näher zu kommen. Unabhängig davon, wie diese Verschiebung intellektuell zu bewerten ist, scheint sie bisher ein strategischer Fehlschlag zu sein. Warum sollten sich Studenten an Literaturabteilungen wenden, um die Art von Büchern und Fernsehsendungen kennenzulernen, die sie bereits konsumieren? Man muss kein Raketenwissenschaftler sein - Bergsteiger reicht aus -, um zu erkennen, dass die Anziehungskraft des Fachwissens in der Verheißung neuer Fähigkeiten liegt, nicht in der Bestätigung alter Gewohnheiten. Der Höhepunkt der Englischen Literatur als Fachgebiet, das sowohl Studenten anzog als auch die Lesegewohnheiten von Nichtstudenten beeinflusste, muss um 1970 gewesen sein, als sich die Zahl der Englisch-Studenten seit den späten 40er Jahren vervierfacht hatte. Der zentrale Text dieser Zeit, nach 'Hamlet', war wahrscheinlich Miltons 'Paradise Lost', ein langes und kunstvolles Blankvers-Epos voller abgründiger Anspielungen und einer teuflischen Syntax, von dem Milton gehofft hatte, es werde 'ein passendes Publikum finden, wenn auch nur ein kleines'. Doch kurioserweise war genau dies der Weg, in der Nachkriegszeit weite Kreise anzusprechen."
Benjamin Kunkel befasst sich eingehend mit der Studie "Everything and Less" des Literaturwissenschaftlers Mark McGurl, der eine zentrale Herausforderung der Literaturwissenschaft im Zeitalter von Amazon und Self-Publishing kenntlich macht: Wie den Gegenstand einhegen, gewichten und priorisieren angesichts eines überbordenden Überangebots und dem Vorhaben, Literaturwissenschaft nicht mehr als Wissenschaft im Elfenbeinturm zu betreiben. McGurls populistischer Ansatz ist Kunkel eine Spur zu egalitär: "Beschämt über die soziale Unausgewogenheit ihres alten Kanons, der hauptsächlich aus weißen Männern bestand; verlegen angesichts der Schwierigkeit von Studenten, sowohl imaginative als auch theoretische Werke zu lesen, die Professoren einst typischerweise zuwiesen; und schließlich unsicher über ihren Platz in einer Welt, die behauptet, keine Zeit zum Lesen zu haben, obwohl sie reichlich Muße für Podcasts und Fernsehen hat - versucht die akademische Literaturwissenschaft erneut relevant zu werden, indem sie ihr Feld ausweitet und nivelliert, um dem Amazonas-Marktplatz näher zu kommen. Unabhängig davon, wie diese Verschiebung intellektuell zu bewerten ist, scheint sie bisher ein strategischer Fehlschlag zu sein. Warum sollten sich Studenten an Literaturabteilungen wenden, um die Art von Büchern und Fernsehsendungen kennenzulernen, die sie bereits konsumieren? Man muss kein Raketenwissenschaftler sein - Bergsteiger reicht aus -, um zu erkennen, dass die Anziehungskraft des Fachwissens in der Verheißung neuer Fähigkeiten liegt, nicht in der Bestätigung alter Gewohnheiten. Der Höhepunkt der Englischen Literatur als Fachgebiet, das sowohl Studenten anzog als auch die Lesegewohnheiten von Nichtstudenten beeinflusste, muss um 1970 gewesen sein, als sich die Zahl der Englisch-Studenten seit den späten 40er Jahren vervierfacht hatte. Der zentrale Text dieser Zeit, nach 'Hamlet', war wahrscheinlich Miltons 'Paradise Lost', ein langes und kunstvolles Blankvers-Epos voller abgründiger Anspielungen und einer teuflischen Syntax, von dem Milton gehofft hatte, es werde 'ein passendes Publikum finden, wenn auch nur ein kleines'. Doch kurioserweise war genau dies der Weg, in der Nachkriegszeit weite Kreise anzusprechen."Film-Dienst (Deutschland), 01.12.2021
 In einem großen Essay befasst sich Patrick Holzapfel mit Mode und Film - dem Verhältnis zwischen beiden und der gemeinsamen Geschichte. "Ohne Mode hätte es manches Gesicht im Kino nie gegeben. Zwar ist die Geschichte der Mode, die auf die Renaissance zurückgeht, deutlich älter als jene des Kinos; trotzdem entwickelten sich beide parallel ab dem späten 19. Jahrhundert, als Industrie und Verbürgerlichung die gesellschaftlichen Entwicklungen maßgeblich beeinflussten. Dabei entsprach man in der Mode zu Beginn elitären Bedürfnissen; die Haute Couture als Kunsthandwerk dominierte. Erst mit den 1960er-Jahren, also just in der Zeit, in der kleinere und leistbare Kameras das Kino teilweise demokratisierten, explodierte Prêt-à-porter ('Haute Couture von der Stange'), und somit fanden beide Branchen ihren Weg in den Alltag des Mainstreams."
In einem großen Essay befasst sich Patrick Holzapfel mit Mode und Film - dem Verhältnis zwischen beiden und der gemeinsamen Geschichte. "Ohne Mode hätte es manches Gesicht im Kino nie gegeben. Zwar ist die Geschichte der Mode, die auf die Renaissance zurückgeht, deutlich älter als jene des Kinos; trotzdem entwickelten sich beide parallel ab dem späten 19. Jahrhundert, als Industrie und Verbürgerlichung die gesellschaftlichen Entwicklungen maßgeblich beeinflussten. Dabei entsprach man in der Mode zu Beginn elitären Bedürfnissen; die Haute Couture als Kunsthandwerk dominierte. Erst mit den 1960er-Jahren, also just in der Zeit, in der kleinere und leistbare Kameras das Kino teilweise demokratisierten, explodierte Prêt-à-porter ('Haute Couture von der Stange'), und somit fanden beide Branchen ihren Weg in den Alltag des Mainstreams."New Yorker (USA), 13.12.2021
 Elizabeth Kolbert überlegt, ob jüngste Experimente mit der Photosynthese eine Chance bieten, der globalen Lebensmittelknappheit entgegenzuwirken: "Die Photosynthese blieb über eine unfassbar lange Zeit natürlicher Selektion bemerkenswert stabil. Sie änderte sich nicht, als die Menschen vor zehntausend Jahren begannen, Pflanzen zu domestizieren, oder später, als sie herausfanden, wie man sie bewässert, düngt und schließlich hybridisiert. Sie funktionierte immer gut genug, um den Planeten mit Energie zu versorgen - bis jetzt. Stephen Long ist Professor für Pflanzenbiologie und Nutzpflanzenwissenschaften an der University of Illinois Urbana-Champaign und Leiter des Projekts Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE). Die Prämisse von RIPE ist es, dass Photosynthese, so bemerkenswert sie auch sein mag, verbesserungswürdig ist … Je mehr über die Feinheiten der Photosynthese herausgefunden wurde, desto mehr wurde ihre Ineffizienz enthüllt. Oft wird der Vergleich mit Photovoltaikzellen gezogen. Heutige Photovoltaikzellen wandeln etwa zwanzig Prozent des einfallenden Sonnenlichts in Strom um, in Labors haben Forscher Werte von fast fünfzig Prozent erreicht. Pflanzen wandeln nur etwa ein Prozent des auf sie treffenden Sonnenlichts in Wachstum um. Bei Nutzpflanzen wird im Durchschnitt nur etwa die Hälfte des Lichts in Energie umgewandelt, die der Mensch nutzen kann. Der Vergleich hinkt etwas, da Pflanzen sich selbst generieren, während Photovoltaikzellen mit Fremdenergie hergestellt werden. Pflanzen speichern zudem ihre eigene Energie, während Photovoltaikzellen dafür separate Batterien benötigen. Dennoch sind Forscher der Ansicht, dass Pflanzen schlechter abschneiden. Long ist überzeugt, dass die Ineffizienz der Photosynthese eine Chance bietet. Wenn der Prozess rationalisiert werden könnte, könnten Pflanzen, die Jahrtausende auf Sparflamme funktioniert hatten, echte Champions werden. Für die Landwirtschaft wären die Auswirkungen enorm. Potenziell könnten neue Pflanzensorten geschaffen werden, die mit weniger mehr produzieren könnten."
Elizabeth Kolbert überlegt, ob jüngste Experimente mit der Photosynthese eine Chance bieten, der globalen Lebensmittelknappheit entgegenzuwirken: "Die Photosynthese blieb über eine unfassbar lange Zeit natürlicher Selektion bemerkenswert stabil. Sie änderte sich nicht, als die Menschen vor zehntausend Jahren begannen, Pflanzen zu domestizieren, oder später, als sie herausfanden, wie man sie bewässert, düngt und schließlich hybridisiert. Sie funktionierte immer gut genug, um den Planeten mit Energie zu versorgen - bis jetzt. Stephen Long ist Professor für Pflanzenbiologie und Nutzpflanzenwissenschaften an der University of Illinois Urbana-Champaign und Leiter des Projekts Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE). Die Prämisse von RIPE ist es, dass Photosynthese, so bemerkenswert sie auch sein mag, verbesserungswürdig ist … Je mehr über die Feinheiten der Photosynthese herausgefunden wurde, desto mehr wurde ihre Ineffizienz enthüllt. Oft wird der Vergleich mit Photovoltaikzellen gezogen. Heutige Photovoltaikzellen wandeln etwa zwanzig Prozent des einfallenden Sonnenlichts in Strom um, in Labors haben Forscher Werte von fast fünfzig Prozent erreicht. Pflanzen wandeln nur etwa ein Prozent des auf sie treffenden Sonnenlichts in Wachstum um. Bei Nutzpflanzen wird im Durchschnitt nur etwa die Hälfte des Lichts in Energie umgewandelt, die der Mensch nutzen kann. Der Vergleich hinkt etwas, da Pflanzen sich selbst generieren, während Photovoltaikzellen mit Fremdenergie hergestellt werden. Pflanzen speichern zudem ihre eigene Energie, während Photovoltaikzellen dafür separate Batterien benötigen. Dennoch sind Forscher der Ansicht, dass Pflanzen schlechter abschneiden. Long ist überzeugt, dass die Ineffizienz der Photosynthese eine Chance bietet. Wenn der Prozess rationalisiert werden könnte, könnten Pflanzen, die Jahrtausende auf Sparflamme funktioniert hatten, echte Champions werden. Für die Landwirtschaft wären die Auswirkungen enorm. Potenziell könnten neue Pflanzensorten geschaffen werden, die mit weniger mehr produzieren könnten."Außerdem: D. T. Max trifft einen Waliser, der sein heute rund eine halbe Milliarde schweres Bitcoin Wallet entsorgte und seit Jahren die Müllhalden danach durchforstet. Dexter Filkins porträtiert die belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja. Alex Ross schreibt über Ash Fures Sound-Installation "Hive Rise". Und Margaret Talbot untersucht den Mythos Greta Garbo.
1 Kommentar







