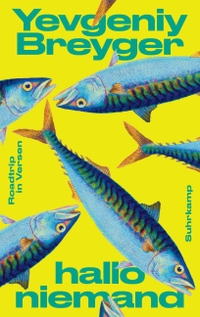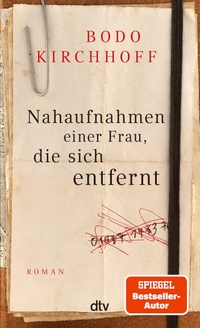Vom Nachttisch geräumt
Fanatismus und Statistik
Von Arno Widmann
18.12.2017. Die Verbindung von Hass und Präzision prägt bis heute die rassistische Polemik - auch bei Gottfried Benn, wie man aus einem seiner Briefe lernen kann. Am liebsten würde ich einfach den ganzen Brief abdrucken, den Gottfried Benn am 23. September 1933 Gertrud Zenses (1894-1970), geborene Cassel, in die USA schickte, wo sie seit 1928 lebte. Es ist nur einer von 293 Briefen, die in einer neuen Auswahl von Benn-Briefen gerade erschienen. Benn erklärt darin der Frau, mit der er 1921-1922 ein Liebesverhältnis hatte, dass "ich und die Mehrzahl aller Deutschen den neuen Staat bejahen, Hitler für einen sehr großen Staatsmann halten und vor allem vollkommen sicher sind, dass es für Deutschland keine andere Möglichkeit gab." Im Weiteren schreibt er: "Was nun das Judenproblem angeht, an dem Sie vielleicht besonders leiden und das Nordamerika mit seinem unvergleichlichen Rassenmischmasch natürlich ganz fremd ist, so sehen sie das sicher auch ganz falsch. Denken Sie einmal unter den Berliner Ärzten waren 85 % Juden, den Rechtsanwälten 75 %. In den journalistischen und Theaterbetrieben auch ungefähr 80 %. Es ist doch vollkommen selbstverständlich, dass dieser Zustand eines Tages als unmöglich angesehen wurde."
Am liebsten würde ich einfach den ganzen Brief abdrucken, den Gottfried Benn am 23. September 1933 Gertrud Zenses (1894-1970), geborene Cassel, in die USA schickte, wo sie seit 1928 lebte. Es ist nur einer von 293 Briefen, die in einer neuen Auswahl von Benn-Briefen gerade erschienen. Benn erklärt darin der Frau, mit der er 1921-1922 ein Liebesverhältnis hatte, dass "ich und die Mehrzahl aller Deutschen den neuen Staat bejahen, Hitler für einen sehr großen Staatsmann halten und vor allem vollkommen sicher sind, dass es für Deutschland keine andere Möglichkeit gab." Im Weiteren schreibt er: "Was nun das Judenproblem angeht, an dem Sie vielleicht besonders leiden und das Nordamerika mit seinem unvergleichlichen Rassenmischmasch natürlich ganz fremd ist, so sehen sie das sicher auch ganz falsch. Denken Sie einmal unter den Berliner Ärzten waren 85 % Juden, den Rechtsanwälten 75 %. In den journalistischen und Theaterbetrieben auch ungefähr 80 %. Es ist doch vollkommen selbstverständlich, dass dieser Zustand eines Tages als unmöglich angesehen wurde." Das hat er für den Zensor geschrieben! Denke ich. Aber ist das so? Oder will ich nur nicht zulassen, dass einer der bedeutendsten Dichter jener Jahre so etwas dachte? Dabei ist das Muster so deutlich. Die Verbindung von Hass und Präzision, von Fanatismus und Statistik prägt bis heute die rassistische Polemik. Woher weiß Benn um diese 85, 75, 80 Prozent? Er hat sie der Propaganda entnommen. Er hat sie nie überprüft. Er musste das nicht. Es ging ihm nämlich so wenig um die wirklichen Zahlen wie es den Rassisten heute um die wirklichen Zahlen geht. Sie dienen auch nur scheinbar der Rechtfertigung. Die ist nämlich nicht nötig. Denn der Andere ist das Hassobjekt. Nein, das stimmt nicht. Der Andere ist es nicht, sondern die Kontamination durch ihn. Es geht um Reinheit.
Das Hasswort in Benns Brief ist "Rassenmischmasch". Das wirft ein erhellendes Licht auf den Rassismus. Abgesehen davon, dass völlig unklar ist, was eine Rasse sein soll, weiß doch jeder, dass es keine reinen Rassen gibt. Der Rassismus ist ganz elementar ein Selbsthass. Dem Maßstab, mit dem er die Welt richtet, wird er selbst niemals genügen können. Schon wenige Jahre später wurde das den meisten Deutschen klar - beim Versuch einen Ariernachweis zu erbringen. Dass es sich beim Rassismus auch um einen Selbsthass handelt, schmälert nicht den Hass auf den anderen, sondern munitioniert ihn. Der Selbsthass erscheint aus der Sicht des Rassisten als etwas, das ihm angetan wird. Er ist Opfer. Er führt einen verzweifelten Kampf gegen eine ihn überwältigende Übermacht: 85, 75, 80 Prozent. Das sind mythische Größen. Dass sie als Zahlenverhältnisse ausgedrückt werden, ist ein Produkt der Aufklärung. Diese Art von Rassismus ist ihr Werk.
Der erste überlieferte Brief Benns an Gertrud Cassel vom 31. Juli 1922 begann so: "Petitchen, eben kommt Deine erste Nachricht, totmüder kleiner Mungo Du." Nach der Trennung ging Benn wieder zum Sie über. Gertrud Cassel war Bibliothekarin. 1925-1926 hatte sie auf Schloss Neuhardenberg die fürstliche Bibliothek aus Kisten geborgen, geordnet und aufgestellt. 1931 gründete sie eine deutsche Buchhandlung in San Francisco. Nach dem Krieg schickte sie Care-Pakete an das Ehepaar Benn. Sie starb 1970 in der Schweiz. Das weiß ich dank der reichen Anmerkungen in diesem Band. Benns Septemberbrief erschien übrigens erstmals 2006 im Marbacher Magazin 113, das "Benns Doppelleben oder Wie man sich selbst zusammensetzt" gewidmet war. Herausgeber war Jan Bürger, der darüber auch einen Artikel in der Zeit veröffentlichte.
Man wüsste gerne, wie Benn aus der Falle von Hass und Selbsthass herausfand. Vielleicht weil die Nazis ihn daraus vertrieben?
Gottfried Benn: "Absinth schlürft man mit Strohhalm, Lyrik mit Rotstift" - Ausgewählte Briefe 1904-1956, Klett Cotta, Wallstein, Stuttgart, Göttingen 2017, herausgegeben und kommentiert von Holger Hof, 623 Seiten, s/w Abbildungen, 39,90 Euro
Kommentieren